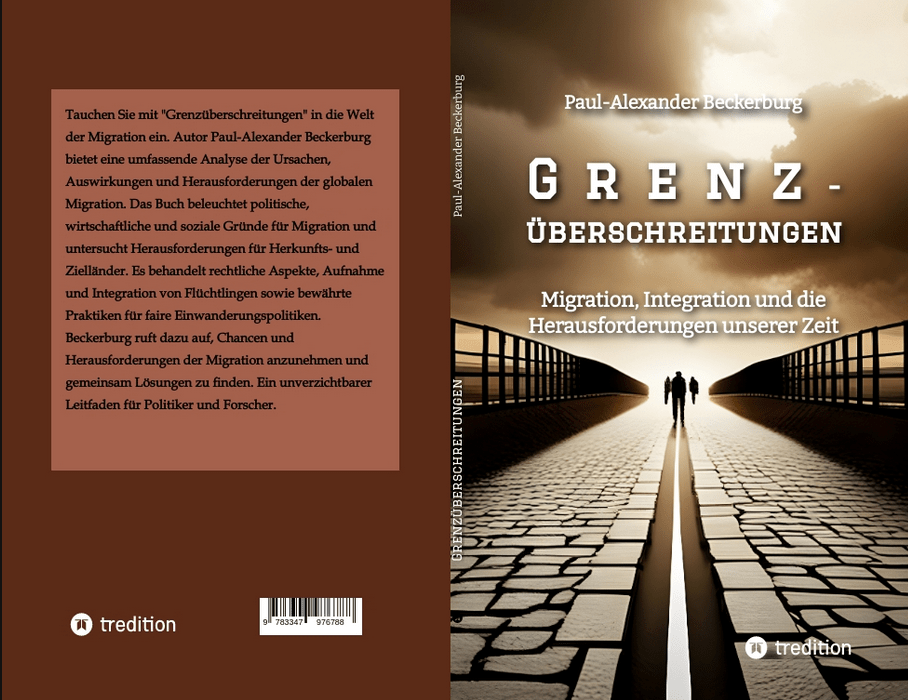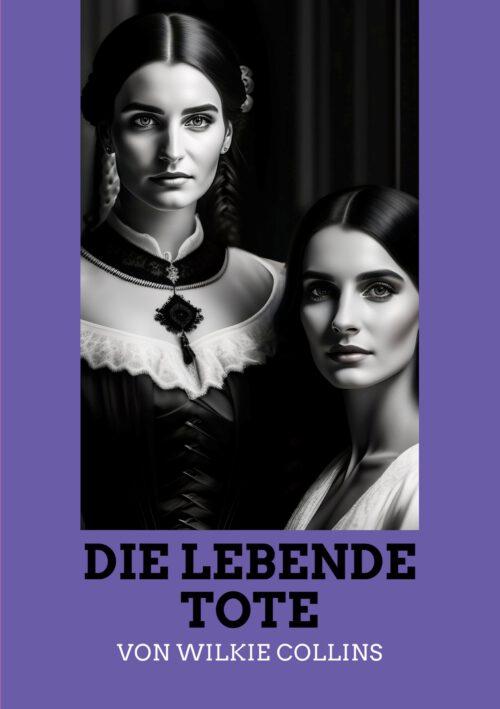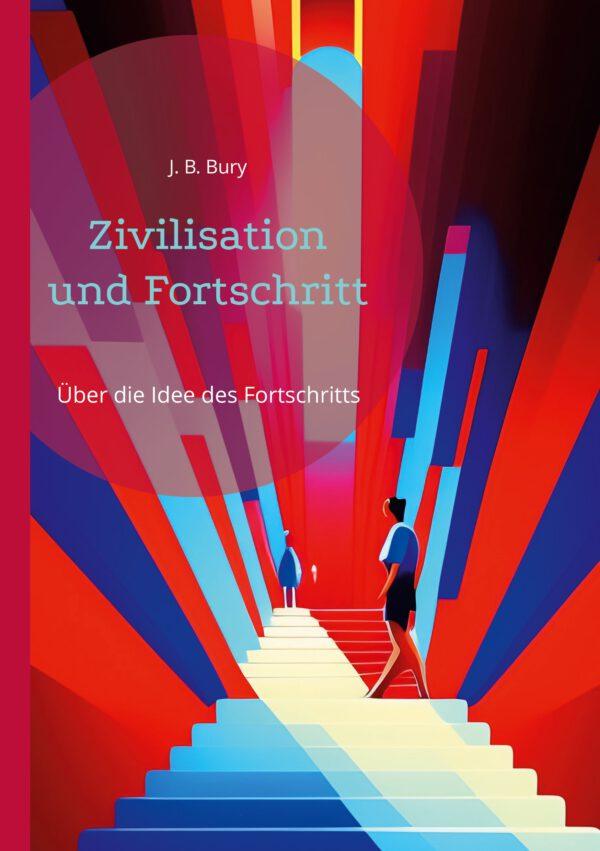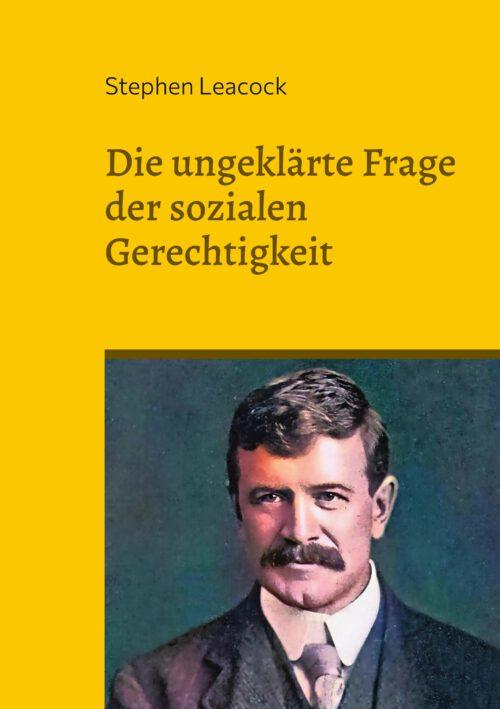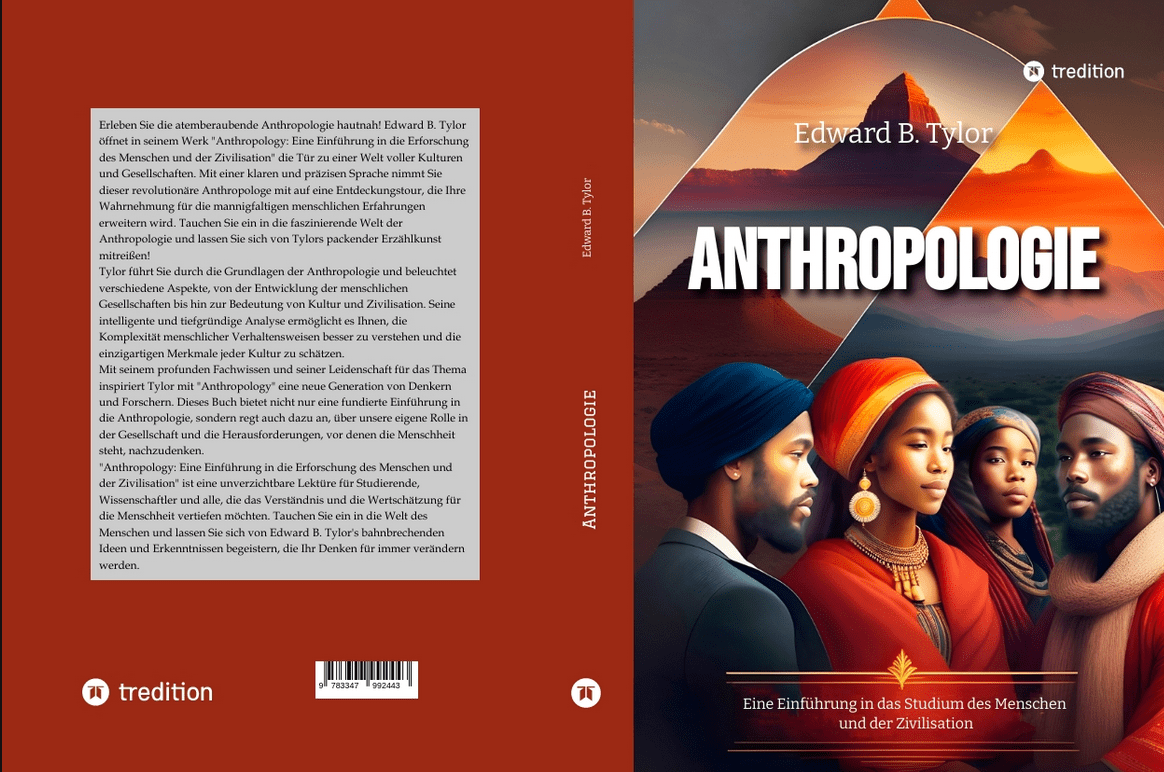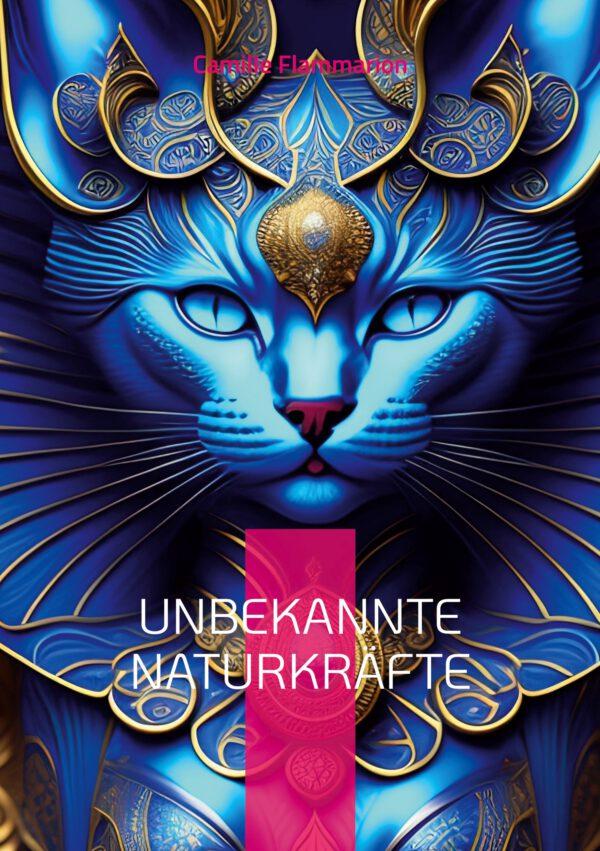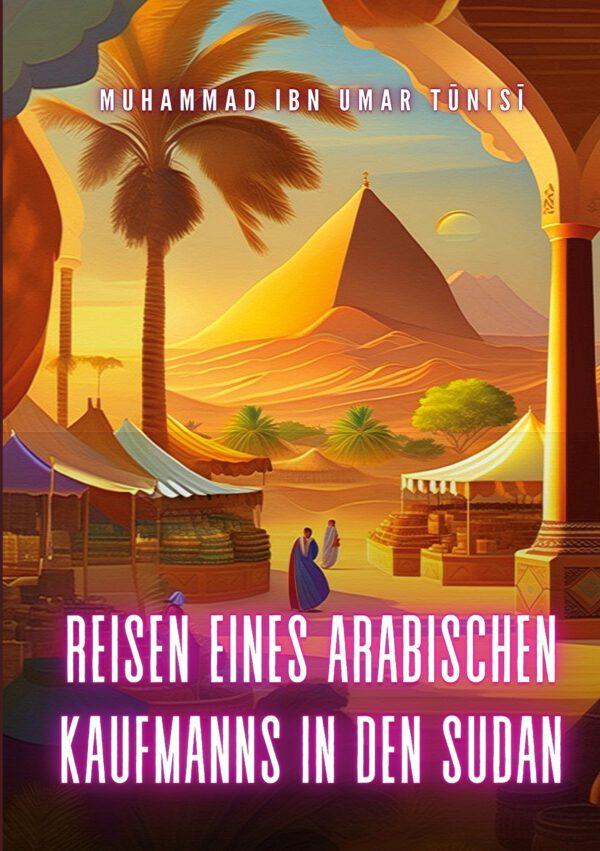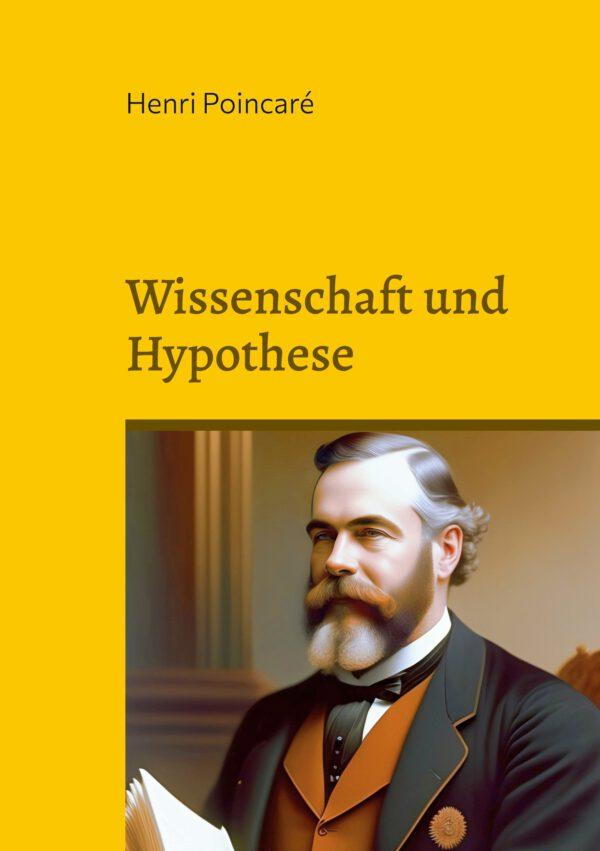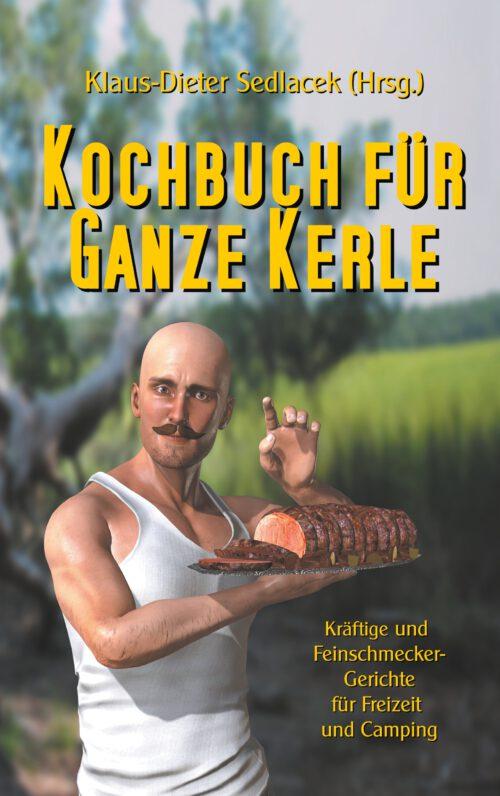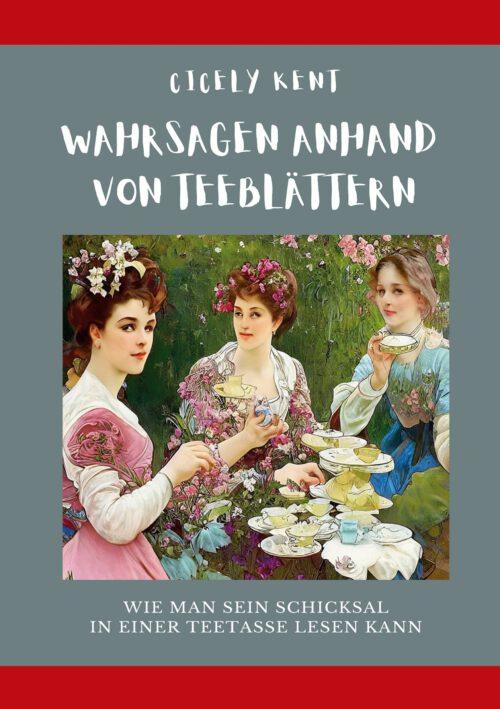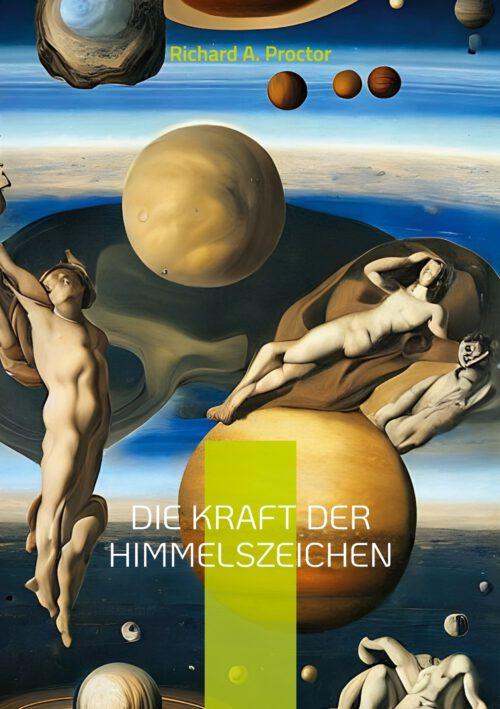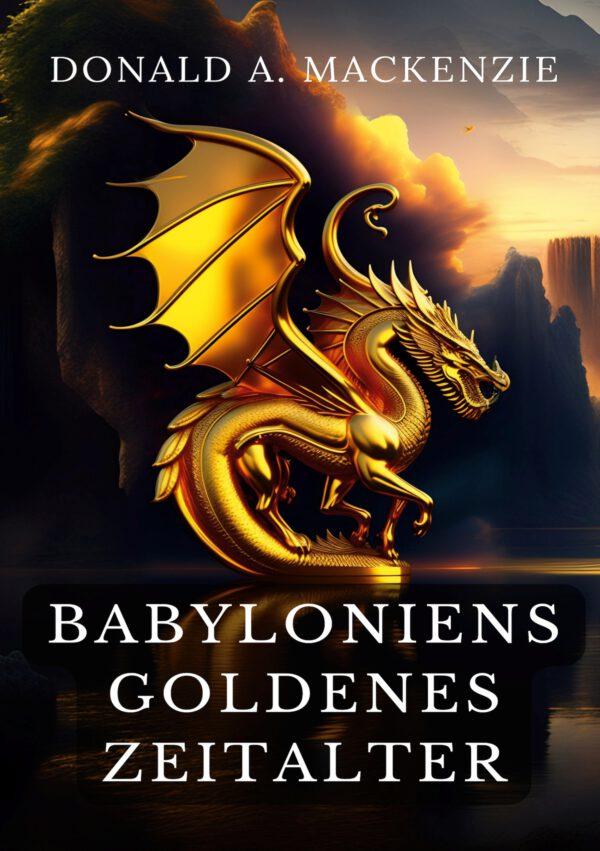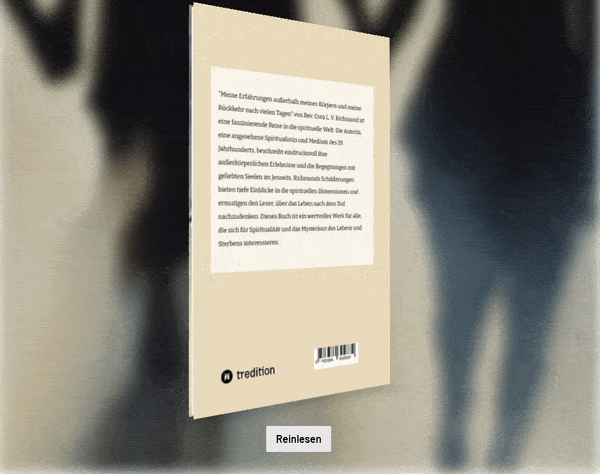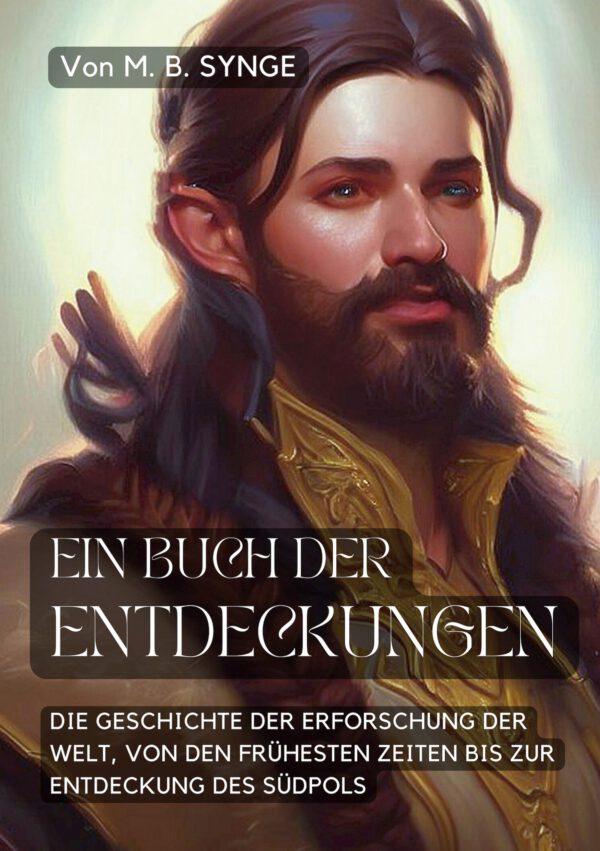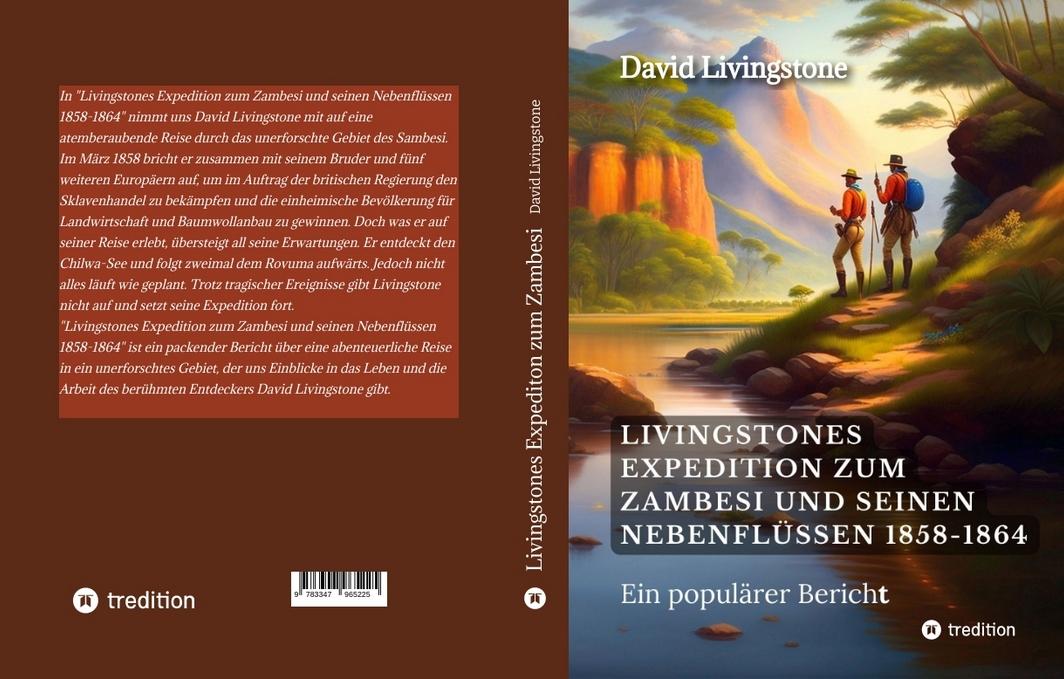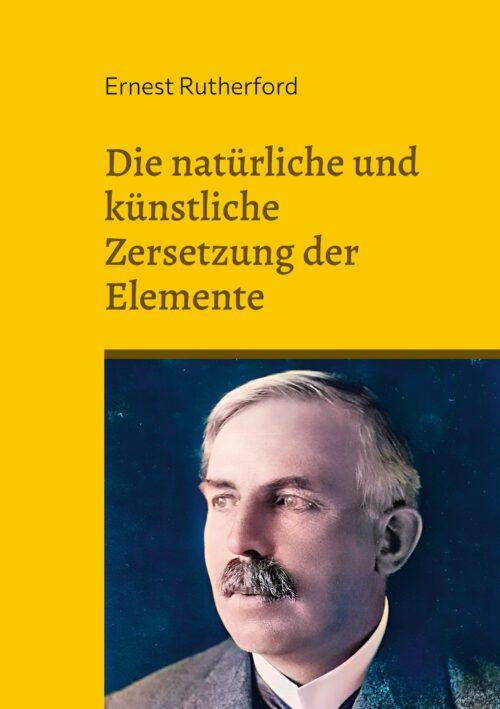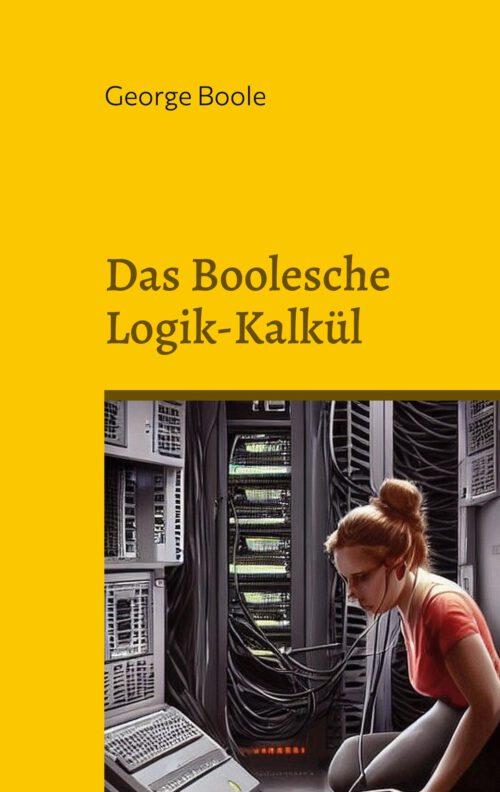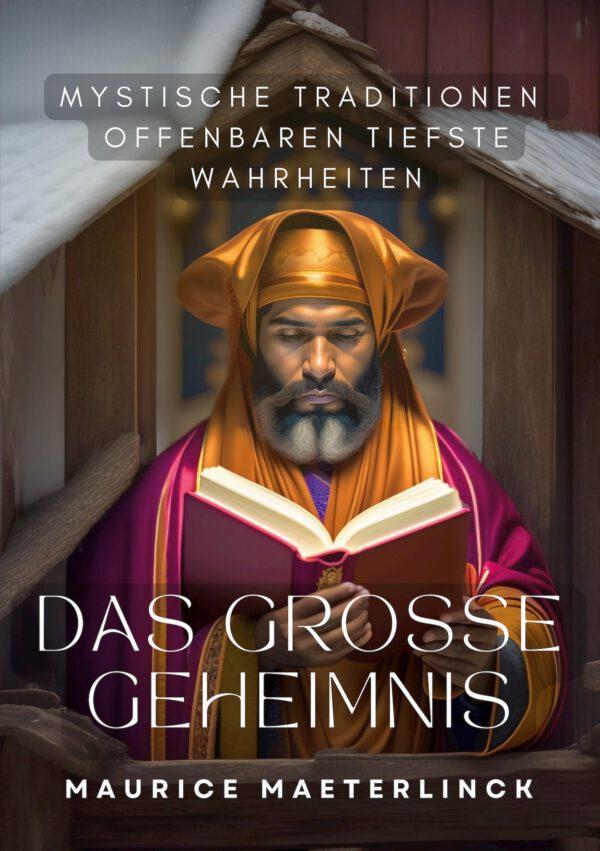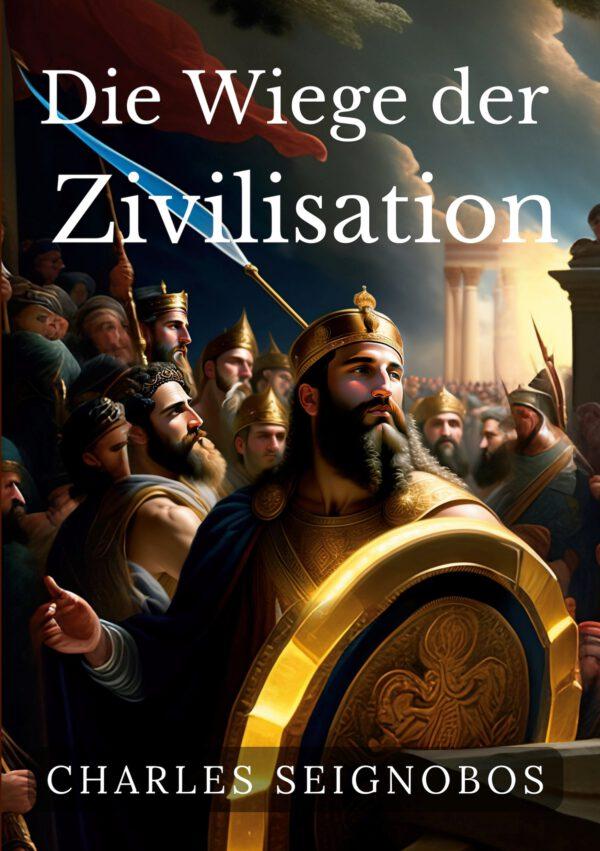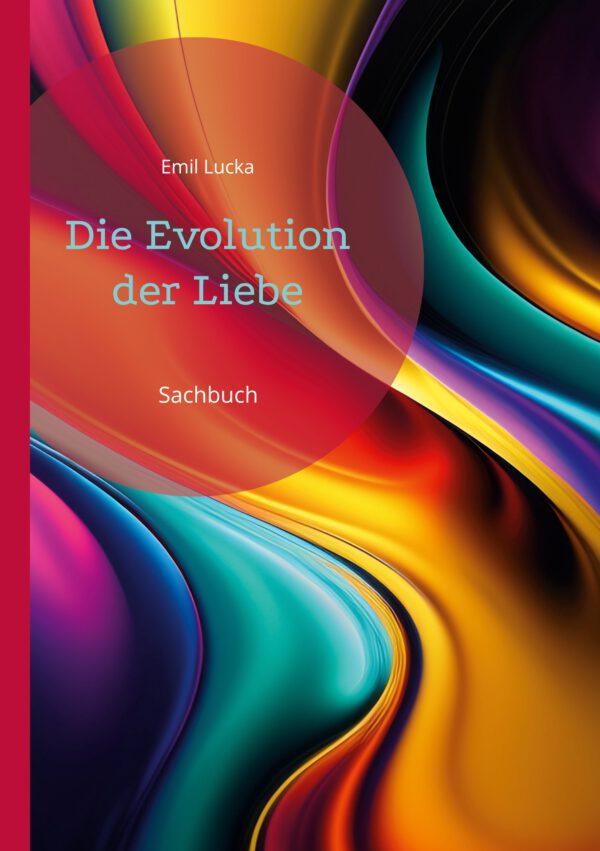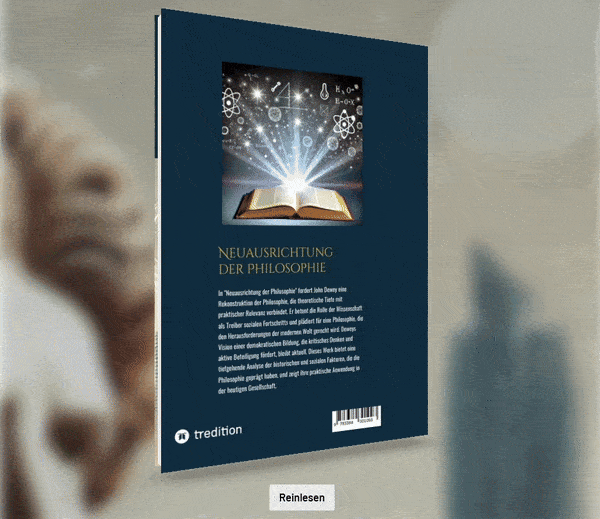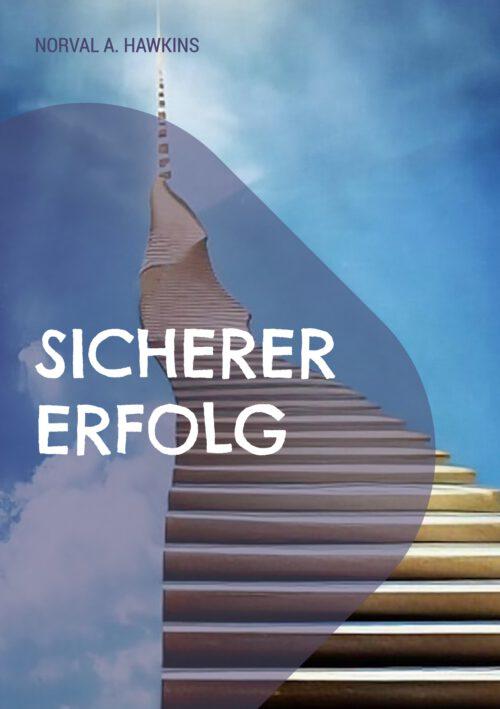DIE MENSU von
Horacio Quiroga
Cayetano Maidana und Esteban Podeley, Arbeiter, waren mit fünfzehn Begleitern auf dem Rückweg nach Posadas im Silex. Podeley, ein Holzarbeiter, kehrte nach neun Monaten zurück, der Vertrag war abgeschlossen, und er hatte freie Fahrt. Cayé, ein Holzhändler, kam unter den gleichen Bedingungen an, allerdings erst nach anderthalb Jahren, der Zeit, die nötig war, um sein Konto zu löschen.
Abgemagert, zerzaust, in ihren Hosen, die Hemden in langen Schlitzen geöffnet, barfuß wie die meisten von ihnen, schmutzig wie alle, verschlangen die beiden Mensu mit ihren Augen die Hauptstadt des Waldes, Jerusalem und Golgatha ihres Lebens. Neun Monate dort oben! Eineinhalb Jahre! Aber endlich waren sie zurück, und die immer noch schmerzende Axt des obraje-Lebens war nur ein Splitter im Angesicht der schallenden Freude, die sie dort rochen.
Von hundert Arbeitern kommen nur zwei in Posadas an und bekommen einen Job. Für den wochenlangen Ruhm, zu dem der Fluss sie flussabwärts zieht, rechnen sie mit der Vorauszahlung eines neuen Vertrags. Als Vermittler und Helfer wartete am Strand eine Gruppe fröhlicher Mädchen mit Charakter und Beruf, vor denen die durstigen mensú ihr „ahijú!“ des dringenden Wahnsinns ausstießen.
Cayé und Podeley taumelten von der Pregustada-Orgie herunter und fanden sich, umgeben von drei oder vier Freunden, in einem Augenblick vor einer ausreichenden Menge Zuckerrohr wieder, um den Hunger eines Mensú zu stillen.
Einen Moment später waren sie betrunken und hatten einen neuen Vertrag in der Tasche. Welcher Job? Wo? Sie wussten es nicht und es war ihnen auch egal. Ja, sie wussten, dass sie vierzig Pesos in der Tasche hatten und die Macht, viel mehr auszugeben. Sabbernd vor Ruhe und alkoholischer Glückseligkeit, fügsam und unbeholfen, folgten sie beide den Mädchen zum Anziehen. Die weisen Jungfrauen führten sie zu einem Geschäft, zu dem sie eine besondere Beziehung hatten, oder vielleicht zum Laden des Bauunternehmers. Aber in dem einen oder anderen erneuerten die Mädchen den sprengenden Luxus ihrer Lumpen, schmiegten ihre Köpfe in Peinetones, hängten sich mit Bändern auf – alles mit vollkommener Kaltblütigkeit vom edlen Geist ihres Gefährten gestohlen, denn das Einzige, was der Mensu wirklich besitzt, ist eine brutale Loslösung von seinem Geld.
Cayé seinerseits kaufte weit mehr Extrakte, Lotionen und Öle, als nötig waren, um die Übelkeit in seinen neuen Kleidern zu unterdrücken, während Podeley, der umsichtiger war, auf einen Stoffanzug bestand. Möglicherweise hatten sie teuer für eine Rechnung bezahlt, die ignoriert und mit einem Stapel auf den Tresen geworfener Papiere bezahlt worden war. Aber auf jeden Fall warfen sie eine Stunde später ihren extravaganten, stiefeltragenden, ponchogeschulterten, 44er Revolver im Gürtel, natürlich, in einen offenen Wagen, die Kleider voller Zigaretten, die sie ungeschickt zwischen den Zähnen entwirrten und aus jeder Tasche die Spitze eines Taschentuchs fallen ließen. Sie wurden von zwei Mädchen begleitet, die stolz auf diesen Reichtum waren, dessen Ausmaß man an dem etwas müden Gesichtsausdruck der Mensu erkennen konnte, die morgens und abends eine Infektion aus dunklem Tabak und Obraje-Extrakt durch die heißen Straßen schleppten.
Endlich kam die Nacht und mit ihr die Bailanta, wo dieselben Jungfrauen mit denselben Warnungen die mensú zum Trinken verleiteten, die wegen ihres Vorschusses 10 Pesos für eine Flasche Bier hinwarfen, um dafür 1,40 zu erhalten, die sie ohne einen Blick darauf zu werfen behielten.
In ständiger Vergeudung von neuen Fortschritten – ein unwiderstehliches Bedürfnis, mit sieben Tagen großer Herrschaft für das Elend der Obraje zu entschädigen – fuhr die Silex wieder den Fluss hinauf. Cayé brachte einen Begleiter mit, und beide ließen sich, betrunken wie die anderen Arbeiter, auf der Brücke nieder, wo bereits zehn Maultiere in engem Kontakt mit Stiefeln, Bündeln, Hunden, Frauen und Männern zusammengepfercht waren.
Am nächsten Tag, als der Kopf frei war, prüften Podeley und Cayé ihre Sparbücher: Es war das erste Mal, dass sie dies seit dem Vertrag taten. Cayé hatte 120 in bar und 35 in Form von Spesen erhalten, Podeley 130 bzw. 75.
Sie sahen sich beide mit einem Gesichtsausdruck an, der ein Ausdruck des Entsetzens hätte sein können, wenn ein Mensu nicht vollkommen von solchen Beschwerden geheilt wäre. Sie konnten sich nicht daran erinnern, auch nur ein Fünftel ausgegeben zu haben.
-Aha…!“, murmelte Cayé, „das werde ich nie wieder gut machen…“.
Und von diesem Moment an hatte er einfach – als gerechte Strafe für seine Verschwendungssucht – die Idee, von dort zu fliehen.
Die Legitimität seines Lebens in Posadas war für ihn jedoch so offensichtlich, dass er eifersüchtig auf den großen Vorschuss war, den Podeley erhielt.
-Sie haben Glück“, sagte er, „großartig, Ihr Vorsprung.
-Sie bringen eine Begleiterin mit“, wandte Podeley ein, „die Sie für Ihre Tasche bezahlen…..
Cayé sah seine Frau an, und obwohl Schönheit und andere moralische Qualitäten bei der Wahl einer Mensu nur wenig Gewicht haben, war er zufrieden. Das Mädchen war in der Tat umwerfend in ihrem Satinanzug, dem grünen Rock und der gelben Bluse; sie trug eine dreifache Perlenkette um ihren schmutzigen Hals, Schuhe im Stil von Louis XV, ihre Wangen waren brutal geschminkt, und unter ihren verengten Augenlidern steckte eine verächtliche Blattzigarre.
Cayé betrachtete das Mädchen und ihren .44er Revolver: das war wirklich das Einzige, was er bei sich hatte, das etwas wert war. Und selbst letzteres drohte nach dem Vorstoß zu scheitern, egal wie winzig seine Versuchung zum Schnitzen war.
Zwei Meter von ihm entfernt, auf einem Tip-Top-Stiefel, spielten die Mensu gewissenhaft mit allem, was sie hatten. Cayé schaute eine Weile zu und lachte, so wie Peons immer lachen, wenn sie zusammen sind, was auch immer der Grund sein mag. Dann näherte er sich dem Kofferraum, legte eine Karte darauf und fünf Zigarren.
Es war ein bescheidener Anfang, der ihm vielleicht genug Geld verschaffte, um den Vorschuss auf der Obraje zu bezahlen und mit demselben Dampfer nach Posadas zurückzukehren, um einen neuen Vorschuss zu verprassen.
Er verlor; er verlor die anderen Zigarren, er verlor fünf Pesos, den Poncho, die Halskette seiner Frau, seine eigenen Stiefel und seine 44. Am nächsten Tag bekam er die Stiefel zurück, aber mehr nicht, während das Mädchen die Nacktheit ihres Halses mit unaufhörlichen verächtlichen Zigarren kompensierte.
Podeley gewann nach unendlichem Besitzerwechsel die fragliche Halskette und eine Schachtel mit Duftseifen, die er gegen eine Machete und ein halbes Dutzend Strümpfe ausspielen konnte, und war damit zufrieden.
Sie waren endlich angekommen. Die Arbeiter kletterten das endlose rote Band die Schlucht hinauf, von deren Spitze aus die „Silex“ gemein und versunken im tristen Fluss erschien. Und mit ahijus und schrecklichen Schimpfwörtern auf Guarani, ja, das ist alles, was Freude macht, entließen sie den Dampfer, der in drei Stunden die ekelerregende Atmosphäre von Schlamperei, Patschuli und kranken Maultieren ertränken sollte, die vier Tage lang mit ihm hochfuhr.
* * * * *
Für Podeley, einen Holzfäller, dessen Tageslohn bis zu sieben Pesos betragen konnte, war das Leben eines Arbeiters nicht schwer. Nachdem er sein Streben nach strikter Gerechtigkeit beim Holzeinschlag gezähmt hatte und für den routinemäßigen Raubbau mit gewissen Privilegien eines guten Arbeiters entschädigt wurde, begann am nächsten Tag seine neue Etappe, nachdem sein Waldgebiet abgegrenzt worden war. Er baute sein Schuppendach und die Südwand aus Palmblättern – das Bett nannte er acht horizontale Stangen, mehr nicht; und an einer Mistgabel hing er den Wochenvorrat auf. Er nahm automatisch seine Arbeit wieder auf: Schweigende Kumpel, wenn er aufstand, noch in der Nacht, die eine nach der anderen folgte, ohne die Hand vom Kessel zu nehmen; Erkundung auf dem Holzdeck; Frühstück um acht Uhr, Mehl, Charque und Fett; dann die Axt, mit nacktem Oberkörper, deren Schweiß Pferdefliegen, Barigüís und Moskitos anlockte; dann das Mittagessen, diesmal Bohnen und Mais, die im unvermeidlichen Fett schwammen, um in der Nacht, nach einem weiteren Kampf mit den 8 mal 30 Stücken, mit der Yopará am Mittag zu enden.
Abgesehen von dem einen oder anderen Zwischenfall mit seinen Mitbauern, die in seinen Zuständigkeitsbereich eingedrungen waren, und der Müdigkeit der Regentage, die ihn dazu zwangen, vor dem Kessel zu hocken, ging die Arbeit bis Samstagnachmittag weiter. Dann wusch er seine Wäsche und am Sonntag ging er in den Laden, um sich einzudecken.
Dies war die eigentliche Zeit des Trostes für den mensú, der inmitten der Anathema der einheimischen Sprache alles vergaß und mit indigenem Fatalismus die immer weiter steigenden Lebensmittelpreise ertrug, die damals fünf Pesos pro Machete und achtzig Cent pro Kilo Kekse erreichten. Derselbe Fatalismus, der dies mit einem ¡añá! und einem lächelnden Blick auf seine Mitmenschen akzeptierte, diktierte ihm als elementare Sühne die Pflicht, so schnell wie möglich aus dem obraje zu fliehen. Und wenn dieser Ehrgeiz nicht in allen Brüsten steckte, so verstanden doch alle Arbeiter diesen Biss der Gegenjustiz, der, wenn er käme, seine Zähne in den Eingeweiden des Chefs versenken würde. Dieser seinerseits trieb den Kampf auf die Spitze, indem er sein Volk Tag und Nacht bewachte, insbesondere die Monatsarbeiter.
Die mensu waren dann an der planchada beschäftigt und schlugen Stücke inmitten von endlosem Geschrei nieder, das sich zu einem Crescendo steigerte, als die Maultiere, die nicht in der Lage waren, die mit voller Geschwindigkeit herabstürzende alzaprima aufzuhalten, sich gegenseitig überrollten und Balken, Tiere, Karren, alles durcheinander warfen. Die Maultiere wurden nur selten verletzt, aber der Aufruhr war derselbe.
Cayé dachte zwischen Lachen und Lachen immer wieder an seine Flucht. So müde er auch von den Drehungen und Wendungen und den Yoparas war, die der Pregusto des Fluges noch unverdaulicher machte, so blieb er doch in Ermangelung eines Revolvers stehen, und zwar vor der Winchester des Vorarbeiters. Aber wenn er doch nur eine .44 hätte!
Das Glück kam ihm dieses Mal auf eine etwas andere Art und Weise zu Hilfe.
Cayés Gefährtin, die nicht mehr ihre luxuriöse Kleidung trug, wusch die Wäsche der Knechte, und eines Tages zog sie um. Cayé wartete zwei Nächte und ging in der dritten Nacht zum Haus seines Ersatzes, wo er dem Mädchen eine Tracht Prügel verpasste. Die beiden Männer wurden allein gelassen und unterhielten sich, woraufhin sie sich darauf einigten, zusammenzuleben, wozu der Verführer bei dem Paar einzog. Das war sparsam und sehr vernünftig. Aber da der Mensu die Dame wirklich zu mögen schien – eine Seltenheit in der Zunft – bot Cayé sie für einen Revolver mit Kugeln zum Kauf an, den er selbst aus dem Lagerhaus holen würde. Trotz dieser Einfachheit wäre das Geschäft beinahe geplatzt, denn im letzten Moment verlangte Cayé einen Meter Tabak in einer Schnur, was den Mensu übertrieben erschien. Endlich war der Markt beendet, und während das kühle Paar sich in seiner Ranch niederließ, lud Cayé gewissenhaft seine 44, um den verregneten Nachmittag mit einem Mate-Trinken ausklingen zu lassen.
* * * * *
Der Herbst neigte sich dem Ende zu, und der Himmel, der mit fünfminütigen Schauern in der Dürre verharrte, brach endlich in ein konstantes Schlechtwetter ein, dessen Feuchtigkeit dem mensú auf die Schulter schlug. Podeley, der bis dahin frei war, fühlte sich eines Tages, als er seinen Balken erreichte, so lustlos, dass er stehen blieb und sich umsah, um zu sehen, was er tun konnte. Er hatte keine Lust auf irgendetwas. Er ging zurück zu seinem Schuppen und spürte auf dem Weg dorthin ein leichtes Kribbeln in seinem Rücken.
Er wusste sehr wohl, was diese Lustlosigkeit und das Kribbeln waren. Er setzte sich philosophisch hin, um Mate zu trinken, und eine halbe Stunde später lief ihm ein langer, tiefer Schauer unter seinem Hemd über den Rücken.
Es gab nichts zu tun. Er legte sich auf das Bett, zitterte vor Kälte, beugte sich unter seinem Poncho vor und klapperte unkontrolliert mit den Zähnen.
Am nächsten Tag kam der Zugriff, der erst in der Dämmerung erwartet wurde, mittags, und Podeley ging zur Polizeistation, um nach Chinin zu fragen. Der Köter war so deutlich in der Erscheinung der Mensu angeprangert, dass der Schreiber die Päckchen mit kaum einem Blick auf den kranken Mann herunterbrachte, der sich die schreckliche Bitterkeit ruhig über die Zunge goss. Als er in den Busch zurückkehrte, fand er den Butler.
-Sie auch“, sagte der Letztere und sah ihn an, „das macht vier. Die anderen spielen keine Rolle… nicht viel. Wie sieht es mit Ihrem Konto aus?
-Es wird nicht mehr lange dauern… aber ich werde nicht mehr arbeiten können…
-Passen Sie gut auf sich auf und es ist nichts weiter… Bis morgen.
-Wir sehen uns morgen“, sagte Podeley und eilte davon, denn er hatte gerade ein leichtes Kribbeln in den Fersen gespürt.
Der dritte Angriff begann eine Stunde später, und Podeley lag flach und war völlig kraftlos, seine Augen starr und stumpf, als könne er nicht mehr als ein oder zwei Meter gehen.
Die absolute Ruhe, die er sich drei Tage lang gönnte – ein besonderer Balsam für die Mensu, so unerwartet sie auch war – verwandelte ihn nur in einen plappernden, zusammengerollten Klumpen auf einem Stumpf. Podeley, dessen früheres Fieber einen ehrenhaften und periodischen Rhythmus gehabt hatte, versprach sich nichts Gutes von diesem Galopp fast ununterbrochener Anfälle. Es gibt Fieber und Fieber. Wenn das Chinin den zweiten Anfall nicht abgekürzt hatte, war es sinnlos für ihn, dort oben zu bleiben, um bei jeder Drehung der Spirale haufenweise zu sterben. Und er ging zurück in den Lagerraum.
-Sie schon wieder“, sagte der Butler, „das ist nicht gut… Haben Sie kein Chinin genommen?
-Ich habe sie genommen… Ich fühle mich nicht wohl mit diesem Fieber… Ich kann nicht arbeiten. Wenn Sie mir Geld für mein Ticket geben wollen, werde ich es tun, sobald ich gut….
Der Butler betrachtete die Ruine und hielt nicht viel von dem Leben, das dort verblieben war.
-Wie sieht Ihr Konto aus?“, fragte er erneut.
-Ich schulde noch zwanzig Pesos… Am Samstag habe ich geliefert… Ich bin sehr krank….
-Sie wissen genau, dass Sie bleiben müssen, solange Ihr Konto nicht bezahlt ist.
Unten… können Sie sterben. Lassen Sie sich hier heilen, und Sie werden Ihre Rechnung sofort begleichen.
Heilen Sie sich von einem verderblichen Fieber, woher haben Sie es? Nein, gewiss nicht. Aber der mensu, der weggeht, darf nicht zurückkehren, und der Butler zog einen toten Mann einem entfernten Schuldner vor.
Podeley hatte noch nie etwas versäumt, die einzige Arroganz, die ein Mensu von solchem Format seinem Herrn gegenüber an den Tag legt.
-Es ist mir egal, ob Sie säumig sind oder nicht“, antwortete der Butler, „bezahlen Sie erst Ihre Rechnung, dann sehen wir weiter!
Diese Ungerechtigkeit hat bei ihm logischerweise schnell den Wunsch nach Rache geweckt. Er ging, um sich mit Cayé niederzulassen, dessen Geist er gut kannte, und sie beschlossen beide, am nächsten Sonntag wegzulaufen.
Aber am nächsten Tag, dem Freitag, gab es eine ungewöhnliche Bewegung in der Obraje.
-Da sind Sie ja“, rief der Butler und stolperte über Podeley, „drei von ihnen sind letzte Nacht entkommen… Das gefällt Ihnen doch, oder? Sie waren auch gut darin, wie Sie! Aber Sie platzen lieber hier rein, als aus dem Eisen zu kommen! Und seien Sie vorsichtig, Sie und alle, die zuhören! Sie wissen schon!
Der Entschluss zu fliehen und die damit verbundenen Gefahren, für die der Mensch seine ganze Kraft braucht, können mehr als ein schädliches Fieber auslösen. Der Sonntag war bereits angebrochen, und mit falschen Manövern wie Wäschewaschen, simuliertem Gitarrenspiel auf dieser oder jener Ranch konnte die Überwachung umgangen werden, und Podeley und Cayé fanden sich plötzlich tausend Meter von der Polizeistation entfernt wieder.
Solange sie sich nicht verfolgt fühlten, würden sie die Picada nicht verlassen;
Podeley war schlecht zu Fuß. Und doch…
Die eigentümliche Resonanz des Waldes brachte ihnen, weit entfernt, eine heisere Stimme:
-Auf den Kopf! Auf beide!
Und einen Moment später kamen der Vorarbeiter und drei Arbeiter aus einer Biegung des Waldes gerannt, und die Jagd war eröffnet. Die Jagd war eröffnet.
Cayé spannte seinen Revolver, ohne aufzuhören, vorzurücken.
-Ergib dich, añá!“, rief der Vorarbeiter.
-Lasst uns in den Busch gehen“, sagte Podeley, „ich habe keine Kraft für meine Machete.
-Kommen Sie zurück oder ich werde Sie erschießen“, sagte eine andere Stimme.
Wenn sie näher kommen…“, begann Cayé. Ein Winchester-Geschoss pfiff an der Picada vorbei.
-Und als er hinter einem Baum in Deckung ging, gab er alle fünf Schüsse aus seinem Revolver ab.
Ein scharfer Schrei antwortete ihnen, als ein weiteres Winchester-Geschoss die Rinde des Baumes wegsprengte.
-Gib auf, oder ich lasse deinen Kopf…!
-Geh nicht weiter“, drängte Cayé Podeley, „ich werde…“.
Und nach einer weiteren Salve betrat er den Busch.
Die Verfolger, die durch die Explosionen für einen Moment aufgehalten wurden, stürmten wütend nach vorne und schossen, Schlag auf Schlag mit der Winchester, den wahrscheinlichen Weg der Flüchtigen ab.
Hundert Meter von dem Tauchgang entfernt und parallel dazu entfernten sich Cayé und Podeley, indem sie sich über den Boden beugten, um den Ranken auszuweichen. Die Verfolger vermuteten es, aber da im Busch die Chance, von einer Kugel mitten in die Stirn getroffen zu werden, hundert zu eins ist, begnügte sich der Vorarbeiter mit Winchester-Salven und trotzigem Gebrüll. Im Übrigen hatten die Fehlschüsse von heute am Donnerstagabend ein schönes Ziel abgegeben…..
Die Gefahr war vorüber. Die Flüchtenden setzten sich ergeben hin. Podeley wickelte sich in den Poncho ein und lehnte sich an den Rücken seines Begleiters, um zwei schreckliche Stunden lang die Rückwirkung dieser Anstrengung zu ertragen.
Sie setzten ihre Flucht fort, immer in Sichtweite der Picada, und als es schließlich Nacht wurde, schlugen sie ihr Lager auf. Cayé hatte ein paar Chips mitgebracht, und Podeley zündete ein Feuer an, trotz der tausend Unannehmlichkeiten in einem Land, in dem es außer den Pfauen noch andere Wesen gibt, die eine Schwäche für Licht haben, ganz zu schweigen von den Menschen.
Die Sonne stand schon sehr hoch, als sie am nächsten Morgen den Fluss fanden, die erste und letzte Hoffnung der geflohenen Männer. Cayé schnitt kurzerhand zwölf Tacuaras ab, und Podeley, dessen letzte Kraft dem Schneiden des Isipós gewidmet war, hatte kaum Zeit, dies zu tun, bevor er sich zusammenrollte und zitterte.
Daher baute Cayé die Jangada allein – zehn Tacuaras, die der Länge nach mit Lianen zusammengebunden waren und an jedem Ende eine durchbohrte Tacuaras trugen.
Zehn Sekunden nach der Fertigstellung gingen sie an Bord. Und die Hangadilla, die abgetrieben wurde, erreichte den Paraná.
Die Nächte waren zu dieser Zeit extrem kühl und die beiden Mensu verbrachten die Nacht mit den Füßen im Wasser und froren Seite an Seite. Die Strömung des Paraná, der mit heftigen Regenfällen beladen ankam, wirbelte die Jangada durcheinander und löste langsam die Isipó-Knoten.
Den ganzen nächsten Tag über aßen sie zwei Chipas, den letzten ihrer Vorräte, die Podeley kaum schmeckten. Die Tacuaras, die von den Tambús gebohrt wurden, sanken, und am späten Nachmittag war die Jangada auf ein Viertel des Wasserspiegels gesunken.
Auf dem wilden Fluss, eingeschlossen in den trostlosen Mauern des Waldes, trieben die beiden Männer knietief im Wasser, drehten sich um sich selbst, blieben einen Moment lang regungslos vor einem Strudel stehen und folgten dann wieder, wobei sie sich kaum an den fast losen Tacuaras festhalten konnten, die ihnen von den Füßen fielen, in einer Nacht aus Tinte, die ihre verzweifelten Augen nicht durchbrechen konnten.
Das Wasser stand ihnen bereits bis zur Brust, als sie Land erreichten. Wo? Sie wussten es nicht… ein Sumpf. Aber am Ufer selbst lagen sie regungslos, flach auf dem Rücken.
Die Sonne schien bereits, als sie aufwachten. Der Sumpf erstreckte sich zwanzig Meter landeinwärts und diente als Uferlinie für den Fluss und den Wald. Einen halben Block weiter südlich floss der Paranaí, den sie überqueren wollten, wenn sie wieder zu Kräften gekommen waren. Aber ihre Kräfte kehrten nicht so schnell zurück, wie sie es sich gewünscht hätten, denn Tacuara-Knospen und Würmer sind späte Verstärker. Und zwanzig Stunden lang verwandelte der Regen den Paraná in weißes Öl und den Paranaí in eine wütende Allee. Alles unmöglich. Podeley setzte sich plötzlich tropfnass auf, stützte sich auf seinen Revolver, um aufzustehen, und zielte. Er war mit Fieber unterwegs.
-Hereinspaziert, hereinspaziert!
Cayé sah, dass er von diesem Delirium wenig zu erwarten hatte, und beugte sich listig vor, um seinen Begleiter mit einem Stock zu erreichen. Aber der andere bestand darauf:
– „Geh zum Wasser, du hast mich hierher gebracht, geh zum Fluss!
Die lebhaften Finger zitterten am Abzug.
Cayé gehorchte. Er ließ sich von der Strömung mitreißen und verschwand im Dickicht, das er nur mit Mühe entern konnte.
Von dort und von hinten pirschte er sich an seinen Gefährten heran und hob den heruntergefallenen Revolver auf, aber Podeley lag wieder auf der Seite, mit den Knien an die Brust gezogen, im strömenden Regen. Als Cayé sich näherte, hob er den Kopf und murmelte, fast ohne seine vom Wasser geblendeten Augen zu öffnen, etwas:
-Cayé… oh je… Sehr kalt….
Es regnete die ganze Nacht hindurch auf den Sterbenden, der weiße, dumpfe Regen der Herbstschauer, bis Podeley im Morgengrauen für immer regungslos in seinem wässrigen Grab lag.
Und in demselben Strohwald, sieben Tage lang vom Wald, dem Fluss und dem Regen belagert, erschöpfte der Mensu alle möglichen Wurzeln und Würmer; nach und nach verlor er seine Kräfte, bis er sich vor Kälte und Hunger sterbend niederließ, den Blick auf den Paraná gerichtet.
Die Silex, die in der Abenddämmerung vorbeikam, sammelte die fast sterbende Mensu ein. Seine Freude schlug in Entsetzen um, als er am nächsten Tag feststellte, dass der Dampfer den Fluss hinauffuhr.
-Bitte, ich flehe Sie an“, rief er dem Kapitän zu, „lassen Sie mich nicht in Port X aussteigen!
Sie werden mich töten!… Ich flehe Sie an!… Ich flehe Sie an!…
Der Silex kehrte nach Posadas zurück und nahm den immer noch von Albträumen geplagten Mensu mit.
Aber innerhalb von zehn Minuten nach dem Landgang war er bereits betrunken, hatte einen neuen Vertrag und torkelte los, um Extrakte zu kaufen.
*YAGUAÍ
Jetzt könnte es nur noch dort sein. Yaguaí schnupperte an dem Stein – einem massiven Block aus Eisenerz – und umkreiste ihn vorsichtig. In der Mittagssonne von Misiones vibrierte die Luft über dem schwarzen Felsen, ein Phänomen, das dem Foxterrier nicht gefiel. Dort unten war jedoch die Eidechse. Er kreiste wieder, schnaubte in einem Zwischenraum und kratzte zur Ehre der Rasse einen Augenblick lang am brennenden Block. Dann kehrte er mit trägem Schritt zurück, was ihn aber nicht daran hinderte, auf beiden Seiten systematisch zu schnüffeln.
Er ging ins Esszimmer und lehnte sich zwischen die Anrichte und die Wand, ein kühler Zufluchtsort, den er als seinen eigenen betrachtete, trotz der Meinung des ganzen Hauses gegen ihn. Aber die düstere Ecke, die bewundernswert ist, wenn die Depression der Atmosphäre von einem Mangel an Luft begleitet wird, war an einem Tag mit Nordwind unmöglich. Das war eine neu gewonnene Erkenntnis über den Foxterrier, in dem noch immer das Erbe des gemäßigten Landes – Buenos Aires, die Heimat seiner Großeltern und seine eigene – kämpfte, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Er ging also nach draußen und setzte sich unter einen Orangenbaum, in den Feuerwind, der ihm aber das Atmen ungemein erleichterte. Und da Hunde nur wenig schwitzen, schätzte Yaguaí den verdunstenden Wind so sehr, wie er es auf der tanzenden Zunge, die ihm in den Weg gelegt wurde, tun konnte.
Das Thermometer erreichte in diesem Moment 40°. Aber gut geborene Foxterrier sind besonders trügerisch, wenn es um das Versprechen von Ruhe geht. Unter diesem feurigen Mittag, auf dem vulkanischen Plateau, das durch den roten Sand noch glühender wurde, gab es Eidechsen.
Mit geschlossenem Mund trat Yaguaí durch den Maschendraht und fand sich in der Mitte des Jagdfeldes wieder. Seit September war er nicht in der Lage gewesen, eine andere Beschäftigung zu finden als die groben Nickerchen. Dieses Mal spürte er vier der wenigen verbliebenen Fische auf, fing drei, verlor einen und ging dann schwimmen.
Hundert Meter vom Haus entfernt, am Fuße der Hochebene und am Ufer des Bananals, befand sich ein Brunnen aus lebendem Stein, der eine originelle Form hatte, da er von einem Profi mit Dynamit in Gang gesetzt, aber von einem Amateur mit einem Spaten fertiggestellt worden war. Es stimmt, dass er nur zwei Meter tief war und auf einer Seite in einem langen Steilhang lag, wie ein Meeresarm. Die Quelle, obwohl flach, hat zwei Monate lang der Trockenheit widerstanden, was in Misiones sehr lobenswert ist.
Der Foxterrier badete dort, erst mit der Zunge, dann mit dem Bauch, im Wasser sitzend, um zum Schluss zu schwimmen. Er würde dann zum Haus zurückkehren, solange ihm keine Spur in die Quere käme. Bei Sonnenuntergang kehrte er zum Brunnen zurück. Daher litt Yaguaí vage unter Flöhen und ziemlich leicht unter der tropischen Hitze, für die seine Rasse nicht geschaffen war.
Der Kampfinstinkt des Foxterriers manifestierte sich normalerweise bei trockenen Blättern; dann ging er zu Schmetterlingen und deren Schatten über und wandte sich schließlich den Eidechsen zu. Selbst im November, als er alle Ratten im Haus in Schach hielt, waren die Saurier sein großer Reiz. Die Landarbeiter, die aus dem einen oder anderen Grund zur Siesta kamen, bewunderten immer die Hartnäckigkeit des Hundes, der in kleinen Höhlen unter der glühenden Sonne schnaubte, obwohl ihre Bewunderung nicht über die Jagdszene hinausging.
-Das“, sagte einer von ihnen eines Tages und deutete mit dem Kopf auf den Hund, „ist nur gut für Käfer….
Der Besitzer von Yaguaí hat ihn gehört:
-Vielleicht“, antwortete er, „aber keiner Ihrer berühmten Hunde wäre in der Lage, das zu tun, was dieser hier tut.
Die Männer lächelten sich gegenseitig an, ohne zu antworten.
Cooper kannte jedoch die Buschhunde und ihre wunderbare Fähigkeit, auf der Flucht zu jagen, die sein Foxterrier nicht kannte. Sie lehren? Vielleicht, aber er hatte keine Möglichkeit, dies zu tun.
Noch am selben Nachmittag beschwerte sich ein Landarbeiter bei Cooper über die Rehe, die die Bohnen auffraßen. Er bat um eine Schrotflinte, denn obwohl er einen Hund hatte, konnte er sie nur manchmal mit einem Stock erreichen….
Cooper lieh ihm die Schrotflinte und schlug sogar vor, in dieser Nacht ins Gebüsch zu gehen.
-Es gibt keinen Mond“, wandte der Arbeiter ein.
-Macht nichts. Lassen Sie den Hund frei und wir werden sehen, ob meiner ihm folgen wird.
In dieser Nacht gingen sie zur Plantage. Der Landarbeiter ließ seinen Hund los, und das Tier rannte sofort in die Dunkelheit des Busches auf der Suche nach einer Spur davon.
Als er seinen Gefährten gehen sah, versuchte Yaguaí vergeblich, die Barriere der Caraguatá zu durchbrechen. Schließlich gelang es ihm und er folgte der Spur des anderen. Aber nach zwei Minuten war er wieder da, sehr zufrieden mit seiner nächtlichen Flucht. Im Umkreis von zehn Metern gab es kein Loch mehr, an dem er nicht schnüffelte.
Aber die Jagd auf dem Trail, im Busch, im Galopp, der von der Morgendämmerung bis drei Uhr nachmittags dauern kann, nein, das nicht. Der Hund des Landarbeiters fand eine weit entfernte Spur, die er sofort verlor. Eine Stunde später kehrte er zu seinem Herrn zurück, und sie gingen alle gemeinsam zum Haus zurück.
Der Beweis, wenn auch nicht schlüssig, entmutigte Cooper. Dann vergaß er das Ganze, während der Foxterrier weiter Ratten, die eine oder andere Eidechse oder den Fuchs in seiner Höhle und Eidechsen jagte.
In der Zwischenzeit folgten die Tage aufeinander, blendend, schwer, in einem hartnäckigen Nordwind, der das Gemüse in schlaffe Lappen faltete, unter dem weißen Himmel der glühenden Mittagsstunden. Das Thermometer stand bei 38-40, ohne die geringste Hoffnung auf Regen. Vier Tage lang hielt das Wetter an, mit drückender Windstille und steigender Hitze. Und als schließlich die Hoffnung verloren ging, dass der Süden in Strömen zurückkehren würde, weil der feurige Wind einen ganzen Monat lang aus dem Norden kam, fanden sich die Menschen mit einer katastrophalen Dürre ab.
Der Foxterrier lebte von da an sitzend unter seinem Orangenbaum, denn wenn die Hitze ein gewisses vernünftiges Maß überschreitet, atmen die Hunde im Liegen nicht gut. Mit heraushängender Zunge und zusammengekniffenen Augen beobachtete er das allmähliche Absterben von allem, was im Frühling knospte. Der Obstgarten war schnell verloren. Das Maisfeld verfärbte sich von einem hellen Grün in ein gelbliches Weiß, und Ende November waren nur noch stumpfe Säulen auf der trostlosen Schwärze des Weidelandes übrig. Der Maniok, der Held von allen, hat sich gut gehalten.
Der Brunnen des Foxterriers – seine Quelle war erschöpft – verlor von Tag zu Tag sein grünliches Wasser, und es war so heiß, dass Yaguaí nur noch am Morgen dorthin ging, obwohl er jetzt Spuren von Apereás, Agoutis und Frettchen fand, die die Trockenheit des Busches zu ihm hinauf trieb.
Als der Hund von seinem Bad zurückkehrte, setzte er sich wieder hin und beobachtete, wie der Wind allmählich zunahm, während das Thermometer, das im Morgengrauen auf 15 Grad abgekühlt war, um zwei Uhr nachmittags 41 Grad erreichte. Die Trockenheit der Luft trieb den Foxterrier dazu, jede halbe Stunde zu trinken und dann mit den Wespen und Bienen zu kämpfen, die in die Eimer einfielen und verdursteten. Die Hühner lagen keuchend im dreifachen Schatten der Bananenbäume, des Pavillons und des rot blühenden Weinstocks, wagten keinen Schritt auf den versengten Sand und unter einer Sonne, die die blonden Ameisen sofort tötete.
Rundherum, so weit die Augen des Foxterriers reichten, tanzten die Eisenblöcke, das vulkanische Geröll, der Berg selbst, schwindlig vor Hitze. Im Westen, am Fuße des bewaldeten Tals, versunken in der Senke der doppelten Sierra, lag der Paraná, zu dieser Stunde tot in seinem Zinkwasser und wartete darauf, dass der Abend zum Leben erwachte. Die Atmosphäre, die bis zu dieser Stunde noch leicht rauchig war, hüllte sich nun bis zum Horizont in dichten Dunst, hinter dem sich die Sonne, die über dem Fluss unterging, in einem perfekten Kreis aus Blut verhüllte. Und während der Wind ganz verstummte und Yaguaí in der immer noch versengten Luft seinen winzigen weißen Fleck über die Hochebene zog, verliehen die Palmen, die sich regungslos gegen den rubinroten Fluss abzeichneten, der Landschaft das Gefühl einer luxuriösen und düsteren Oase.
Die Tage vergingen wie immer. Der Brunnen des Foxterriers versiegte und die Härte des Lebens, der sich Yaguaí bis dahin entzogen hatte, begann für ihn noch am selben Nachmittag.
Der kleine weiße Hund war schon lange bei einem Freund von Cooper gefragt, einem Dschungelmann, der so manche verlorene Zeit im Busch auf der Suche nach Tattoos verbrachte. Für diese Jagd hatte er drei prächtige Hunde, die allerdings sehr dazu neigten, Nasenbären aufzuspüren, was für den Jäger zwar eine Zeitverschwendung war, aber auch die Möglichkeit einer Katastrophe bedeutete, da der Biss eines Nasenbären dem Hund, der ihn nicht zu fangen wusste, systematisch die Kehle aufschlitzte.
Fragoso, der den Foxterrier eines Tages bei der Arbeit in einer Irara-Affäre gesehen hatte, die Yaguaí zwang, unbedingt stillzuhalten, schloss daraus, dass ein kleiner Hund, der dieses besondere Talent hatte, genau zwischen Widerrist und Hals zuzubeißen, nicht irgendein Hund war, egal wie kurz sein Schwanz war. Also drängte er Cooper wiederholt dazu, ihm Yaguaí zu leihen.
-Ich werde ihn Ihnen gut beibringen, Boss“, sagte er.
-Sie haben Zeit“, antwortete Cooper.
Aber in diesen überwältigenden Tagen – Fragosos Besuch weckt die Erinnerung daran – gab Cooper ihm seinen Hund, damit er ihm das Laufen beibringt.
Er ist zweifellos viel mehr gerannt, als Cooper selbst es sich gewünscht hätte.
Fragoso lebte am linken Ufer des Yabebirí und hatte im Oktober ein Maniokfeld angelegt, das noch nicht gediehen war, sowie einen halben Hektar Mais und Bohnen, der völlig verloren war. Letzteres, das für den Jäger spezifisch war, hatte für Yaguaí wenig Bedeutung, aber die neue Nahrung war für ihn beunruhigend. Er, der in Coopers Haus an dem einfach gekochten Maniok zu schnüffeln pflegte, um seinen Herrn nicht zu beleidigen, und den Locro von drei oder vier Seiten beschnüffelte, um nicht völlig mit dem Koch zu brechen, kannte die Qual der leuchtenden Augen, die auf den essenden Herrn gerichtet waren, um zum Schluss den Teller abzulecken, den seine drei Gefährten bereits poliert hatten, die ängstlich auf die Handvoll parboiled corn warteten, die sie jeden Tag bekamen.
Die drei Hunde gingen nachts allein auf die Jagd – ein Manöver, das Teil des Erziehungssystems des Jägers war – aber der Hunger, der sie natürlich in den Busch trieb, um nach Nahrung zu suchen, setzte den Foxterrier auf der Ranch fest, dem einzigen Ort auf der Welt, an dem er Nahrung finden konnte. Hunde, die kein Wild verschlingen, werden immer schlechte Jäger sein. Und genau die Rasse, zu der Yaguaí gehörte, jagte von Anfang an nur zum Spaß.
Fragoso versuchte sich in der Lehre mit dem Foxterrier. Aber da Yaguaí für die Arbeit seiner drei Hunde eher schädlich als nützlich war, verbannte er ihn auf die Ranch, um auf bessere Zeiten für das Training zu warten.
In der Zwischenzeit neigte sich der Maniok des vergangenen Jahres dem Ende zu, die letzten Ähren rollten auf den Boden, weiß und ohne Korn, und der Hunger, der den drei Hunden, die mit ihm geboren wurden, schon schwer zu schaffen machte, nagte an Yaguaís Eingeweiden. In diesem neuen Leben hatte er sich mit erstaunlicher Schnelligkeit das gedemütigte, unterwürfige und verräterische Aussehen der Hunde des Landes angeeignet. So lernte er, nachts durch die benachbarten Ranches zu streifen, sich vorsichtig zu nähern, die Beine gebeugt und federnd, um beim geringsten feindlichen Murmeln langsam am Fuße eines Espartillobusches zu versinken. Er lernte, nicht zu bellen, egal wie wütend oder ängstlich er war, und besonders dumpf zu knurren, wenn der Cuzco einer Ranch diese vor Plünderung verteidigte. Er lernte, die Hühnerställe zu besuchen, zwei sich überlappende Teller mit seiner Schnauze zu trennen und eine Dose Fett ins Maul zu nehmen, um sie ungestraft in den Heuhaufen zu leeren. Er lernte den Geschmack der Guascas-Ensembles kennen, von mit Fett beschmierten Schuhen, von Ruß, der an einem Topf klebt, und – manchmal – von Honig, der in einem Stück Tacuara gesammelt und aufbewahrt wurde. Er besaß die nötige Umsicht, um aus dem Weg zu gehen, als sich ein Passagier näherte, der ihm mit den Augen folgte und durch das Gras schielte. Und Ende Januar war von dem feurigen Blick, den festen Ohren über den Augen und dem hohen, provozierenden Schwanz des Foxterriers nichts mehr übrig als ein räudiges Skelett mit angelegten Ohren und einem tiefen, verräterischen Schwanz, das heimlich über die Straßen trabte.
Die Dürre hielt an, der Busch wurde allmählich wüst, denn die Tiere konzentrierten sich auf die Wasserfäden, die einst große Bäche gewesen waren. Die drei Hunde erzwangen die Entfernung, die sie von der Wasserstelle der Tiere trennte, mit mäßigem Erfolg, da die Wasserstelle von den Yaguareteí frequentiert wurde und das Kleinwild misstrauisch wurde. Fragoso, der mit dem Ruin des rozado und seinem Unmut über den Besitzer seines Landes beschäftigt war, war nicht in der Stimmung zu jagen, nicht einmal vor Hunger. Und so drohte die Situation sehr kritisch zu werden, als ein zufälliger Umstand dem bedauernswerten Rudel ein wenig Aufmunterung brachte.
Fragoso muss nach San Ignacio gegangen sein, und die vier Hunde, die ihn begleiteten, spürten in ihren geweiteten Nasenlöchern einen Eindruck von pflanzlicher Frische – sehr vage, wenn Sie so wollen -, die aber ein wenig Leben in dieser Hölle von Hitze und Trockenheit zeigte. In der Tat war die Region weniger gegeißelt worden, so dass einige Maisfelder, wenn auch miserabel, noch standen.
Sie aßen an diesem Tag nichts, aber als sie keuchend hinter dem Pferd zurückkamen, vergaßen die Hunde dieses Gefühl der Kühle nicht, und am nächsten Abend brachen sie gemeinsam im stummen Trab nach San Ignacio auf. Am Ufer des Yabebirí blieben sie stehen, schnupperten am Wasser und hoben ihre zitternden Schnauzen zum anderen Ufer. Der Mond ging gerade auf, mit seinem gelblichen, abnehmenden Licht. Die Hunde bewegten sich vorsichtig über den felsigen Fluss, sprangen hier, schwammen dort, in einem Schritt, der in normalem Wasser keine drei Meter tief ist.
Nahezu unerschüttert setzten sie ihren stillen, zähen Trab in Richtung des nächsten Maisfeldes fort. Dort sah der Foxterrier, wie seine Gefährten die Stängel mit ihren Zähnen brachen und die Ähren in trockenen Bissen verschlangen, die bis zum Stängel hinabreichten. Er tat dasselbe, und eine Stunde lang bewegten sich die Hunde in dem schwarzen Gestrüpp der verbrannten Bäume, das durch das grausige Licht der schwindenden Sonne noch gespenstischer wirkte, zwischen dem Schilf hin und her und knurrten sich gegenseitig an.
Sie kamen noch drei weitere Male zurück, bis in der letzten Nacht ein zu nahes Geräusch von Stampfen sie aufhorchen ließ. Aber von diesem Abenteuer, das mit Fragosos Umzug nach San Ignacio zusammenfiel, haben die Hunde nicht viel gespürt.
* * * * *
Fragoso hatte es endlich geschafft, dorthin zu ziehen, tief in die Kolonie. Der mit Tacuapí durchsetzte Busch wies auf einen ausgezeichneten Boden hin, und die riesigen Bambusstränge, die mit der Machete auf den Boden gelegt wurden, müssen prächtige Weiden bereitet haben.
Als Fragoso sich niederließ, begann das Tacuapí auszutrocknen. Er mähte und verbrannte schnell einen viertel Hektar und hoffte auf ein Wunder des Regens. Tatsächlich brach das Wetter zusammen, der weiße Himmel wurde bleiern und in den heißesten Stunden erschienen am Horizont leuchtende Kumuluswolken. Das Thermometer stand bei 39 und der Nordwind blies heftig, brachte schließlich zwölf Millimeter Wasser, die Fragoso sehr glücklich für seinen Mais nutzte. Er sah, wie sie prächtig wuchs, bis zu fünf Zentimeter, aber nicht mehr.
Im Tacuapí, unter ihm und vielleicht an seinen Trieben, leben unendlich viele Nagetiere. Wenn der Tacuapí austrocknet, fliehen seine Wirte, der Hunger treibt sie gewaltsam in die Plantagen. Und so kehrten Fragosos drei Hunde, die eines Nachts hinausgingen, sofort zurück und rieben sich die gebissenen Schnauzen. Fragoso tötete in derselben Nacht vier Ratten, die seine Fetttonne überfielen.
Yaguaí war nicht da. Aber in der folgenden Nacht waren er und seine Begleiter auf dem Weg in den Busch (obwohl der Foxterrier nicht der Fährte nachlief, wusste er sehr wohl, wie man Tatús anlockt und die Nester der Urues findet), als er von dem Umweg überrascht wurde, den seine Begleiter machten, um das Dickicht nicht zu durchqueren. Yaguaí stieß jedoch vor und wurde einen Moment später in das Bein gebissen, während schnelle Schatten um ihn herumliefen.
Yaguaí sah, was es war, und augenblicklich tauchten inmitten der Barbarei des Regenwaldes und des Elends die leuchtenden Augen, der hohe, steife Schwanz und die Kampfhaltung des bewundernswerten englischen Hundes auf. Hunger, Demütigung, erworbene Laster, all das wurde in einer Sekunde von den Ratten, die von überall her kamen, ausgelöscht. Und als er sich schließlich blutüberströmt und todmüde wieder hinlegte, musste er den hungrigen Ratten hinterher springen, die buchstäblich die Ranch überfielen.
Fragoso war wie verzaubert von dieser plötzlichen Energie der Nerven und Muskeln, an die er sich nicht mehr erinnern konnte, und die Erinnerung an den alten Kampf mit der Irara kam ihm wieder. Es war derselbe Biss ins Kreuz: ein scharfer Schlag auf den Kiefer und auf eine andere Ratte.
Er verstand auch, woher die böse Invasion kam, und mit einer langen Reihe von lauten Schwüren gab er sein Maisfeld verloren. Was konnte Yaguaí allein tun? Er ging zum Rozado, streichelte den Foxterrier und pfiff seinen Hunden zu. Aber sobald die Tigerfährtenleser die Zähne der Ratten an ihren Schnauzen spürten, quiekten sie und rieben ihn auf zwei Beinen. Fragoso und Yaguaí kamen allein für die Kosten der Reise auf, und wenn ersterer sein wundes Handgelenk herauszog, atmete letzterer blutige Blasen aus seiner Nase.
Trotz aller Bemühungen von Fragoso und dem Foxterrier, ihn zu retten, war der Wundgescheuerte nach zwölf Tagen verloren. Ratten, wie auch Schwalben, wissen sehr gut, wie sie die noch am Keimling befindlichen Körner ausgraben können. Das Wetter, das wieder einmal brannte, erlaubte nicht einmal den Schatten einer neuen Plantage, und Fragoso war gezwungen, auf der Suche nach Arbeit nach San Ignacio zu gehen und dabei seinen Hund Cooper mitzunehmen, den er nicht mehr viel unterhalten konnte. Er tat dies mit großem Bedauern, denn die letzten Abenteuer, die den Foxterrier in sein eigentliches Jagdtheater führten, hatten die Wertschätzung des Jägers für den kleinen weißen Hund sehr erhöht.
Unterwegs hörte der Fuchs-Terrier in der Ferne das Geräusch der Karren, die das Stroh der Yabebirí in der Dürre verbrannten. Er sah am Rande des Waldes die Kühe, die, die Wolke der Pferdefliegen aushaltend, die Kanus mit der Brust beugten und auf dem gewölbten Stamm bis zu den Blättern vorrückten. Er sah denselben subtropischen Busch, der auf dem Geröll trocknete, und über dem nebligen Horizont der 38-40 Nachmittage sah er wieder die Sonne in einem dumpfen roten Kreis untergehen.
Eine halbe Stunde später erreichten sie San Ignacio, und da es zu spät war, um zu Cooper zu kommen, verschob Fragoso seinen Besuch auf den nächsten Morgen. Die drei Hunde, obwohl ausgehungert, wagten sich nicht weit in das unbekannte Land, mit Ausnahme von Yaguaí, den die scharf geweckte Erinnerung an alte Rennen vor Coopers Pferd in gerader Linie zum Haus seines Herrn führte.
* * * * *
Die anormalen Umstände, weil das Land eine viermonatige Dürre durchmachte – und man muss wissen, was das in Misiones bedeutet -, führten dazu, dass die Hunde der Bauern, die schon in Zeiten des Überflusses ausgehungert waren, ihre nächtlichen Plünderungen auf ein unerträgliches Maß trieben. Am helllichten Tag hatte Cooper drei Hühner verloren, die von den Hunden in den Busch gerissen worden waren. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass der Einfallsreichtum eines faulen Dorfbewohners so weit geht, dass er seinen Welpen dieses Manöver beibringt, um die Beute auszunutzen, dann werden Sie verstehen, warum Cooper die Geduld verlor und unnachgiebig seine Schrotflinte auf jeden nächtlichen Dieb entlud. Obwohl er nichts anderes als Schrot verwendete, war die Lektion auch eine harte.
Eines Abends, als er gerade zu Bett gehen wollte, hörte sein wachsames Ohr das Geräusch feindlicher Nägel, die versuchten, das Drahtgeflecht zu durchbrechen. Mit einer verärgerten Geste entsicherte er seine Schrotflinte und ging nach draußen, um einen weißen Fleck zu sehen, der sich auf den Hof zubewegte. Schnell schoss er, und bei dem durchdringenden Heulen des auf den Hinterbeinen kriechenden Tieres bekam er einen flüchtigen Schreck, den er sich nicht erklären konnte und der sofort verschwand. Er erreichte den Ort, aber der Hund war bereits verschwunden, und er ging wieder hinein.
-Was war es, Papa“, fragte seine Tochter vom Bett aus, „ein Hund?
-Ja“, sagte Cooper und hängte seine Schrotflinte auf, „ich habe ein bisschen knapp geschossen….
-Großer Hund, Papa?
-Nein, Junge.
Ein Moment verging.
-Armer Yaguaí“, fuhr Julia fort, „wie es ihm gehen muss!
Plötzlich erinnerte sich Cooper an den Eindruck, den er gewonnen hatte, als er den Hund heulen hörte: etwas von seinem Yaguaí war da… Aber er dachte auch daran, wie unwahrscheinlich diese Wahrscheinlichkeit war, und schlief ein.
Es war früh am nächsten Morgen, als Cooper der Blutspur folgte und Yaguaí tot am Rande des Bananal-Brunnens fand.
Schlecht gelaunt kehrte er nach Hause zurück, und Julias erste Frage galt dem kleinen Hund.
-Ist er gestorben, Daddy?
-Ja, dort im Brunnen… das ist Yaguaí.
Er nahm die Schaufel und ging, gefolgt von seinen beiden bestürzten Kindern, zum Brunnen. Julia starrte einen Moment lang regungslos vor sich hin, näherte sich langsam und schluchzte an Coopers Hose.
-Was hast du getan, Papa!
-Ich wusste es nicht, kleines Mädchen… Treten Sie einen Moment zurück.
Er vergrub seinen Hund im Kanal, stampfte die Erde darüber und kehrte in tiefer Abscheu zurück, seine beiden Jungen an der Hand haltend, die langsam weinten, damit ihr Vater sie nicht spürte.
(Neuübersetzung 2022: Alle Rechte vorbehalten)