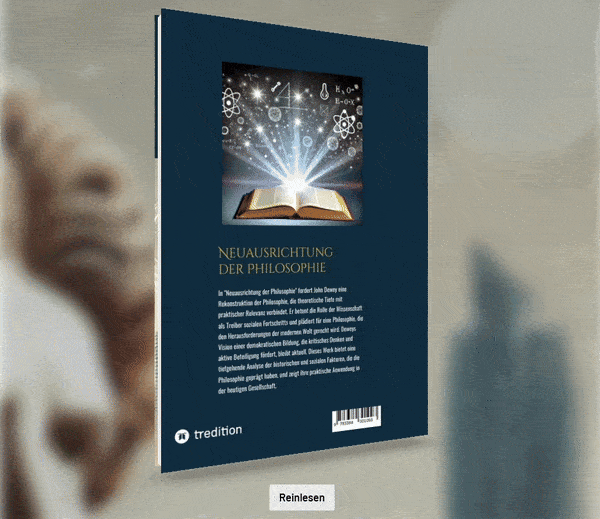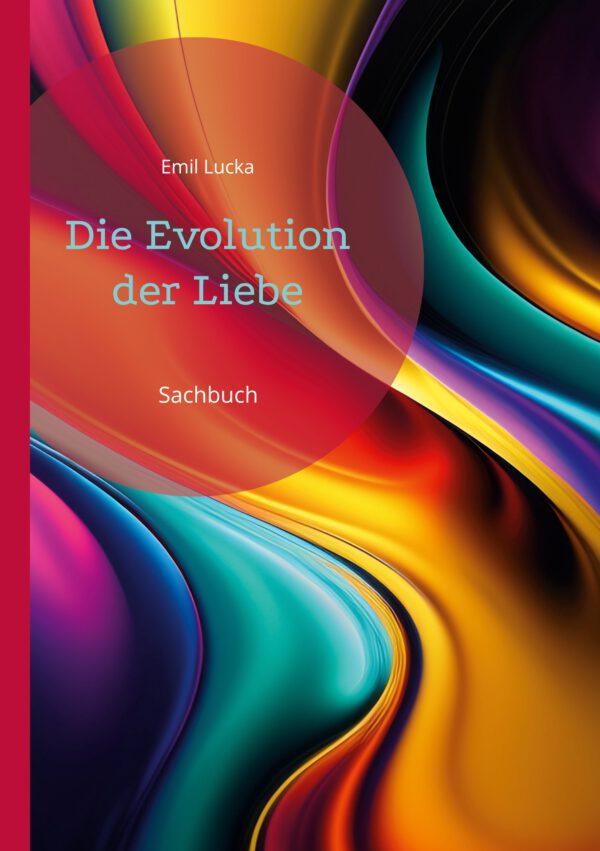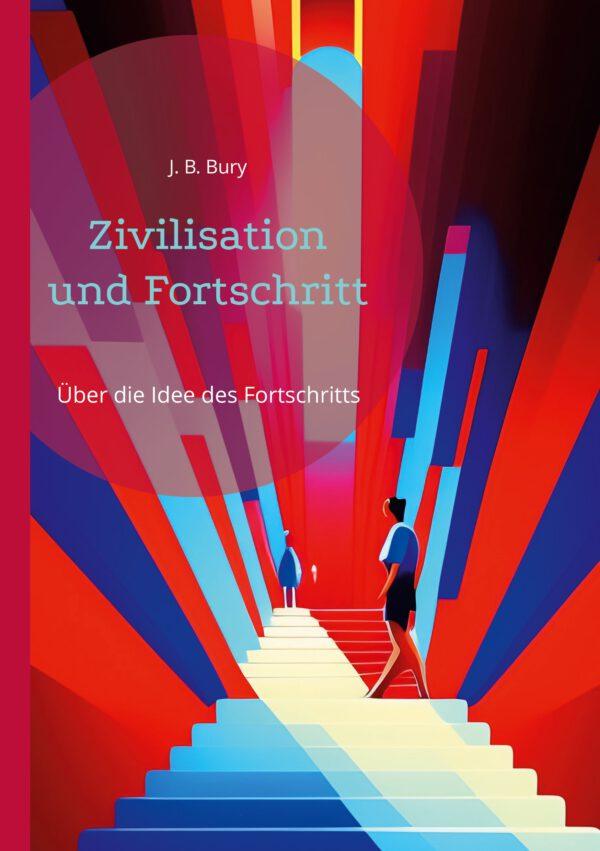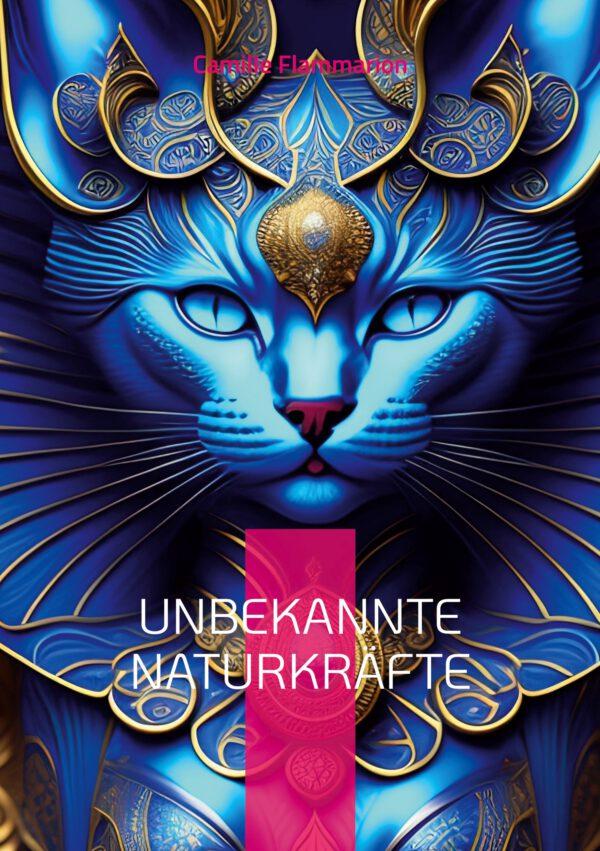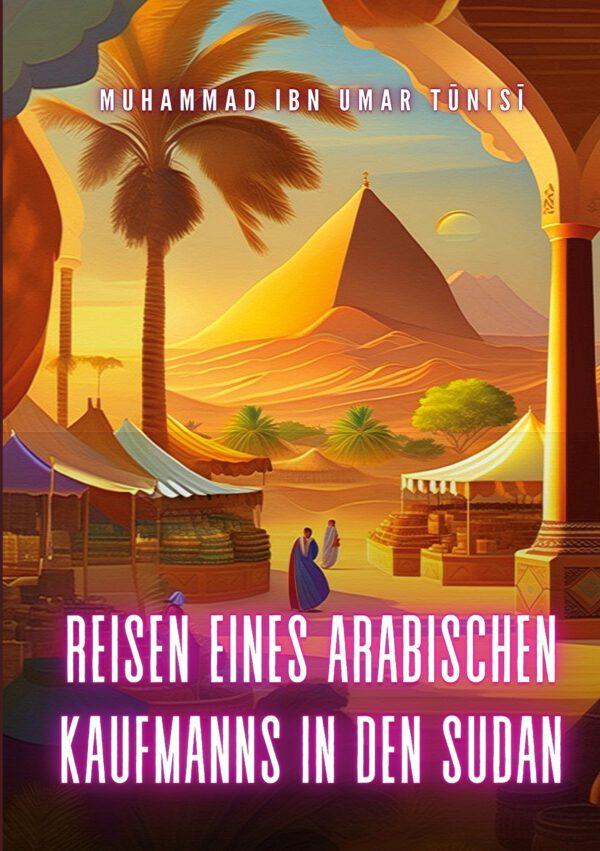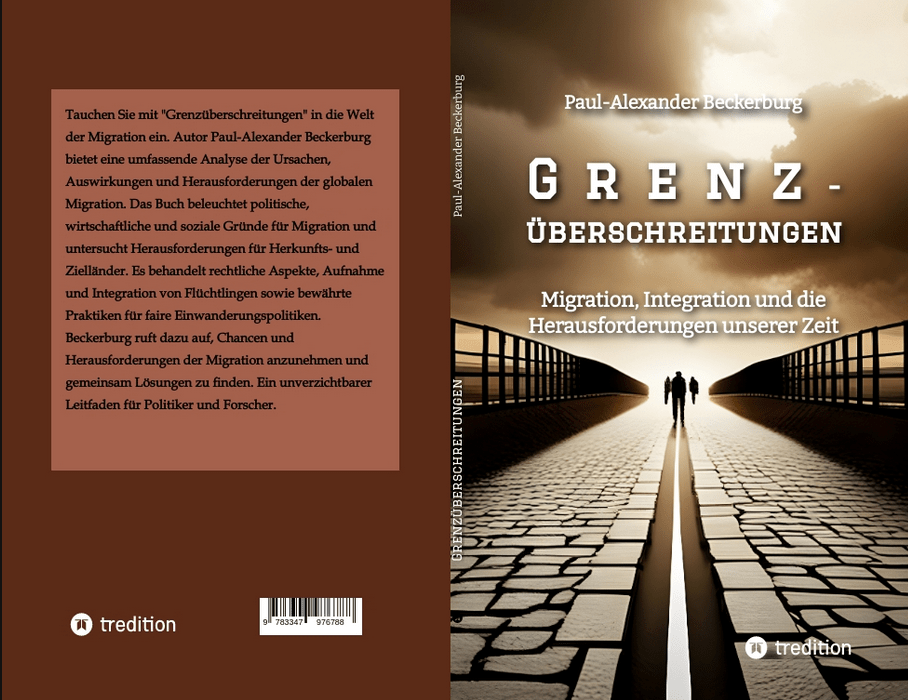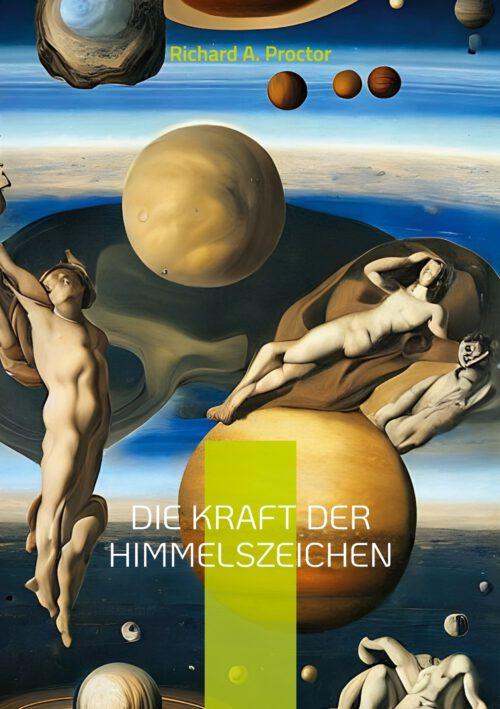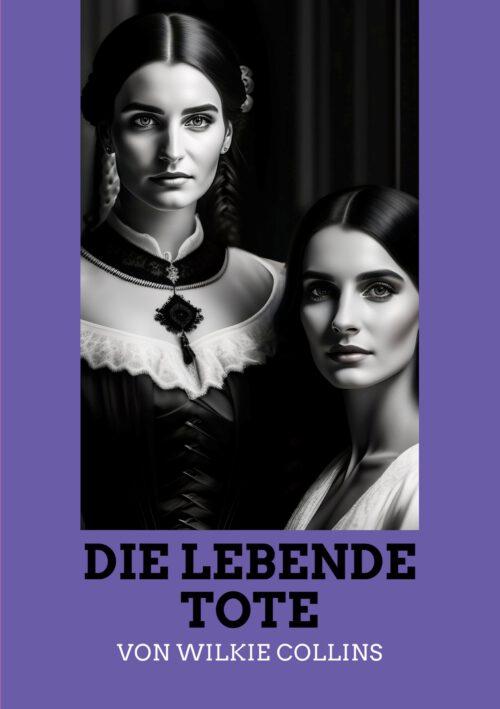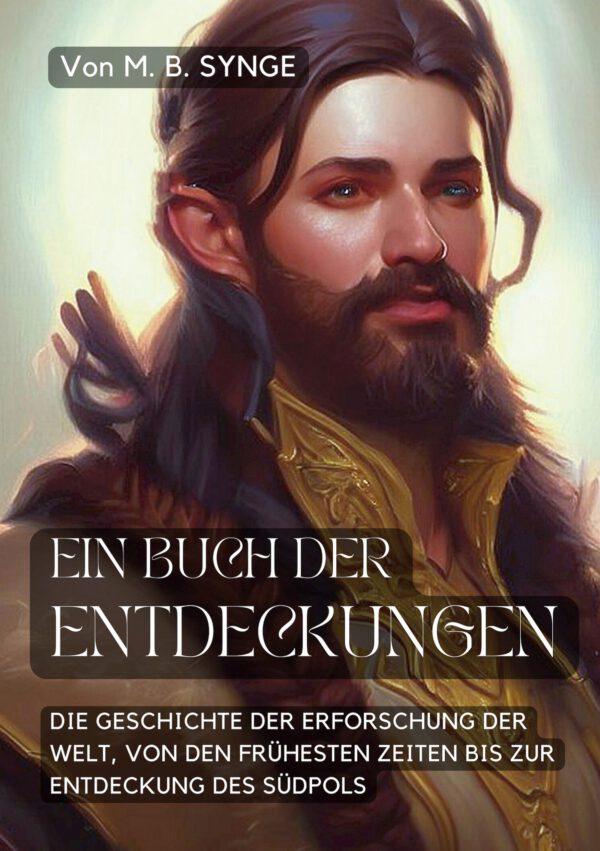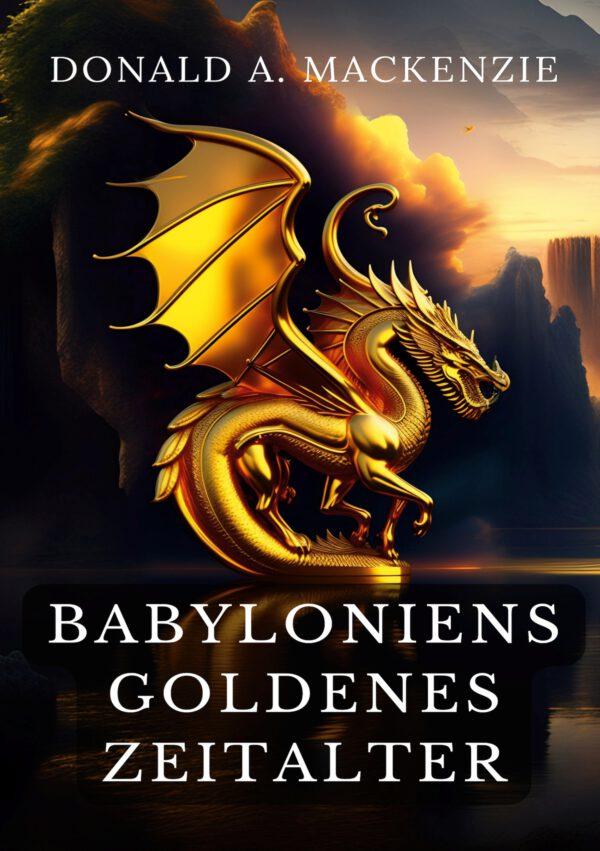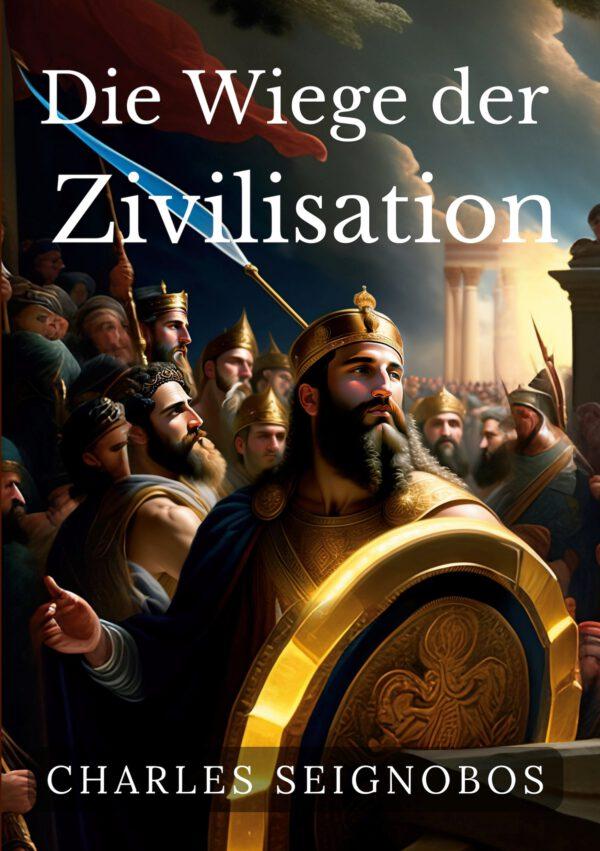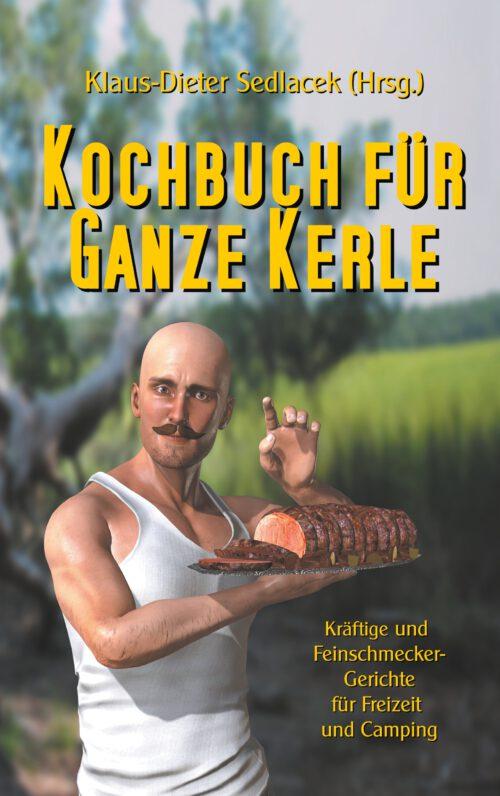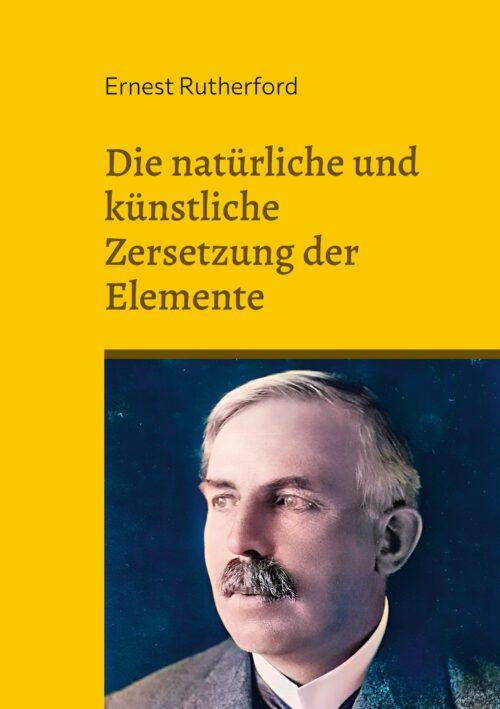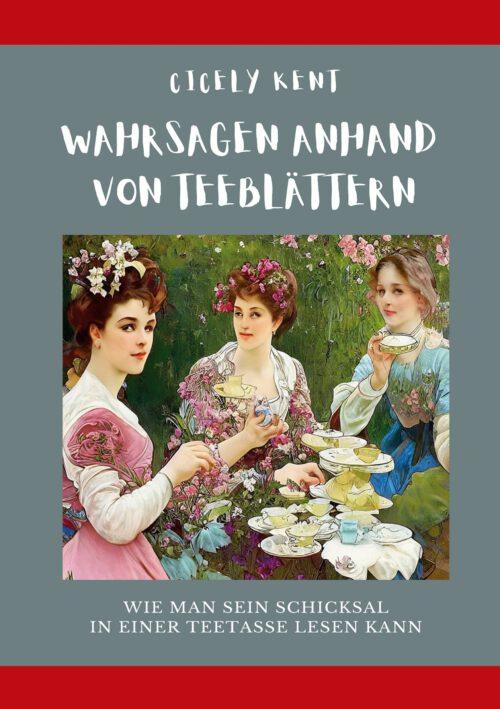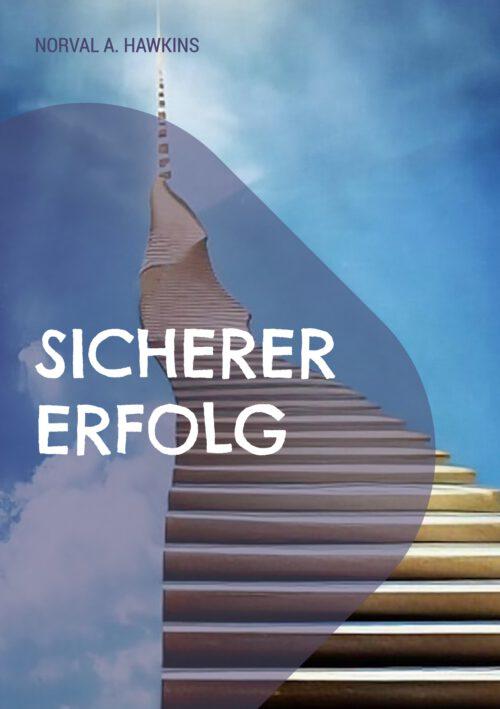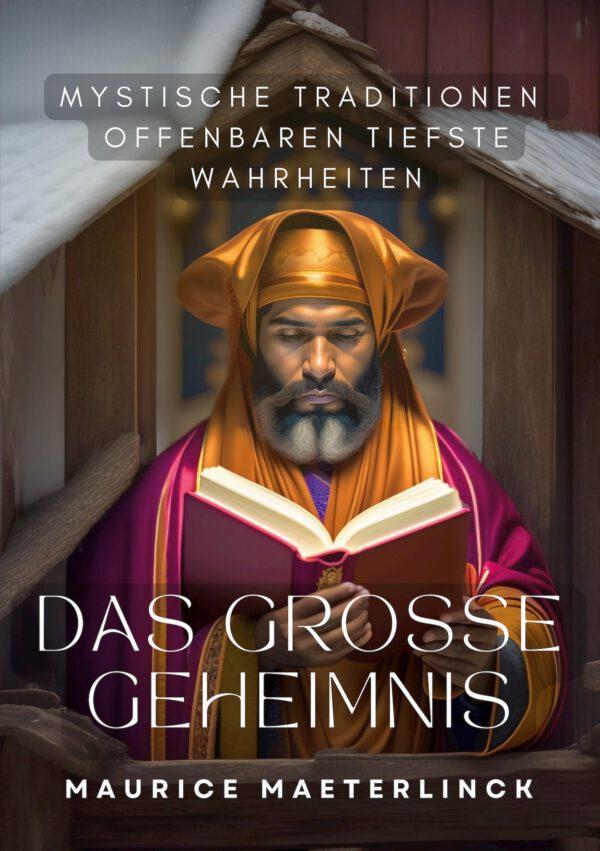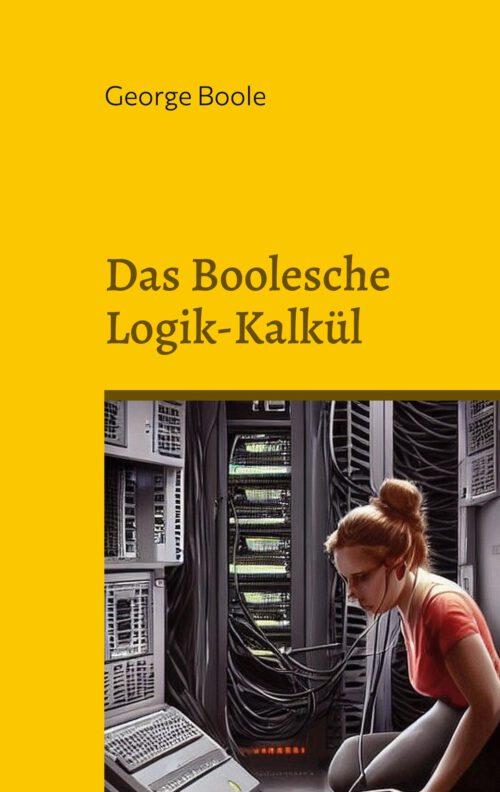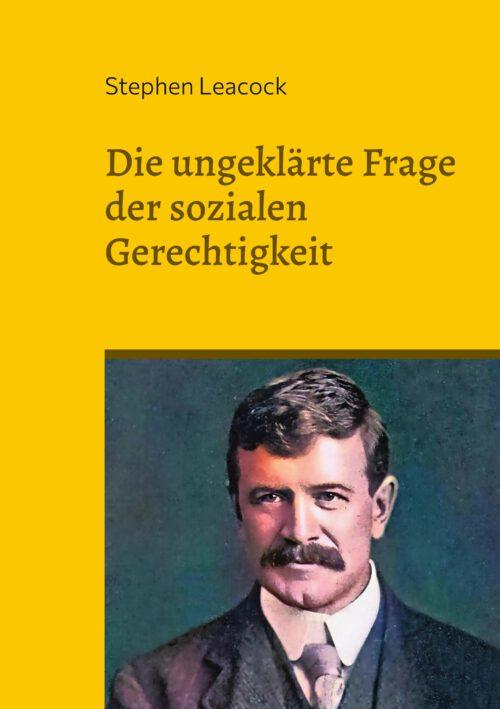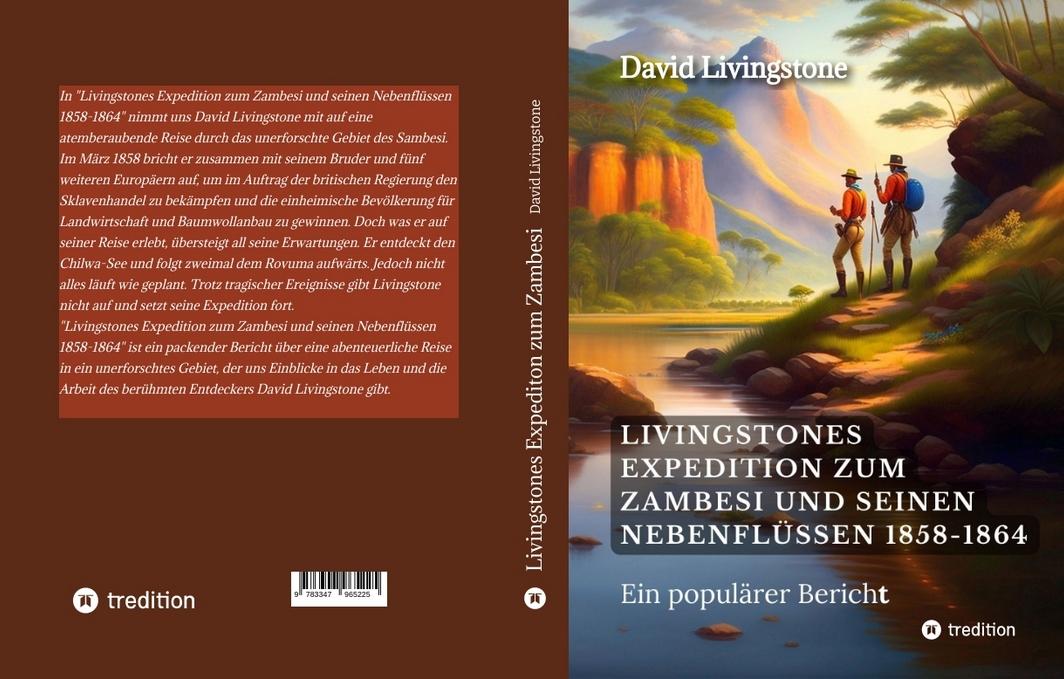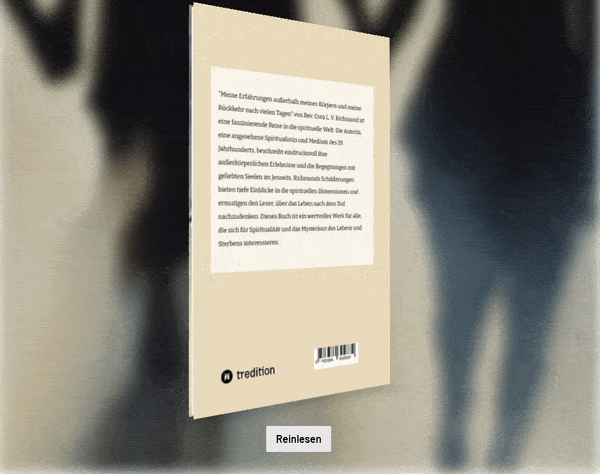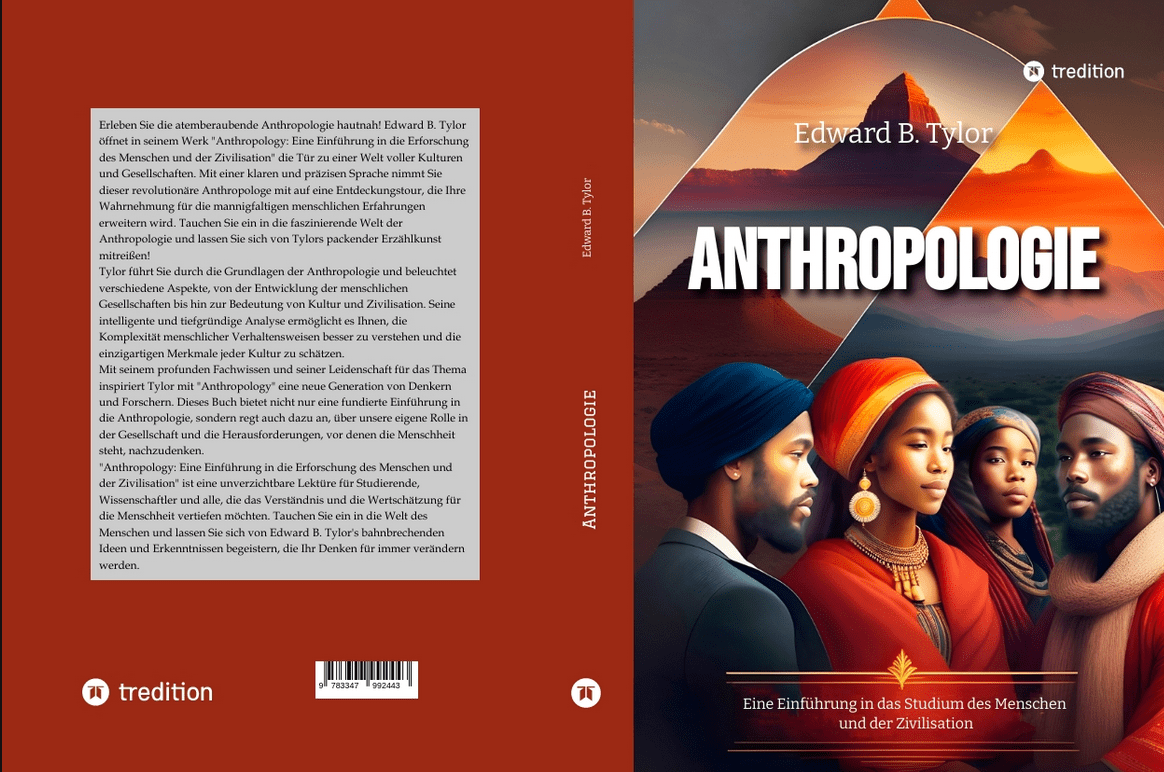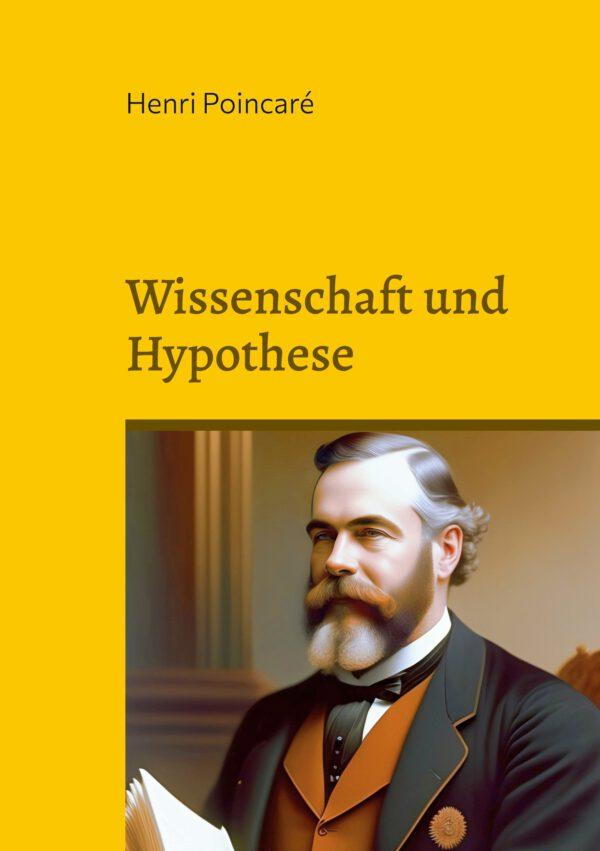DER VERRÜCKTE HUND von
Horacio Quiroga
Am 20. März dieses Jahres verfolgten die Bewohner eines Dorfes in der Chaco-Region Santa Fe einen tollwütigen Mann, der auf der Suche nach seiner Frau einen Landarbeiter erschoss, der vor ihm herlief, während er seine Schrotflinte entlud. Die bewaffneten Nachbarn verfolgten ihn wie ein wildes Tier durch den Busch und fanden ihn schließlich auf einem Baum kletternd, immer noch mit seiner Schrotflinte in der Hand, und auf schreckliche Weise heulend. Sie hielten es für notwendig, ihn zu erschießen.
* * * * *
#März 9-#
Heute vor neununddreißig Tagen betrat der tollwütige Hund Stunde für Stunde nachts unser Zimmer. Wenn ich eine Erinnerung habe, dann die an die zwei Stunden, die auf diesen Moment folgten.
Das Haus hatte keine Türen, außer in dem Zimmer, in dem Mutter wohnte, denn da ich von Anfang an Angst hatte, tat ich in den ersten Tagen der dringenden Installation nichts anderes, als Bretter für die Türen und Fenster ihres Zimmers zu sägen. In unserem Haus und während wir auf weitere Arbeiten warteten, hatte sich meine Frau – zugegebenermaßen auf meinen Druck hin – mit prächtigen hessischen Türen beholfen. Da es Sommer war, hat dieses Detail der strengen Verzierung weder unserer Gesundheit noch unserer Angst geschadet. Durch eine dieser hessischen Türen, die zum zentralen Korridor führte, kam der tollwütige Hund herein und biss mich.
Ich weiß nicht, ob das Heulen eines Epileptikers anderen das Gefühl eines bestialischen und unmenschlichen Geschreis vermittelt, das es mir vermittelt. Aber ich bin mir sicher, dass das Heulen eines tollwütigen Hundes, der nachts hartnäckig um unser Haus kreist, bei allen die gleiche Todesangst hervorruft. Es ist ein kurzer, metallischer, gequälter Schrei, als ob das Tier bereits nach Luft schnappen würde, und das Ganze ist durchdrungen von der Trauer, die ein tollwütiges Tier suggeriert.
Es war ein großer, schwarzer Hund, dem die Ohren abgeschnitten waren. Und zu allem Überfluss hatte es geregnet, seit wir angekommen waren. Die Berge schlossen sich am Wasser, die Nachmittage waren schnell und traurig; wir verließen kaum das Haus, während die Trostlosigkeit der Landschaft in einem unerbittlichen Sturm Mutters Geist bis zum Exzess verdunkelt hatte.
Damit sind die tollwütigen Hunde. Eines Morgens erzählte uns der Landarbeiter, dass eines der Tiere in der Nacht zuvor in seinem Haus gewesen sei und sein eigenes gebissen habe. Zwei Nächte zuvor hatte ein Barcino-Hund im Busch hässlich geheult. Es gab viele von ihnen, sagte er. Meine Frau und ich nahmen die Angelegenheit auf die leichte Schulter, aber nicht meine Mutter, die unser halbfertiges Haus allmählich furchtbar verloren fand. Jeden Moment ging sie auf den Korridor hinaus, um sich die Straße anzusehen.
Als unser Junge an diesem Morgen aus dem Dorf zurückkehrte, bestätigte er dies jedoch. Eine fulminante Tollwut-Epidemie war ausgebrochen. Eine Stunde zuvor war gerade ein Hund ins Dorf gejagt worden. Ein Landarbeiter hatte Zeit gehabt, ihm mit einer Machete ins Ohr zu stechen, und das Tier, sabbernd, mit der Schnauze auf dem Boden und dem Schwanz zwischen den Vorderbeinen, hatte unseren Weg gekreuzt und ein Fohlen und ein Schwein gebissen, das es auf dem Weg fand.
Noch mehr Neuigkeiten. Auf der Farm neben unserer hatte in den frühen Morgenstunden desselben Tages ein anderer Hund vergeblich versucht, über den Kuhstall zu springen. Ein riesiger, dünner Hund hatte einen Jungen auf einem Pferd die Picada des alten Hafens hinuntergejagt. Noch am Abend war das gequälte Heulen des Hundes im Busch zu hören. Schließlich, um neun Uhr, kamen zwei Offiziere herangaloppiert, um uns die Zugehörigkeit der tollwütigen Hunde mitzuteilen, die wir gesehen hatten, und um uns zu raten, sehr vorsichtig zu sein.
Es war genug für Mutter, um den Rest an Lebensfreude zu verlieren, den sie noch hatte. Obwohl sie ein heiteres Gemüt hat, fürchtet sie sich vor tollwütigen Hunden, weil sie in ihrer Kindheit etwas Schreckliches erlebt hat. Seine Nerven, die bereits durch den ständig bedeckten und regnerischen Himmel angegriffen waren, bescherten ihm regelrechte Halluzinationen von Hunden, die durch das Tor trabten.
Für diese Angst gab es einen echten Grund. Hier, wie auch anderswo, wo die armen Leute viel mehr Hunde haben, als sie halten können, werden die Häuser jede Nacht von hungrigen Hunden durchstreift, denen die Gefahren des Handels – ein Schuss oder ein böser Stein – die wahre Art von wilden Bestien gegeben haben. Sie bewegen sich langsam und geduckt vorwärts, ihre Muskeln sind erschlafft. Ihr Marsch ist nie zu spüren. Sie stehlen – wenn das Wort hier eine Bedeutung hat – so viel, wie ihr grausamer Hunger verlangt. Beim leisesten Murmeln – fliehen sie nicht, denn das würde Lärm machen, sondern gehen mit angewinkelten Beinen davon. Wenn sie das Gras erreichen, hocken sie sich hin und warten ruhig eine halbe oder eine Stunde, um dann wieder weiterzuziehen.
Deshalb war Mutter auch so besorgt, denn da unser Haus eines der vielen durchstreiften war, drohte uns natürlich der Besuch der tollwütigen Hunde, die sich an die nächtliche Reise erinnern würden.
Tatsächlich hörte ich an jenem Abend, als Mutter, etwas vergesslich, langsam auf den Pförtner zuging, ihren Schrei:
– „Federico, ein tollwütiger Hund!
Ein Barcino-Hund trabte mit gewölbtem Rücken in einer blinden, geraden Linie vorwärts. Als er mich kommen sah, blieb er stehen und sein Rücken sträubte sich. Ich trat zurück, ohne mich umzudrehen, um die Schrotflinte zu entsichern, aber das Tier war weg. Ich lief sinnlos die Straße entlang, ohne sie wiederzufinden.
Zwei Tage vergingen. Die Landschaft war noch immer von Regen und Traurigkeit gezeichnet, während die Zahl der tollwütigen Hunde zunahm. Da die Kinder nicht auf den verseuchten Straßen stolpern durften, wurde die Schule geschlossen, und die Straße, die nun nicht mehr befahren wurde, wurde um sieben und um zwölf Uhr von dem Schullärm befreit, der ihre Notlage belebte.
Mutter wagte keinen Schritt aus dem Innenhof. Beim leisesten Bellen blickte sie erschrocken zum Torwächter, und sobald es dunkel wurde, sah sie glühende Augen durch das Gras spähen. Nach dem Abendessen schloss sie sich in ihrem Zimmer ein und lauschte auf jedes noch so hypothetische Heulen.
Erst in der dritten Nacht wachte ich auf, schon sehr spät: Ich hatte den Eindruck, einen Schrei gehört zu haben, aber ich konnte das Gefühl nicht genau einordnen. Ich habe eine Weile gewartet. Und plötzlich erschütterte ein kurzes, metallisches Heulen grausamen Leids den Korridor.
-Federico“, hörte ich die bewegte Stimme meiner Mutter, „hast du es gespürt?
-Ja“, antwortete ich und glitt aus dem Bett. Aber sie hat das Geräusch gehört.
-Um Gottes willen, das ist ein tollwütiger Hund! Federico, geh nicht hinaus, um Gottes willen! Joan! Sag deinem Mann, er soll nicht hinausgehen! rief sie verzweifelt und wandte sich an meine Frau.
Ein weiteres Heulen ertönte, dieses Mal im zentralen Korridor, vor der Tür. Ein feiner Schauer lief mir über den Rücken bis zur Taille. Ich glaube nicht, dass es etwas zutiefst Traurigeres gibt als das Heulen eines tollwütigen Hundes zu dieser Stunde. Die verzweifelte Stimme der Mutter meldete sich dahinter.
-Er kommt in Ihr Zimmer! Gehen Sie nicht raus, mein Gott, gehen Sie nicht raus! Juana! Sagen Sie es Ihrem Mann!
-Federico“, klammerte sich meine Frau an meinen Arm.
Aber die Situation könnte sehr kritisch werden, wenn ich darauf warte, dass das Tier hereinkommt, und ich zünde die Lampe an und löse die Flinte. Ich hob das Sackleinen seitlich von der Tür und sah nichts als das schwarze Dreieck der tiefen Dunkelheit draußen. Ich hatte kaum Zeit, einen Blick hinauszuwerfen, als ich etwas Festes und Warmes an meinem Oberschenkel spürte; der tollwütige Hund betrat unser Zimmer. Ich warf meinen Kopf mit einem Schlag meines Knies heftig zurück, und plötzlich stürzte er sich mit einem Biss auf mich, der mich mit einem deutlichen Schlag seiner Zähne verfehlte. Doch einen Augenblick später spürte ich einen scharfen Schmerz.
Weder meine Frau noch meine Mutter bemerkten, dass ich gebissen worden war.
-Federico! Was war das?“, rief meine Mutter, die meine Verhaftung und den Biss in der Luft gehört hatte.
-Nichts: Ich wollte reinkommen.
-Oh!
Wieder, und dieses Mal hinter Mutters Zimmer, ertönte das verhängnisvolle Heulen.
-Federico! Es ist verrückt! Es ist verrückt! Gehen Sie nicht raus!“, rief sie wütend und spürte das Tier einen Meter von ihr entfernt.
Es gibt absurde Dinge, die den Anschein einer legitimen Überlegung erwecken: Ich ging nach draußen mit der Lampe in der einen und der Schrotflinte in der anderen Hand, genau so, als ob ich nach einer verängstigten Ratte Ausschau halten wollte, was mir den perfekten Raum geben würde, um die Lampe auf den Boden zu legen und sie mit dem Ende einer Mistgabel zu töten.
Ich ging die Korridore entlang. Es war kein Gemurmel zu hören, aber aus den Zimmern verfolgte mich die ungeheure Angst von Mutter und Frau, die auf den Knall warteten.
Der Hund war weg.
-Federico“, rief meine Mutter, als sie spürte, dass ich endlich zurückkam, „ist der Hund weg?
-Ich glaube schon; ich sehe ihn nicht. Ich dachte, ich hätte einen Trab gehört, als ich hinausging.
-Ja, ich habe es auch gespürt… Frederick, er ist nicht in Ihrem Zimmer… Es gibt keine Tür, mein Gott, bleiben Sie drinnen, er könnte zurückkommen!
In der Tat, er könnte zurückkommen. Es war zwanzig nach zwei Uhr morgens. Und ich schwöre, dass meine Frau und ich die zwei Stunden, die wir bei eingeschaltetem Licht bis zum Morgengrauen verbrachten, sie im Bett liegend, ich auf dem Bett sitzend, unaufhörlich das schwebende Sackleinen beobachteten.
Zuvor war ich geheilt worden. Der Biss war klar, zwei violette Löcher, die ich mit aller Kraft auspresste und mit Permanganat auswusch.
Ich glaubte sehr restriktiv an die Tollwut des Tieres. Seit dem Vortag hatte man damit begonnen, Hunde zu vergiften, und irgendetwas in unserer überforderten Haltung warnte mich vor Strychnin. Es blieben das Trauergeheul und der Biss; aber ich neigte auf jeden Fall zu Ersterem. Daher wohl auch meine relative Nachlässigkeit im Umgang mit der Wunde.
Endlich war der Tag gekommen. Um acht Uhr und vier Häuserblocks von zu Hause entfernt, erschoss ein Passant mit einem Revolver den schwarzen Hund, der in einem unverkennbaren Zustand der Wut dahin trottete. Wir wussten es sofort, und ich musste einen regelrechten Kampf mit meiner Mutter und meiner Frau führen, um nicht nach Buenos Aires zu fahren, um die Injektionen zu bekommen. Die Wunde war, ehrlich gesagt, gut gepresst und mit einer Beize aus Permanganat gewaschen worden. Und das alles innerhalb von fünf Minuten nach dem Biss. Was um alles in der Welt hätte ich nach dieser hygienischen Korrektur befürchten sollen? Zu Hause beruhigten sie sich, und da die Epidemie – wahrscheinlich ausgelöst durch eine Krise mit unablässigem Regen, wie wir sie hier noch nie gesehen haben – fast plötzlich aufgehört hatte, nahm das Leben wieder seinen normalen Lauf.
Aber das bedeutete nicht, dass meine Mutter und meine Frau damit aufhörten und weiterhin genau Buch führen über die Zeit. Die klassischen vierzig Tage wiegen schwer, vor allem für die Mutter, und selbst heute, nachdem neununddreißig Tage ohne die geringste Störung vergangen sind, wartet sie immer noch auf den morgigen Tag, um mit einem großen Seufzer den immerwährenden Schrecken jener Nacht aus ihrem Gedächtnis zu vertreiben.
Das einzige Ärgernis, das ich dabei empfinde, ist vielleicht, dass ich mich Punkt für Punkt an das erinnern muss, was passiert ist. Ich vertraue darauf, dass morgen Abend mit der Quarantäne diese Geschichte endet, die die Augen meiner Frau und meiner Mutter auf mich gerichtet hält, als ob sie nach dem ersten Anzeichen von Krankheit in meinem Gesichtsausdruck Ausschau halten würden.
* * * * *
#März 10-# * * * * * * * *
Na endlich! Ich hoffe, dass ich von nun an wie jeder andere Mensch leben kann, der keine Todeskronen über seinem Kopf hängen hat. Die berühmten vierzig Tage sind vorbei, und auch die Angst, der Verfolgungswahn und die schrecklichen Schreie, die von mir erwartet wurden, sind für immer vorbei.
Meine Frau und meine Mutter haben das freudige Ereignis auf eine besondere Art und Weise gefeiert: Sie haben mir Punkt für Punkt all die Schrecken erzählt, die sie erlitten haben, ohne dass ich sie sehen konnte. Die kleinste Unachtsamkeit meinerseits stürzte sie in Todesangst: „Es ist die Wut, die beginnt“, stöhnten sie. Wenn ich morgens spät aufstand, lebten sie stundenlang nicht und warteten auf ein anderes Symptom. Die quälende Infektion eines Fingers, die mich drei Tage lang fiebrig und ungeduldig machte, war für sie ein absoluter Beweis für die beginnende Wut, daher ihre Bestürzung, die umso beunruhigender war, als sie sich versteckt hatte.
Und so verursachte der kleinste Stimmungsumschwung, die kleinste Niedergeschlagenheit, vierzig Tage lang ebenso viele Stunden der Unruhe.
Trotz dieser rückblickenden Geständnisse, die für jemanden, der betrogen gelebt hat, immer unangenehm sind, lachte ich immer noch gutmütig: „Oh, mein Sohn, du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich es für eine Mutter ist, zu denken, dass ihr Kind in Wut geraten könnte! Alles andere – aber verrückt, verrückt, verrückt!
Meine Frau, die zwar vernünftiger ist, hat auch viel mehr geschwafelt, als sie zugibt. Aber das ist jetzt zum Glück vorbei! Diese Situation des Märtyrers, des Babys, das Sekunde für Sekunde von einer so verrückten Todesdrohung beobachtet wird, ist trotz allem nicht verführerisch. Endlich wieder! Wir werden in Frieden leben, und ich hoffe, dass ich morgen oder übermorgen nicht mit Kopfschmerzen aufwache, um den Wahnsinn wieder aufleben zu lassen.
* * * * *
#15. März…
Ich wäre gerne absolut ruhig geblieben, aber das ist unmöglich. Ich denke, es gibt keine Chance mehr, dass dies ein Ende hat. Seitenblicke den ganzen Tag lang, unaufhörliches Flüstern, das plötzlich aufhört, sobald sie meine Schritte hören, ein scharfes Abhören meines Gesichtsausdrucks, wenn wir am Tisch sitzen, all das wird unerträglich. -Aber Federico“, antworteten sie und sahen mich überrascht an, „wir haben Ihnen nichts gesagt, wir haben uns nicht einmal daran erinnert!
Und doch tun sie nichts anderes, als mich Tag und Nacht auszuspionieren, um zu sehen, ob mich die Tollwut ihres dummen Hundes infiltriert hat!
* * * * *
#März 18-#
Ich lebe jetzt seit drei Tagen so, wie ich es sollte, und ich wünschte, ich könnte das für den Rest meines Lebens.
Endlich werde ich allein gelassen, endlich, endlich, endlich, endlich!
* * * * *
#März 19-#
Schon wieder! Schon wieder haben sie angefangen! Sie lassen mich nicht aus den Augen, als ob sie sich wünschen würden, dass ich wütend bin. Wie kann so eine Dummheit bei zwei vernünftigen Menschen möglich sein! Jetzt verstellen sie sich nicht mehr und reden unüberlegt und laut über mich, aber ich weiß nicht warum, ich kann kein Wort verstehen. Sobald ich sie erreiche, verstummen sie auf einmal, und kaum bin ich einen Schritt von ihnen entfernt, beginnt das schwindelerregende Geschnatter wieder. Ich konnte mich nicht zurückhalten und drehte mich wütend um: „Aber sprechen Sie, sprechen Sie nach vorne, das ist weniger feige!
Ich wollte nicht hören, was sie sagten und ging weg. Das ist nicht mehr das Leben, das ich führe!
* * * * *
#8 p.m.#
Sie wollen weg! Sie wollen, dass wir weggehen! Ah, ich weiß, warum sie mich verlassen wollen!…
* * * * *
* 20. März (6 Uhr) *
Heulen, heulen! Die ganze Nacht lang habe ich nichts als Heulen gehört! Die ganze Nacht lang bin ich jeden Moment aufgewacht! Hunde, nichts als Hunde im Haus letzte Nacht! Und meine Frau und meine Mutter haben den perfektesten Schlaf vorgetäuscht, so dass ich nur durch meine Augen das Heulen all der Hunde aufnahm, die mich ansahen!…
* * * * *
#7 a.m.
Es gibt nichts als Vipern! Mein Haus ist voller Vipern! Als ich mich gewaschen habe, waren drei davon im Waschbecken! Im Futter des Sacks waren viele! Und es gibt noch mehr! Meine Frau hat mein Haus mit Vipern gefüllt! Sie hat riesige haarige Spinnen mitgebracht, die mich jagen! Jetzt verstehe ich, warum sie mich Tag und Nacht ausspioniert hat! Jetzt verstehe ich alles! Sie wollte deswegen gehen!
* * * * *
#7.15 Uhr.
Der Hof ist voller Vipern! Ich kann keinen Schritt machen! Nein, nein!…
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
* * * * *
Meine Frau läuft weg! Meine Mutter läuft weg! Ich wurde ermordet! Ah, die Schrotflinte! Verdammt! Sie ist mit Munition geladen! Aber das spielt keine Rolle…
* * * * *
Was für ein Schrei! Ich habe ihn verpasst… Wieder die Vipern! Da, da ist eine große!… Oh! Hilfe, Hilfe!!!
* * * * *
Sie alle wollen mich töten! Sie haben sie gegen mich ausgesandt, alle! Der Berg ist voller Spinnen! Sie sind mir von zu Hause gefolgt!…
Hier kommt ein weiterer Mörder… Er hat sie in der Hand! Er wirft Schlangen auf den Boden! Er nimmt Schlangen aus seinem Mund und wirft sie auf den Boden gegen mich! Ah, aber er wird nicht lange leben… Ich habe ihn getroffen! Er ist mit all den Schlangen gestorben!… Die Spinnen! Oh! Hilfe!!!
* * * * *
Sie kommen, sie kommen alle! Sie suchen mich, sie suchen mich! Sie haben eine Million Vipern auf mich geworfen! Sie haben sie alle auf den Boden gelegt! Und ich habe keine Patronen mehr! Sie haben mich gesehen! Einer von ihnen zielt auf mich…
*AWAY *
Der Mann trat auf etwas Weiches und spürte sofort den Biss an seinem Fuß. Er sprang vorwärts, und als er sich mit einem Schwur umdrehte, sah er einen Yararacusú, der auf sich selbst zusammengerollt war und auf einen weiteren Angriff wartete.
Der Mann warf einen kurzen Blick auf seinen Fuß, wo sich zwei Blutstropfen unangenehm verdickten, und zog seine Machete aus der Hüfte. Die Viper erkannte die Bedrohung und stieß ihren Kopf noch tiefer in das Zentrum ihrer Spirale, aber die Machete fiel flach und verrenkte ihr die Wirbel.
Der Mann ließ sich auf den Biss nieder, wischte die Blutstropfen weg und dachte einen Moment lang nach. Ein scharfer Schmerz ging von den beiden violetten Punkten aus und begann, den ganzen Fuß zu befallen. Hastig verband er sich den Knöchel mit seinem Taschentuch und ging weiter über die Picada in Richtung seiner Ranch.
Der Schmerz im Fuß nahm zu, mit dem Gefühl einer festen Beule, und plötzlich spürte der Mann zwei oder drei blitzende Stiche, die wie ein Blitz von der Wunde in die Mitte seiner Wade ausstrahlten. Er konnte sein Bein nur schwer bewegen. Eine metallische Trockenheit in der Kehle, gefolgt von brennendem Durst, entlockte ihm einen neuen Schwur.
Endlich erreichte er die Ranch und legte sich auf die Arme auf dem Rad einer Trapiche. Die beiden violetten Punkte verschwanden nun in der monströsen Schwellung des gesamten Fußes. Die Haut sah dünn aus und drohte nachzugeben, so straff war sie. Er wollte seine Frau anrufen und seine Stimme brach in einem heiseren Schleifen der ausgetrockneten Kehle. Der Durst verschlang ihn.
-Dorotea“, brachte er röchelnd hervor, „Gib mir einen Stock!
Seine Frau kam mit einem vollen Glas angerannt, das der Mann in drei Schlucken trank. Aber er hatte keine Lust dazu.
-Ich habe Sie um einen Stock gebeten, nicht um Wasser“, brüllte sie erneut, „Geben Sie mir einen Stock!
-Aber es ist Rohrstock, Paulino“, protestierte die Frau entsetzt.
-Nein, Sie haben mir Wasser gegeben! Ich will Stock, sage ich Ihnen!
Die Frau lief wieder weg und kam mit dem Krug zurück. Der Mann schluckte zwei Gläser hintereinander, spürte aber nichts in seiner Kehle.
-Nun, das wird hässlich“, murmelte er dann und betrachtete seinen fahlen Fuß, der bereits einen gangränösen Schimmer hatte. An der tiefen Ligatur des Taschentuchs quoll das Fleisch über wie eine monströse Blutwurst.
Die blitzenden Schmerzen folgten nacheinander in kontinuierlichen Blitzen und erreichten nun die Leiste. Gleichzeitig nahm die quälende Trockenheit des Halses zu, die durch den Atem noch heißer zu werden schien. Als er versuchte, sich aufzusetzen, hielt ihn ein heftiger Brechreiz eine halbe Minute lang mit der Stirn auf dem Holzrad fest.
Aber der Mann wollte nicht sterben, also ging er an Land und kletterte in sein Kanu. Er saß im Heck und begann, zur Mitte des Parana zu paddeln. Dort würde ihn die Strömung des Flusses, der in der Nähe des Iguazú sechs Meilen lang ist, innerhalb von fünf Stunden nach Tacurú-Pucú tragen.
Mit grimmiger Energie gelang es dem Mann tatsächlich, die Mitte des Flusses zu erreichen. Doch dort ließen seine schläfrigen Hände das Paddel in das Kanu fallen, und nach einem erneuten Erbrechen – dieses Mal von Blut – blickte er zur Sonne, die bereits über dem Berg stand.
Das ganze Bein, bis zur Mitte des Oberschenkels, war bereits ein deformierter, harter Klotz, der durch seine Kleidung hindurch platzte. Der Mann schnitt die Ligatur durch und öffnete die Hose mit seinem Messer: der Unterbauch quoll über, geschwollen, fahl und furchtbar wund. Der Mann glaubte, dass er es allein niemals bis nach Tacurú-Pucú schaffen würde, und beschloss, seinen Compadre Alves um Hilfe zu bitten, obwohl sie schon lange zerstritten waren.
Die Strömung des Flusses strömte nun auf die brasilianische Küste zu, und der Mann konnte problemlos andocken. Er kroch den kabbeligen Berg hinauf, aber nach zwanzig Metern lag er erschöpft auf der Brust.
-Alves!“, rief er so laut er konnte und lauschte vergeblich.
-Vater Alves, verweigern Sie mir diese Gunst nicht“, rief er erneut und hob den Kopf vom Boden, „in der Stille des Waldes war kein Laut zu hören. Der Mann hatte noch den Mut, sein Kanu zu erreichen, und die Strömung erfasste es wieder und trieb es schnell ab.
Der Parana fließt dort auf dem Grund einer riesigen Grube, deren hundert Meter hohe Wände den Fluss förmlich umschließen. Von den mit schwarzen Basaltblöcken gesäumten Ufern erhebt sich der Wald, ebenfalls schwarz. Vor uns, zu den Seiten, hinter uns, die ewige düstere Wand, an deren Fuß der wirbelnde Fluss in unaufhörlichen Schwällen schlammigen Wassers rauscht. Die Landschaft ist aggressiv, und es herrscht eine tödliche Stille. Bei Sonnenuntergang jedoch erstrahlt seine düstere und ruhige Schönheit in einer einzigartigen Majestät.
Die Sonne war bereits untergegangen, als der Mann, der halb auf dem Boden des Kanus lag, einen heftigen Schauer bekam. Und plötzlich, mit Erstaunen, richtete er seinen Kopf schwer auf: er fühlte sich besser. Sein Bein schmerzte kaum noch, sein Durst ließ nach und seine Brust, die nun frei war, öffnete sich in einem langsamen Einatmen.
Das Gift begann zu wirken, daran gab es keinen Zweifel. Er war fast gesund, und obwohl er nicht die Kraft hatte, seine Hand zu bewegen, rechnete er damit, dass der fallende Tau ihn gesund machen würde. Er rechnete damit, dass er innerhalb von drei Stunden in Tacuru-Pucu sein würde.
Das Wohlbefinden stieg, und mit ihm eine Müdigkeit voller Erinnerungen. Er spürte nichts mehr in seinem Bein oder in seinem Bauch. Würde sein Compadre Gaona noch in Tacurú-Pucú leben? Vielleicht würde er auch seinen ehemaligen Arbeitgeber, Mr. Dougald, und den Empfänger der Obraje sehen.
Würde er bald eintreffen? Der Himmel im Westen öffnete sich jetzt zu einer goldenen Leinwand, und auch der Fluss hatte sich gefärbt. Von der paraguayischen Küste aus, die sich bereits verdunkelt hatte, warf der Berg seine dämmrige Frische in Form von Orangenblüten und wildem Honig auf den Fluss. Ein Arapaar kreuzt sehr hoch und lautlos in Richtung Paraguay.
Dort unten, auf dem Fluss des Goldes, trieb das Kanu schnell dahin und drehte sich manchmal in einem Strudel um sich selbst. Dem Mann im Kanu ging es immer besser, und er dachte darüber nach, wie lange es her war, dass er seinen ehemaligen Arbeitgeber Dougald gesehen hatte. Drei Jahre? Vielleicht nicht, nicht so lange. Zwei Jahre und neun Monate? Vielleicht. Achteinhalb Monate? So viel ist sicher.
Plötzlich hatte er das Gefühl, an seiner Brust zu erstarren. Was könnte das sein? Und sein Atem auch…
Er hatte Lorenzo Cubilla, den Holzhändler von Mr. Dougald, an einem Karfreitag in Puerto Deseado getroffen… Freitag? Ja, oder Donnerstag…
Der Mann streckte langsam die Finger seiner Hand aus.
-Ein Donnerstag…
Und er hörte auf zu atmen.
(Neuübersetzung 2022: Alle Rechte vorbehalten)