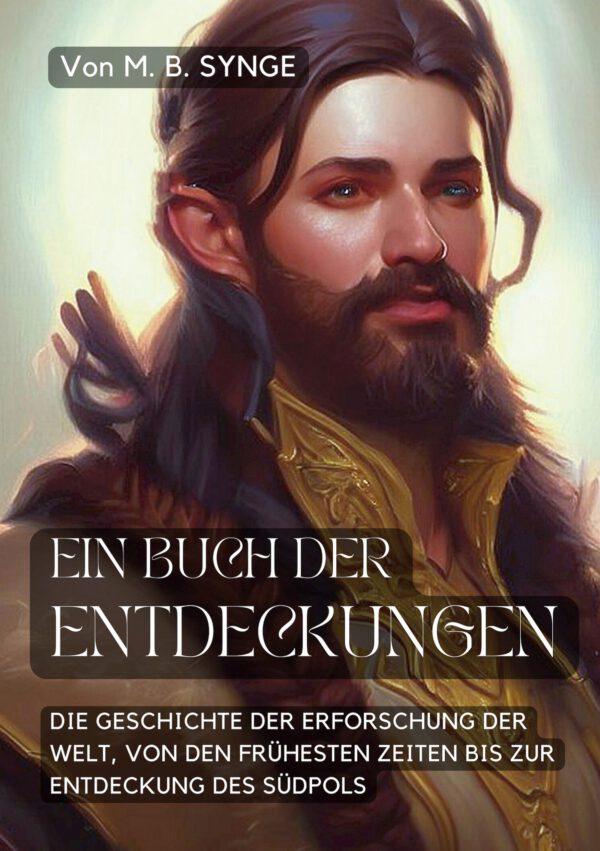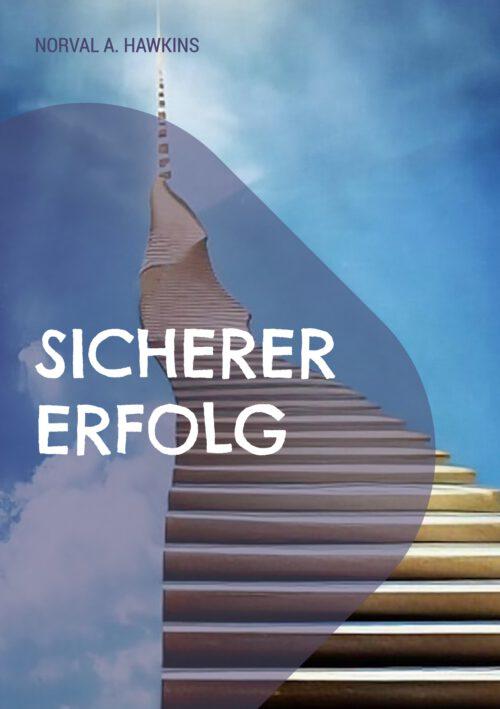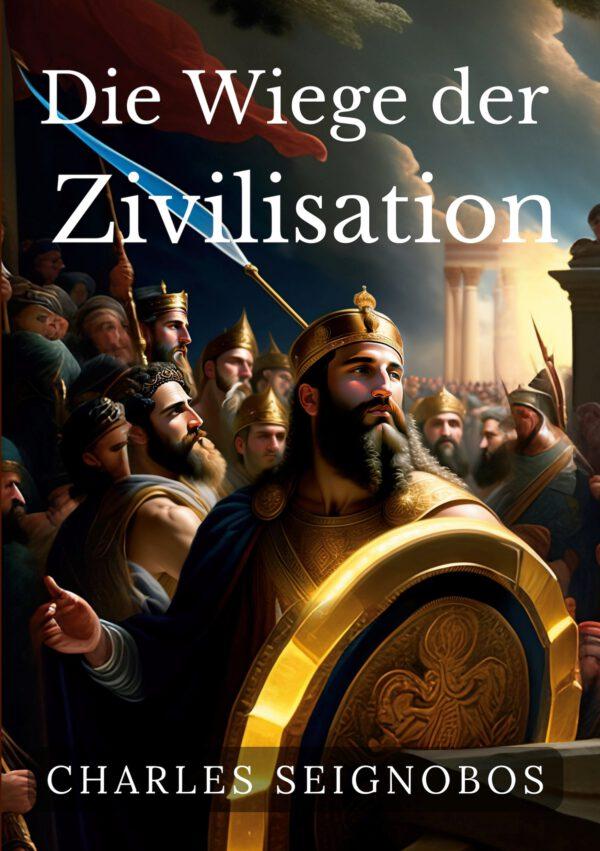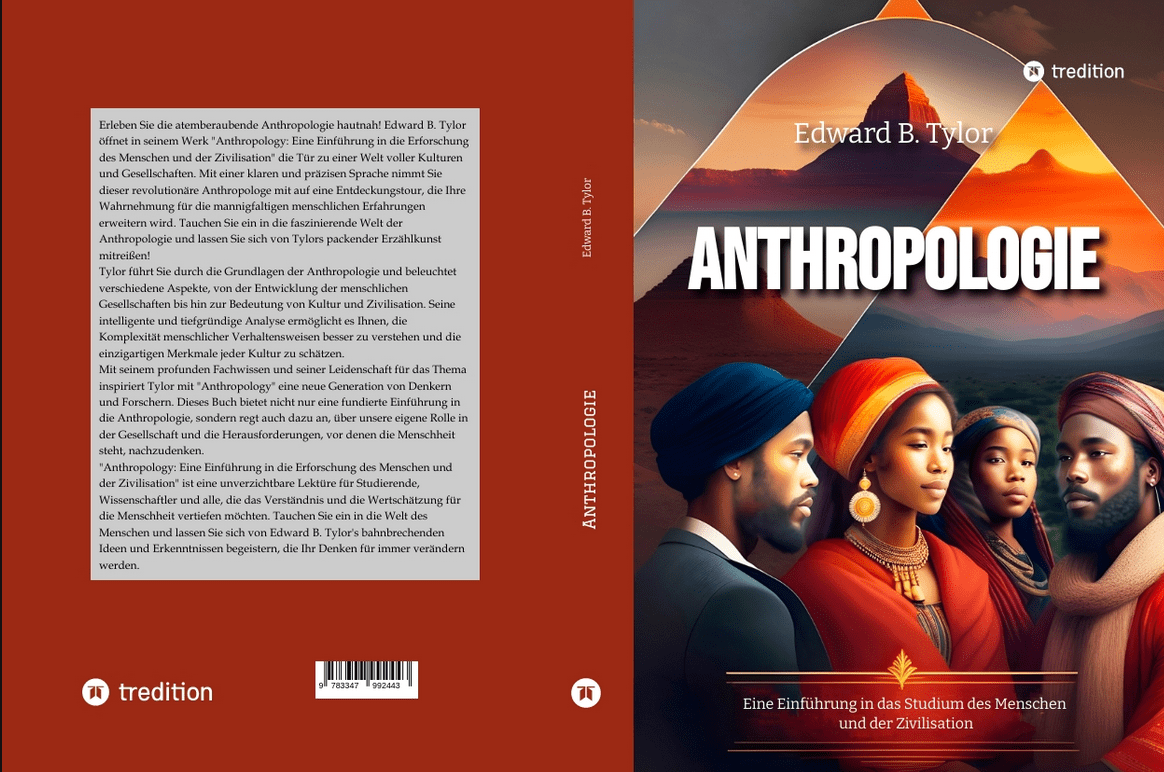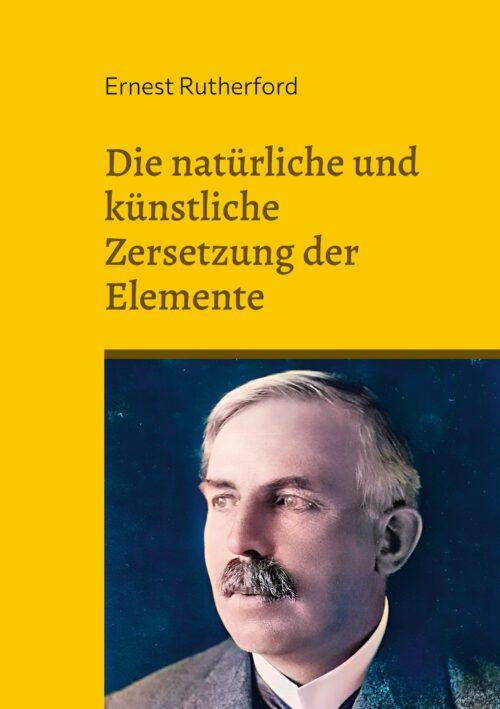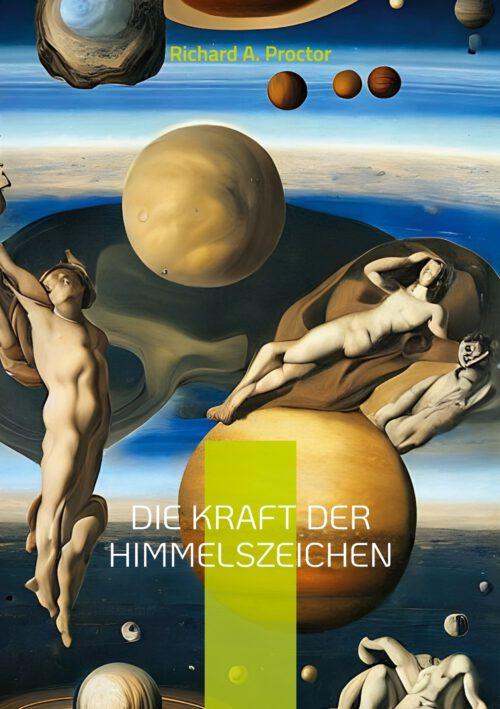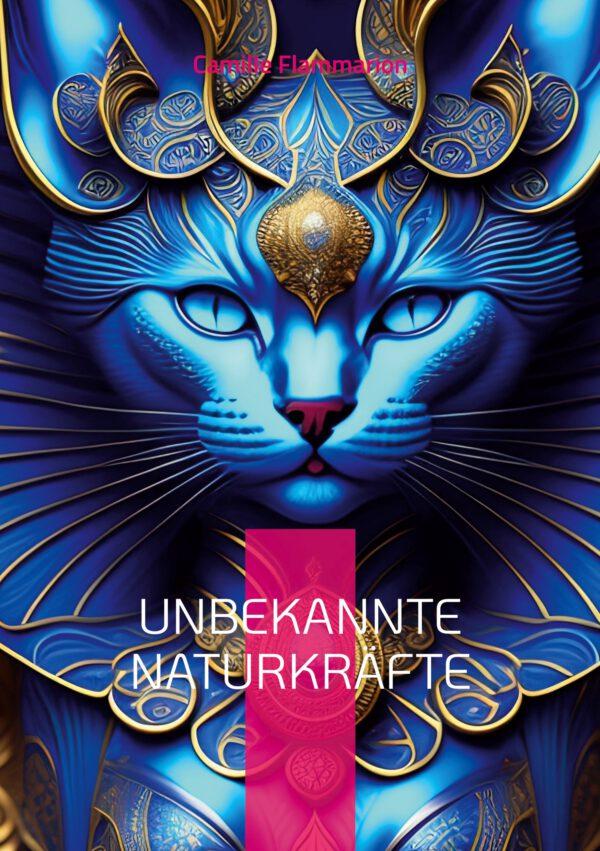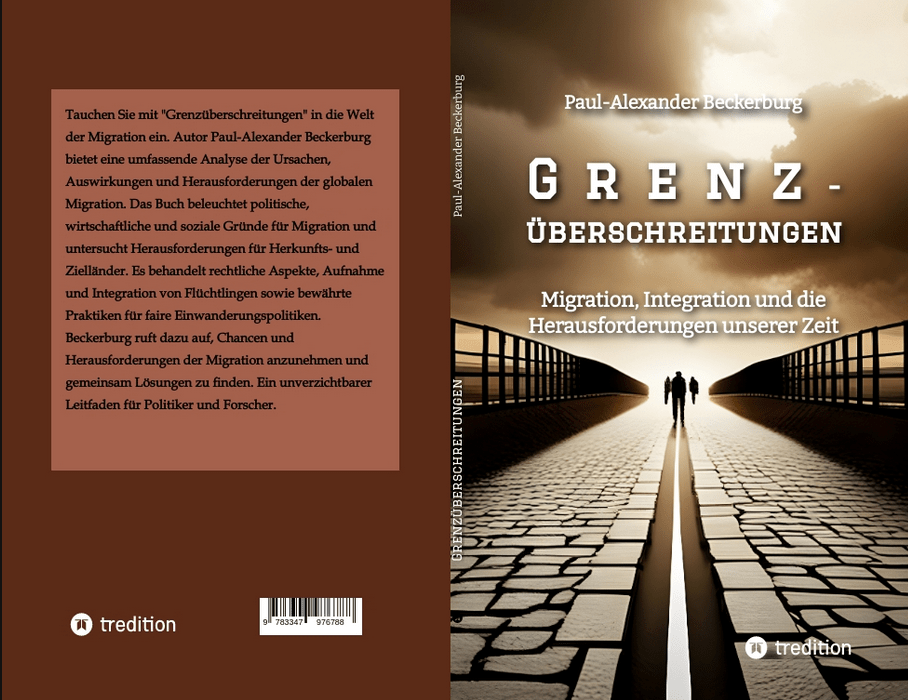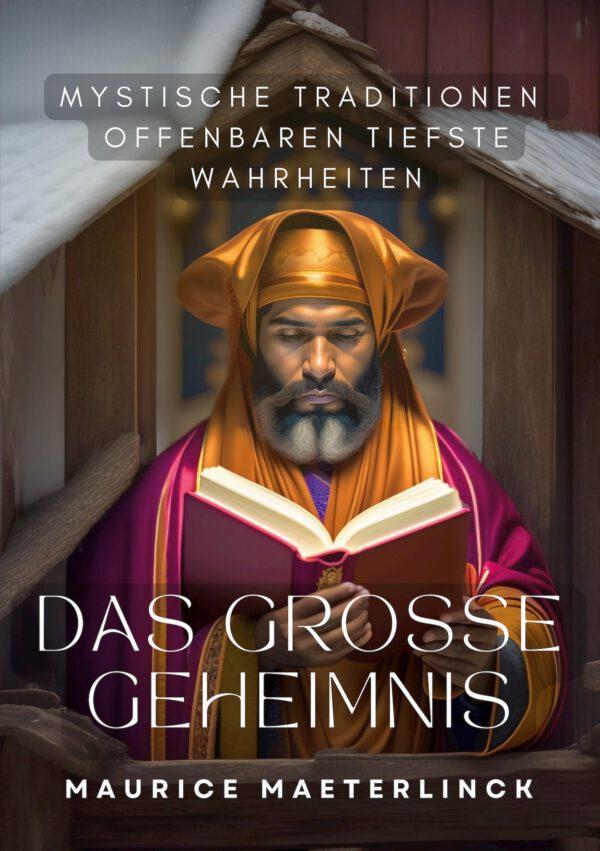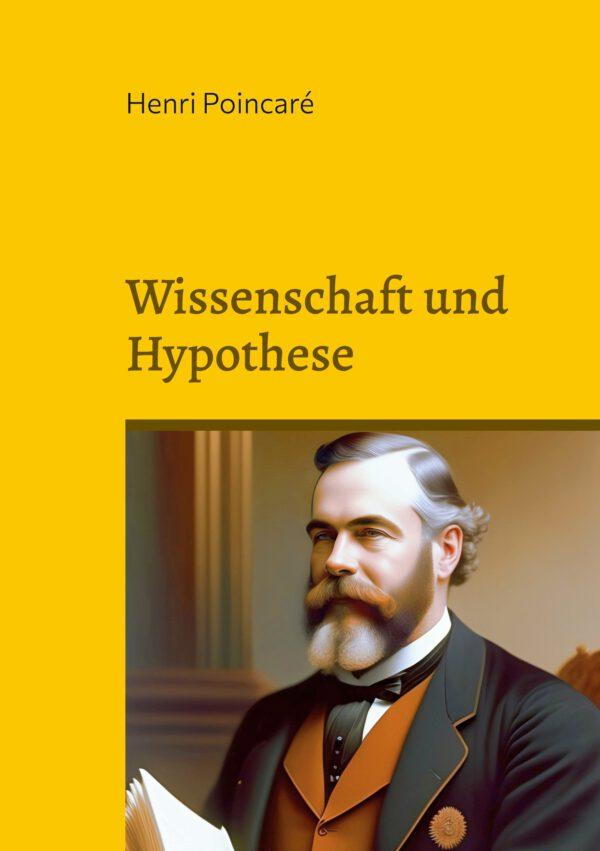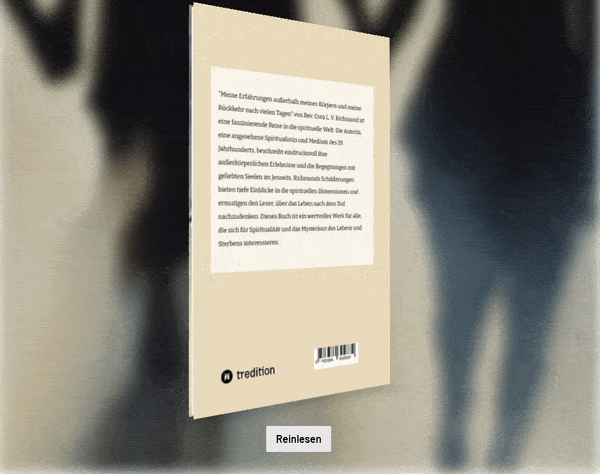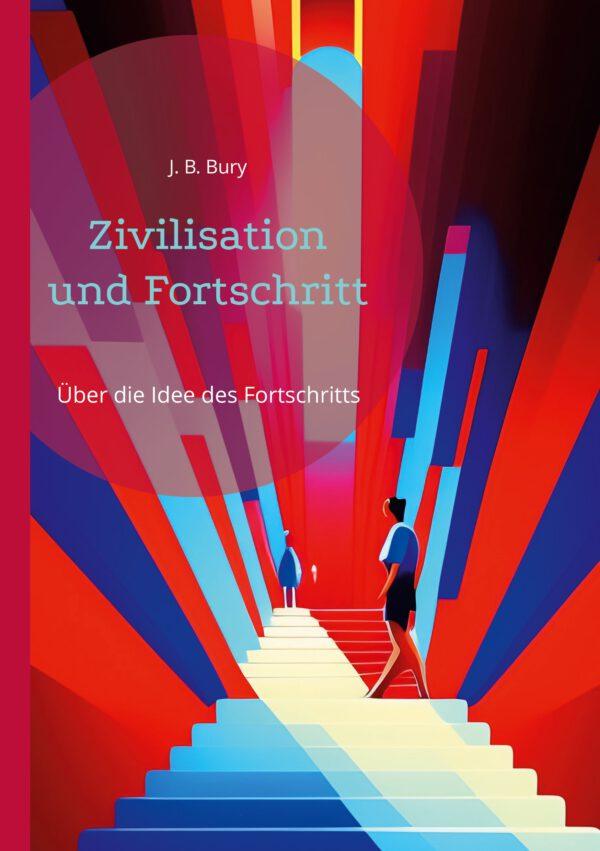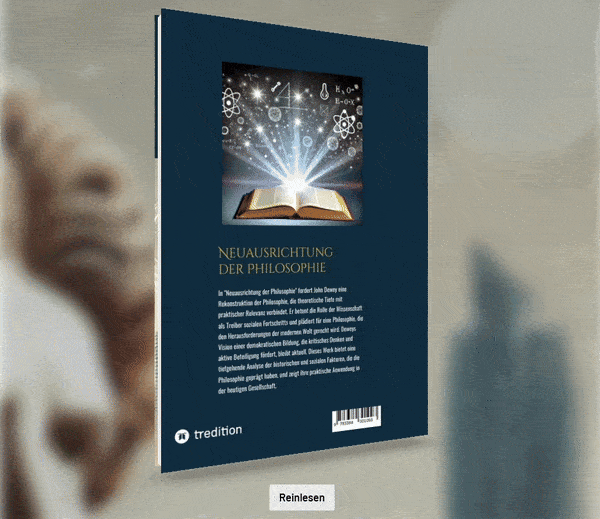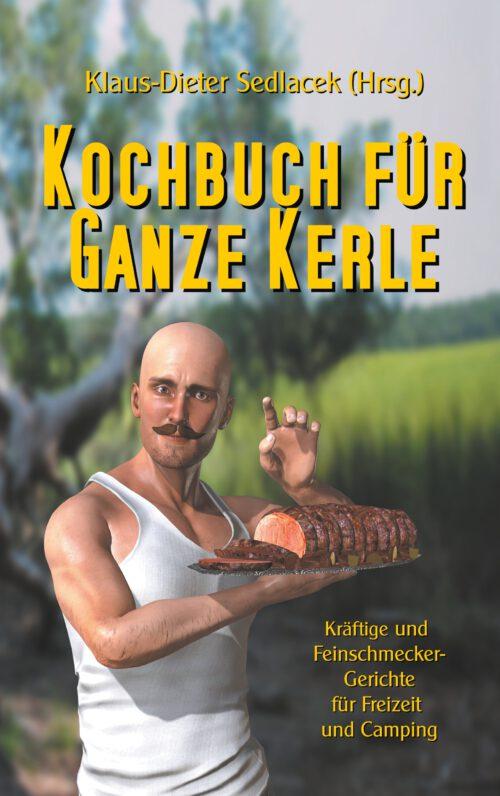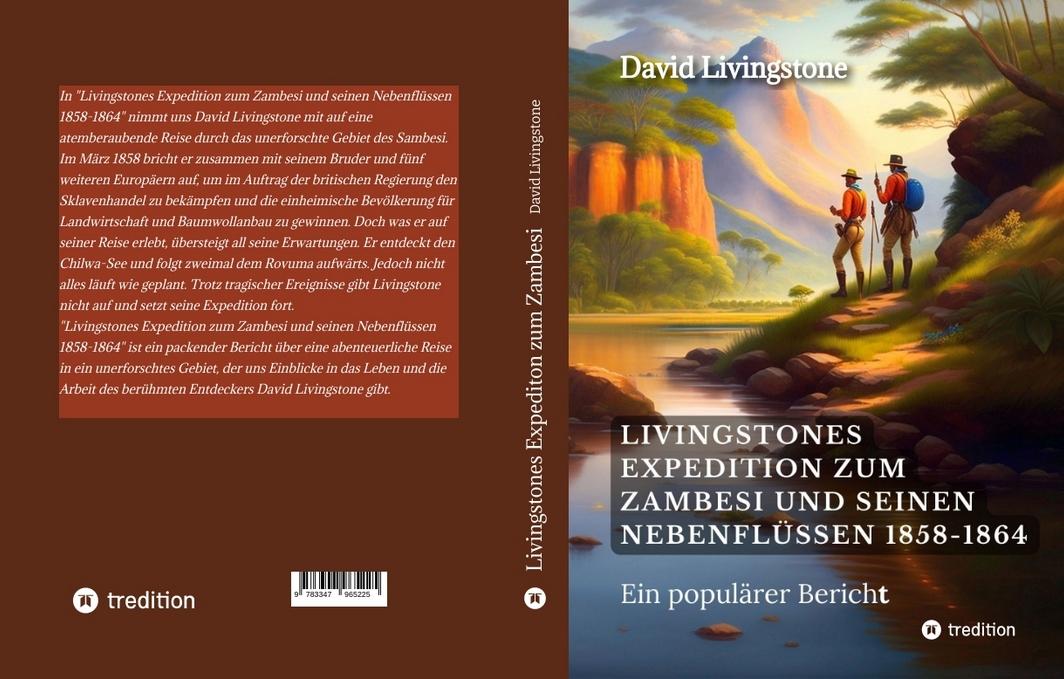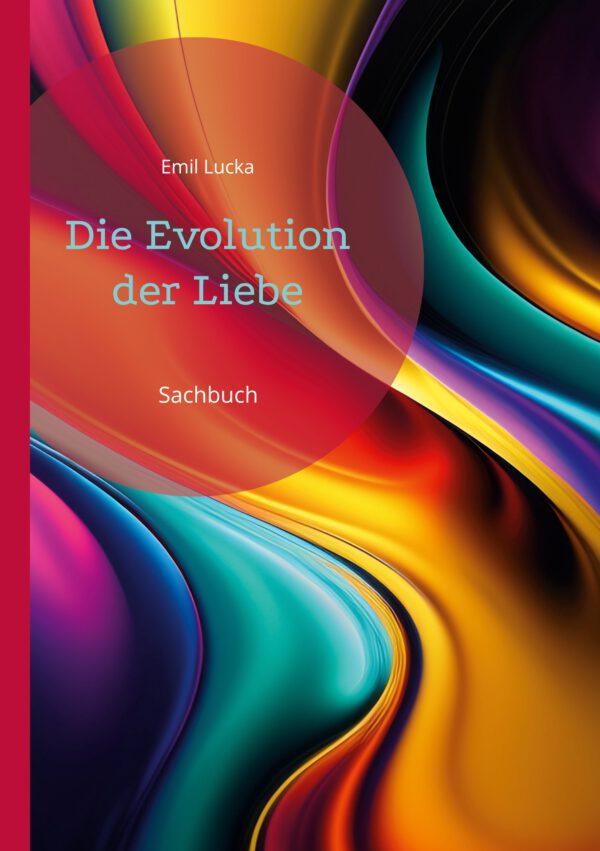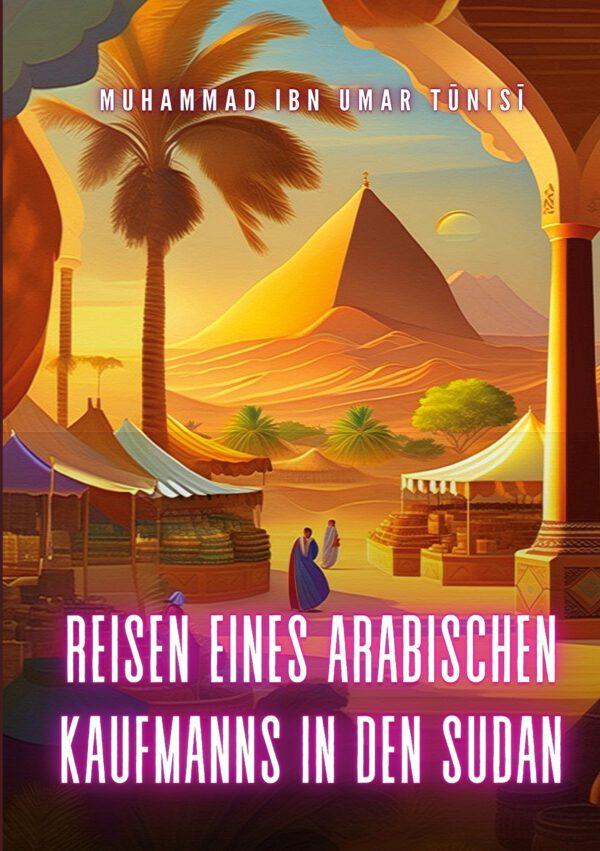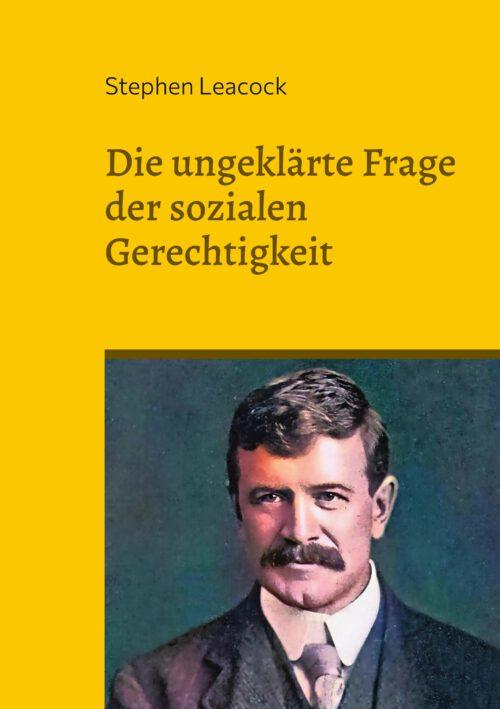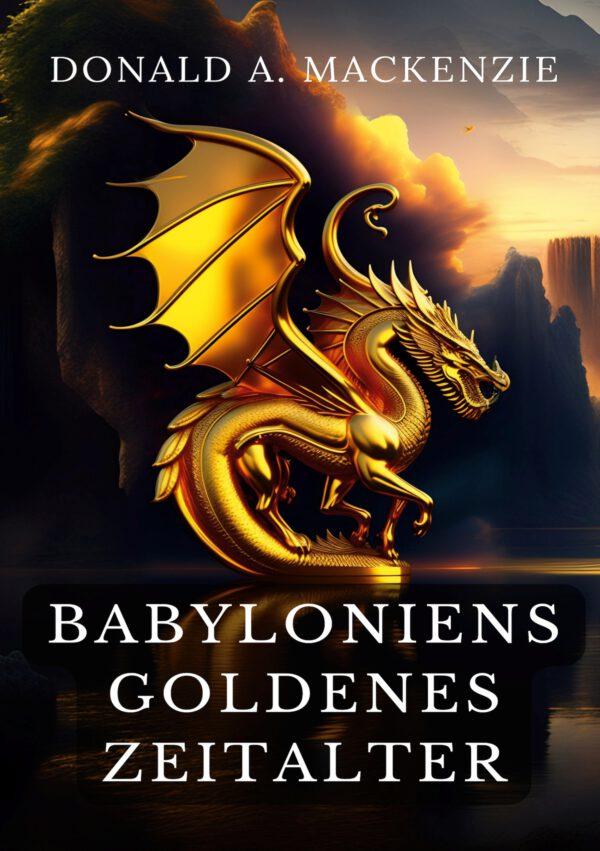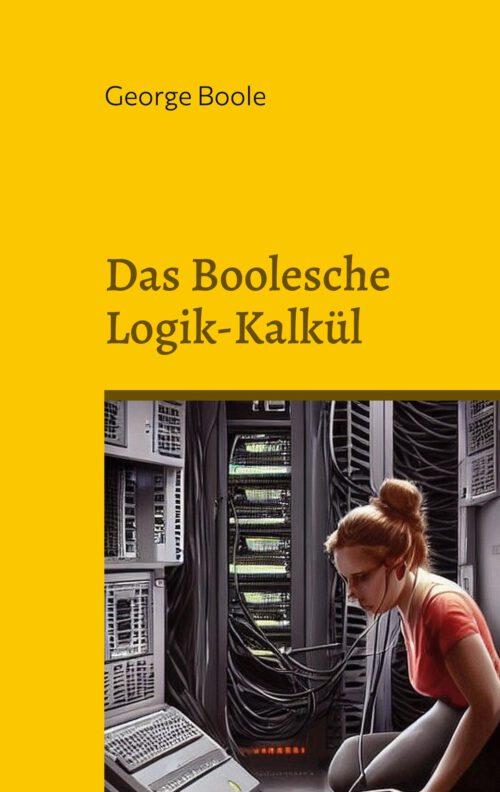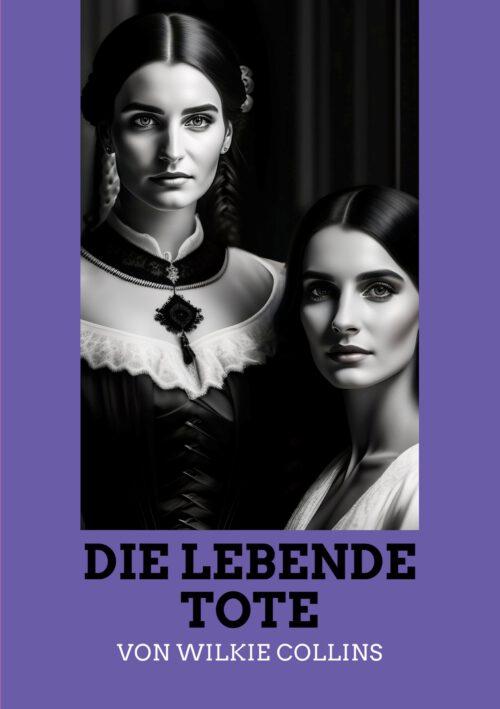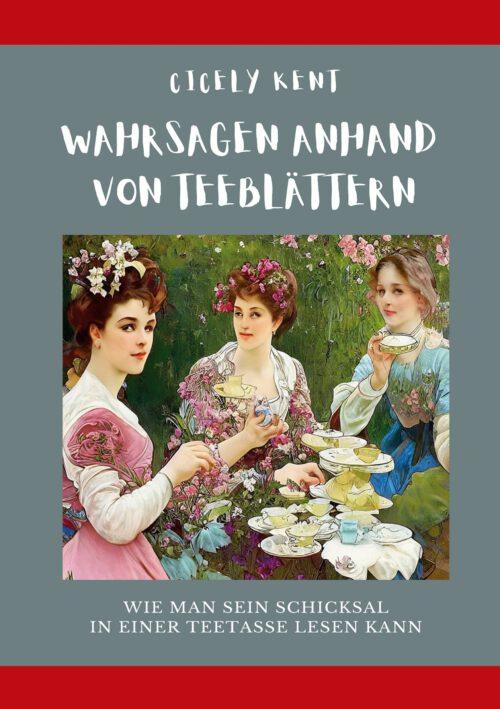Die
Sklaven von Paris
von
Étienne
Émile Gaboriau
Étienne Émile Gaboriau war
ein französischer Schriftsteller, der als Vater des Kriminalromans
gilt. Seine Figur, der Ermittler Lecoq, beeinflusste Conan Doyle bei
der Erschaffung von Sherlock Holmes. Er selbst wurde stark von Edgar
Allan Poe beeinflusst.
Liebesbeziehungen und deren Störungen
Um einen Menschen ganz kennenzulernen, ist es notwendig, ihn auch in seinen Liebesbeziehungen zu verstehen … Wir müssen von ihm aussagen können, ob er sich in Angelegenheiten der Liebe richtig oder unrichtig verhält, wir müssen feststellen können, warum er in einem Fall geeignet, im anderen Falle ungeeignet ist oder sein würde.
Wenn man außerdem bedenkt, dass von der Lösung des Liebes- und Eheproblems vielleicht der größte Teil des menschlichen Glücks abhängig ist, wird uns sofort klar, dass wir eine Summe der allerschwerstwiegenden Fragen vor uns haben, die den Gegenstand dieses Buches bilden.
Über das Buch:
In diesem Krimi taucht der berühmte Detektiv Lecoq
erst in den letzten Kapiteln auf. Tatsächlich bleibt die Identität
der Protagonisten bis fast zur Hälfte des Buches unklar. Man
vermisst sie jedoch nicht, denn die Antagonisten sind eine Gruppe von
Erpressern mit unerschöpflichem Einfallsreichtum und Wissen, und das
Spiel, das sie mit mehreren Adligen treiben, zu durchschauen,
beschäftigt den Leser fast das ganze Buch hindurch. Junge Liebe,
alte Liebe, verbotene Liebe, verlorene Liebe und ein paar vermisste
Personen: Was ist das Ziel der Erpresser?
Wird es Lecoq gelingen, das Spiel der Ganoven
rechtzeitig zu durchschauen? Lecoqs letzter Fall, der seinerzeit als
„französische Sensation“ bezeichnet wurde, ist auch heute
immer noch sensationell.
TEIL I GEFANGEN IM NETZ
–
I. DAS ANZIEHEN DER SCHRAUBE
Die Kälte am 8. Februar 186 war
intensiver, als die Pariser es in dem ganzen strengen Winter zuvor
erlebt hatten, denn um zwölf Uhr an diesem Tag zeigte Chevaliers
Thermometer, das den Einwohnern von Paris so gut bekannt ist, drei
Grad unter Null an. Der Himmel war wolkenverhangen und voller
drohender Anzeichen von Schnee, während die Feuchtigkeit auf den
Bürgersteigen und Straßen hart gefroren war und den Verkehr in
jeder Hinsicht gefährlich machte. Die ganze Stadt wirkte trostlos
und verlassen, denn selbst wenn eine dünne Eiskruste das Wasser der
Seine bedeckt, denkt man unwillkürlich an die Menschen, die weder
Essen noch Unterkunft noch Brennstoff haben.
Dieser bitterkalte Tag veranlasste die
Wirtin des Hotel de Perou, eine harte, habgierige Frau aus der
Auvergne, dazu, sich Gedanken über die Kondition ihrer Untermieter
zu machen, und zwar ganz anders, als sie es sonst tat, um ein Maximum
an Miete für ein Minimum an Unterkunft zu erhalten.
„Die Kälte“, sagte sie zu
ihrem Mann, der eifrig damit beschäftigt war, den Ofen mit
Brennmaterial aufzufüllen, „macht selbst einem Eisbären das
Fürchten schwer. Bei solchem Wetter bin ich immer sehr beunruhigt,
denn in einem solchen Winter hat sich einer unserer Mieter erhängt,
was uns fünfzig Franken gekostet hat und uns in der Nachbarschaft
einen schlechten Ruf einbrachte. Tatsache ist, dass man nie weiß,
wozu die Untermieter fähig sind. Du solltest mal in den obersten
Stock gehen und sehen, wie sie dort zurechtkommen.“
„Pah, pah!“, antwortete ihr
Mann, M. Loupins, „sie werden schon zurechtkommen.“
„Ist das wirklich deine Meinung?“
„Ich weiß, dass ich Recht habe.
Papa Tantaine ist rausgegangen, sobald es hell war, und kurz darauf
kam Paul Violaine herunter. Jetzt ist niemand mehr oben, außer der
kleinen Rose, und ich nehme an, dass sie klug genug war, in ihrem
Bett zu bleiben.“
„Ah!“, antwortete die
Vermieterin etwas gehässig. „Ich habe mich schon vor einiger
Zeit für diese junge Dame entschieden; sie ist viel zu hübsch für
dieses Haus, das sage ich dir.“
Das Hotel de Perou liegt in der Rue de
la Hachette, keine zwanzig Schritte von der Place de Petit Pont
entfernt, und es gibt wohl kaum ein Gebäude, das so sarkastisch
genannt wird. Das äußerst schäbige Äußere des Hauses, die
schmale, schlammige Straße, in der es stand, die schmuddeligen
Fenster, die mit Schlamm bedeckt und mit allen möglichen Flicken
ausgebessert waren – all das schien den Vorbeigehenden zuzurufen:
„Dies ist der auserwählte Aufenthaltsort von Elend und Not.“
Der Beobachter hätte es für eine
Räuberhöhle halten können, aber er hätte sich getäuscht, denn
die Bewohner waren ziemlich ehrlich. Das Hotel de Perou war eine der
immer seltener werdenden Zufluchtsstätten, in denen unglückliche
Männer und Frauen, die im Kampf des Lebens unterlegen waren, für
das Wechselgeld des letzten Fünf-Franc-Stücks eine Unterkunft
finden konnten. Sie gehen damit um, wie der Schiffbrüchige mit dem
Felsen, auf den er sich aus dem Strudel des wütenden Wassers rettet,
und atmen erleichtert auf, während er seine Kräfte für einen neuen
Versuch sammelt. So erbärmlich das Leben auch sein mag, ein längerer
Aufenthalt in einer solchen Unterkunft wie dem Hotel de Perou kommt
nicht in Frage. Die Kammern in jedem Stockwerk des Hauses sind durch
Trennwände in kleine Schlitze unterteilt, die mit Segeltuch und
Papier bedeckt sind und von M. Loupins liebevoll als Zimmer
bezeichnet werden. Die Trennwände waren in einer schrecklichen
Kondition, wackelig und instabil, und das Papier, mit dem sie bedeckt
waren, war zerrissen und hing in Fetzen herunter; aber der Zustand
der Dachböden war noch beklagenswerter: Die Decken waren so niedrig,
dass die Bewohner sich ständig bücken mussten, und die Dachfenster
ließen nur wenig Licht herein. Ein Bettgestell mit einer
Strohmatratze, ein klappriger Tisch und zwei kaputte Stühle waren
die einzigen Möbel in diesen Räumen. So erbärmlich diese
Schlafsäle auch waren, die Vermieterin verlangte und bekam
zweiundzwanzig Francs pro Monat dafür, weil es in jedem einen Kamin
gab, auf den sie die zukünftigen Mieter immer hinwies.
Die junge Frau, die M. Loupins mit dem
Namen Rose ansprach, saß an diesem bitterkalten Wintertag in einer
dieser trostlosen Unterkünfte. Rose war ein wunderschönes Mädchen
von etwa achtzehn Jahren. Sie war sehr hübsch; ihre langen Wimpern
verdeckten teilweise ein Paar stahlblaue Augen und milderten ihren
harten Ausdruck ein wenig. Ihre reifen, roten Lippen, die wie
geschaffen für Liebe und Küsse zu sein schienen, ließen einen
Blick auf eine Reihe perlweißer Zähne zu. Ihr helles, wallendes
Haar fiel ihr tief in die Stirn, und der Teil, der den Fesseln des
billigen Kammes, mit dem es befestigt war, entkommen war, hing in
wilder Üppigkeit über ihren exquisit geformten Hals und ihre
Schultern. Sie hatte die geflickte Decke des Bettes über ihr
zerlumptes, bedrucktes Kleid geworfen und hockte auf dem
zerfledderten Kaminvorleger vor dem Kamin, auf dem ein paar Stöcke
schwelten, die kaum Wärme abgaben, und versuchte, sich mit einem
schmutzigen Pack Karten über die Entbehrungen des Tages
hinwegzutrösten, indem sie sich künftigen Wohlstand versprach. Sie
hatte die Karten, die ihr Schicksal bestimmten, in einem Halbkreis
vor sich ausgebreitet und in Dreiergruppen eingeteilt, von denen jede
eine besondere Bedeutung hatte, und ihre Brust hob und senkte sich,
während sie sie umdrehte und auf ihren Gesichtern Glück oder
Unglück las. In diese Aufgabe vertieft, achtete sie kaum auf die
eisige Kälte der Atmosphäre, die ihre Finger steif machte und ihre
weißen Hände lila färbte.
„Eins, zwei, drei“, murmelte
sie mit leiser Stimme. „Ein schöner Mann, das wird Paul sein.
Eins, zwei, drei, Geld für das Haus. Eins, zwei, drei, Sorgen und
Nöte. Eins, zwei, drei, die Pikneun; ach, du liebe Zeit, noch mehr
Not und Elend – immer taucht diese elende Karte mit ihrer traurigen
Geschichte auf!“
Rose schien beim Anblick des kleinen
Stücks bemalter Pappe völlig niedergeschlagen zu sein, als hätte
sie eine Vorahnung auf ein bevorstehendes Unglück erhalten. Sie
erholte sich jedoch bald wieder und mischte das Pack erneut, wobei
sie darauf achtete, es mit der linken Hand zu zerschneiden, breitete
die Karten vor sich aus und begann erneut zu zählen: eins, zwei,
drei. Diesmal schienen die Karten vielversprechender zu sein und
verhießen Erfolg für die Zukunft.
„Ich werde geliebt“, las sie,
während sie ängstlich auf die Karten blickte – „sehr geliebt!
Hier ist Freude und ein Brief von einem dunklen Mann! Siehst du, da
ist er, der Knappe der Keulen. Immer dasselbe“, fuhr sie fort,
„ich kann mich nicht gegen das Schicksal wehren.“
Dann erhob sie sich und holte aus einer
Ritze in der Wand, die ein sicheres Versteck für ihre Geheimnisse
war, einen schmutzigen und zerknitterten Brief hervor und las zum
vielleicht hundertsten Mal diese Worte
MADEMOISELLE-
Dich zu sehen heißt, dich zu lieben.
Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass das wahr ist. Die armselige Hütte,
in der deine Reize versteckt sind, ist keine angemessene Unterkunft
für dich. Ein Haus, das in jeder Hinsicht würdig ist, dich zu
empfangen, steht dir zur Verfügung – die Rue de Douai. Ich habe es
in deinem Namen genommen, denn ich bin in diesen Dingen sehr direkt.
Denke über meinen Vorschlag nach und erkundige dich nach mir, wenn
du willst. Ich bin noch nicht volljährig, werde es aber in fünf
Monaten und drei Tagen sein, wenn ich das Vermögen meiner Mutter
erben werde. Mein Vater ist wohlhabend, aber alt und gebrechlich. In
den nächsten Tagen werde ich von vier bis sechs Uhr nachmittags in
seinem Wagen an der Ecke der Place de Petit Pont sein.
GASTON DE GANDELU.
Die zynische Unverfrorenheit des
Briefes und sein völliger Mangel an Form waren ein perfektes
Beispiel für den Stil dieser Herumtreiber in der Stadt, die von den
Parisern als „Mashers“ bezeichnet werden; und dennoch
schien Rose keineswegs angewidert von der Entgegennahme eines so
unwürdig formulierten Vorschlags, sondern im Gegenteil eher erfreut
über dessen Inhalt.
Weiterlesen »
Zur Quelle wechseln



.gif)

.gif)