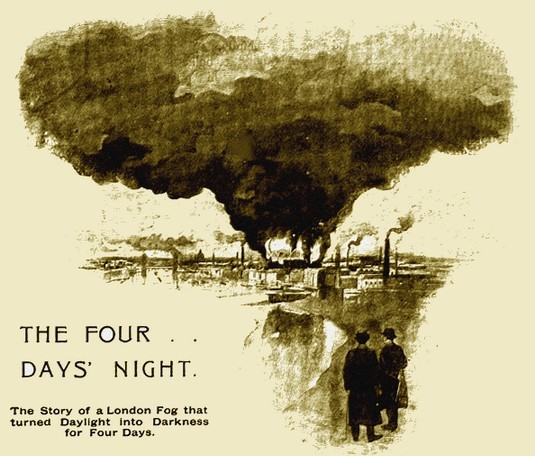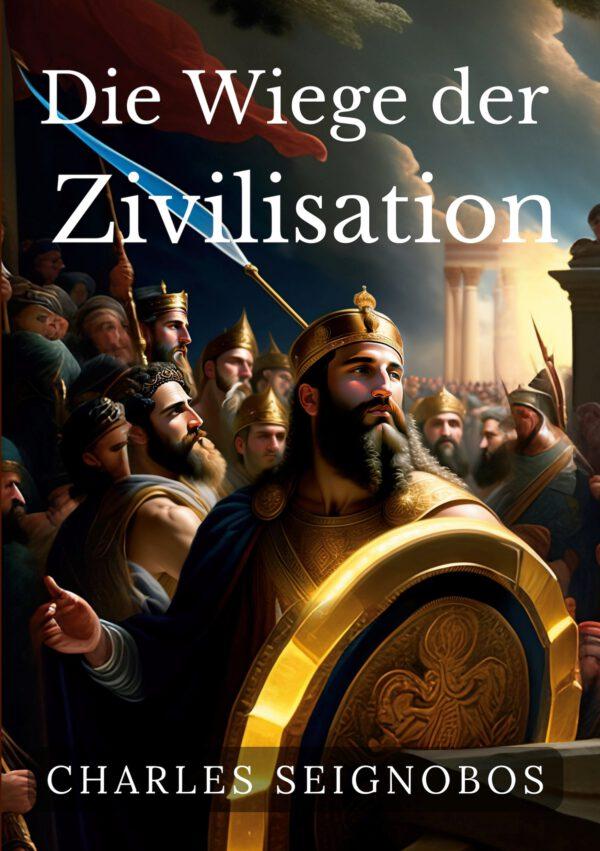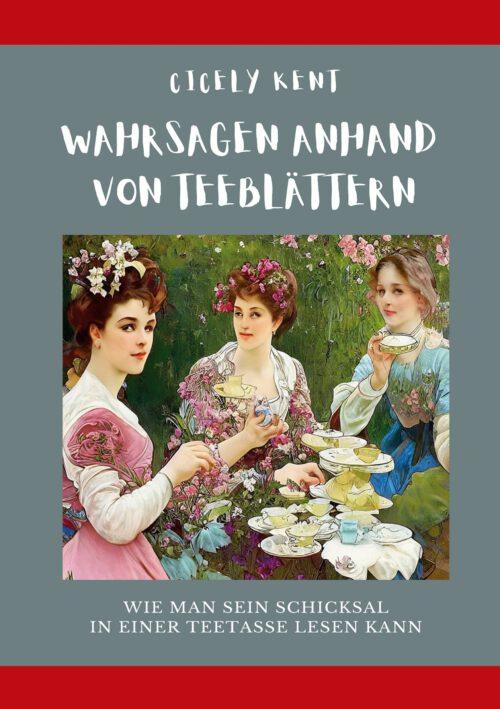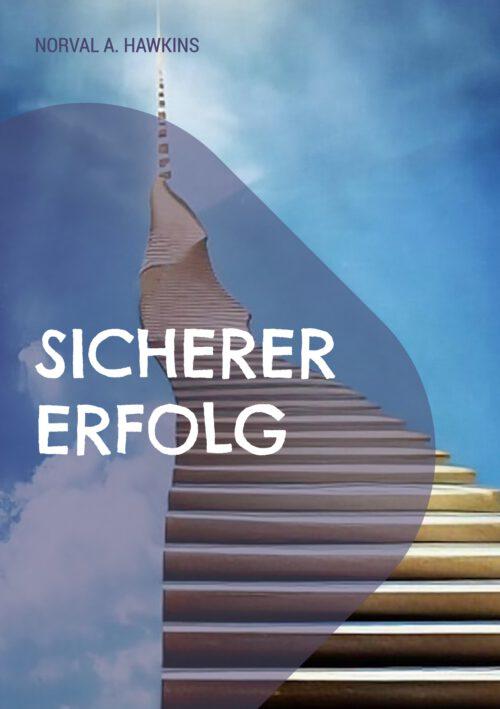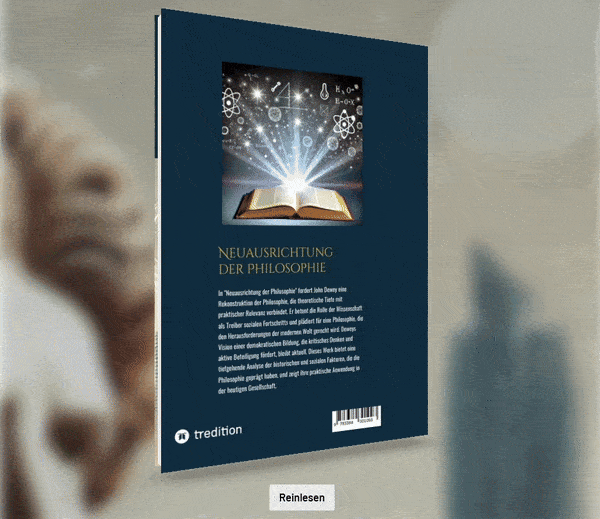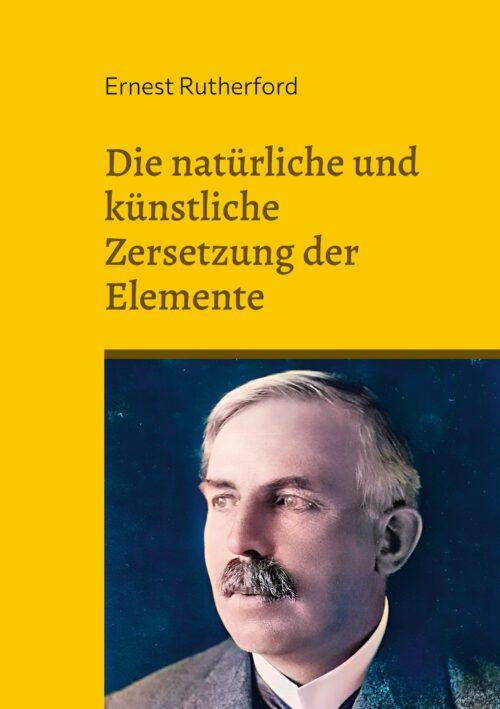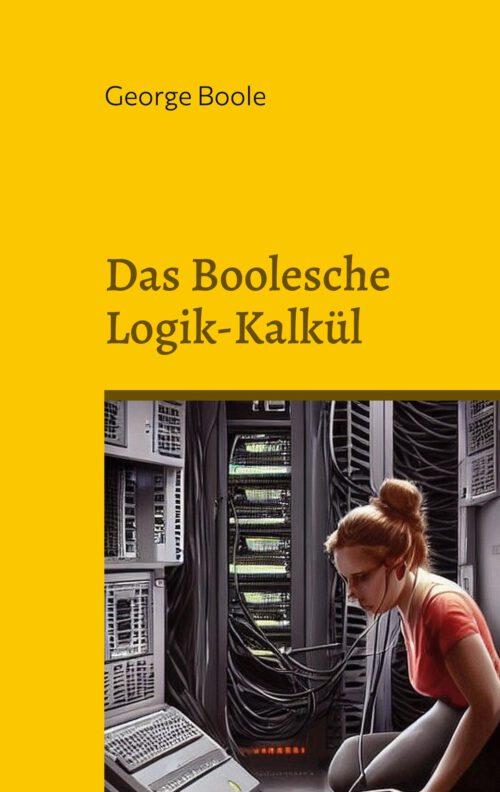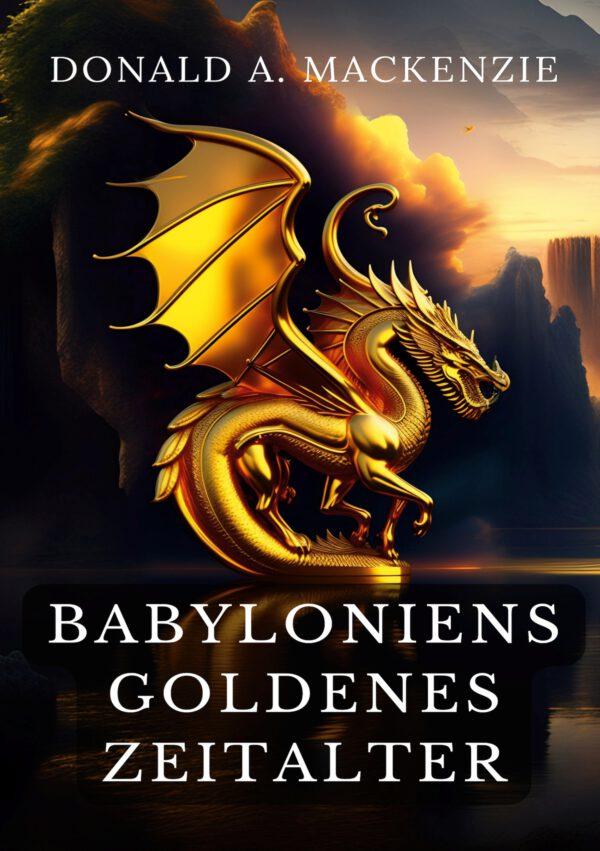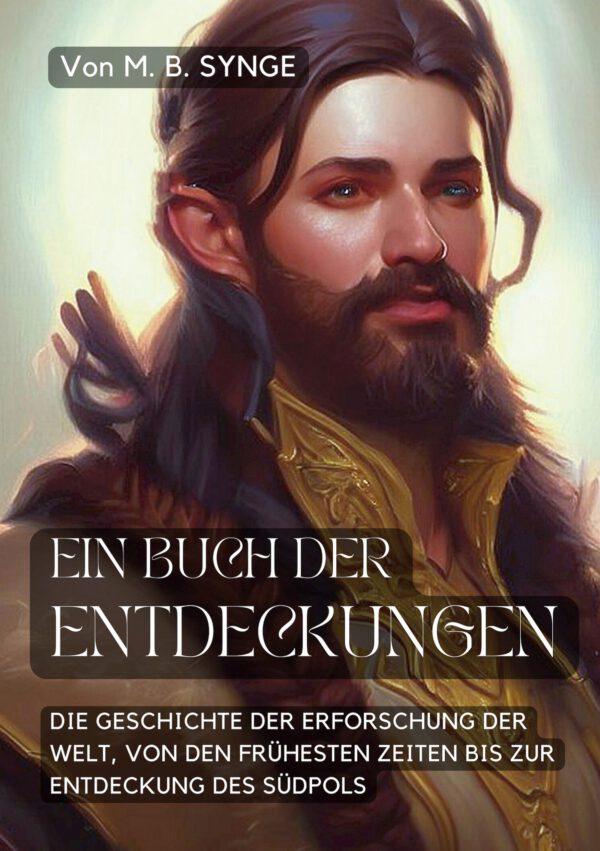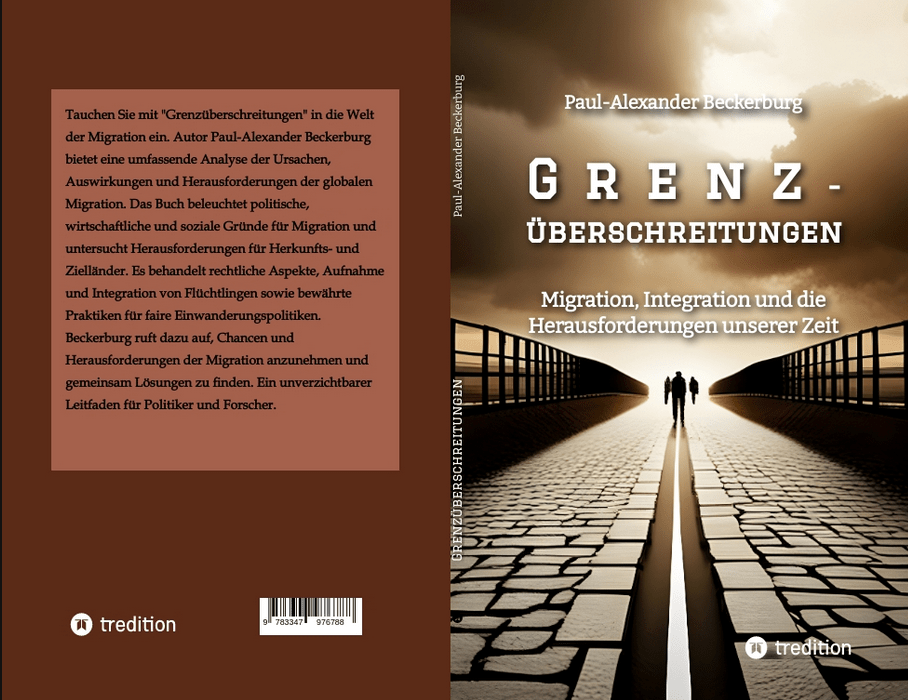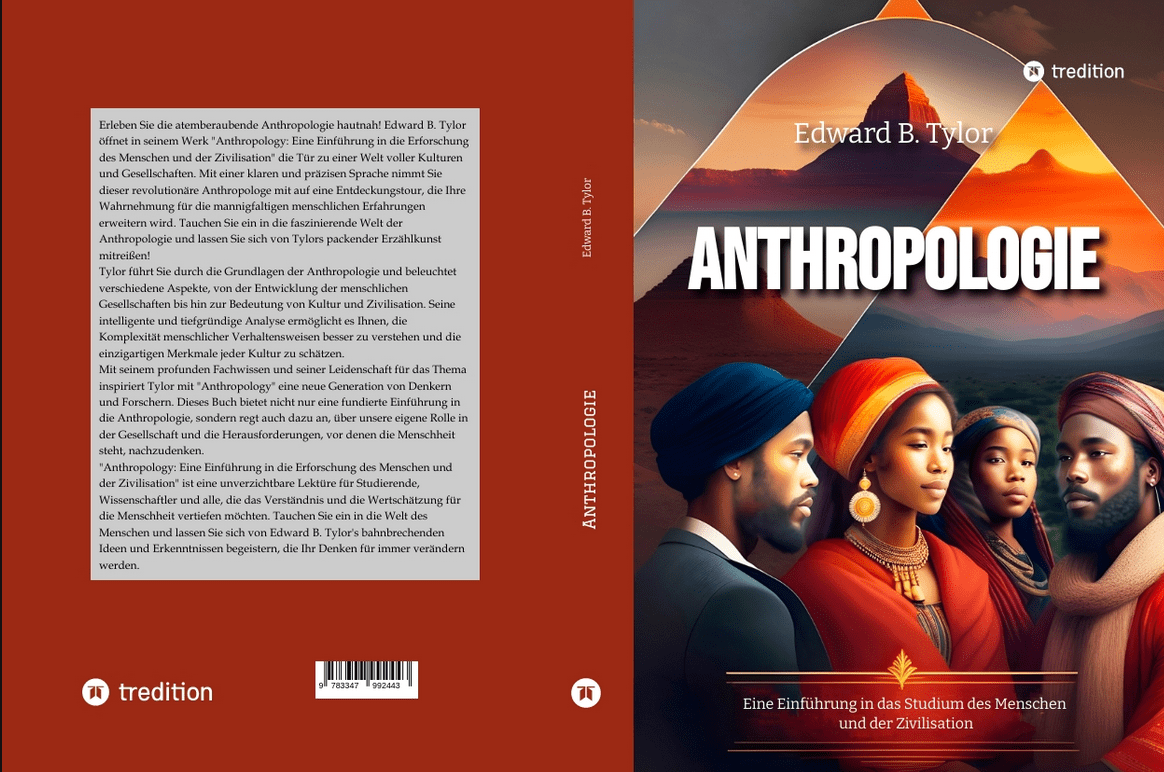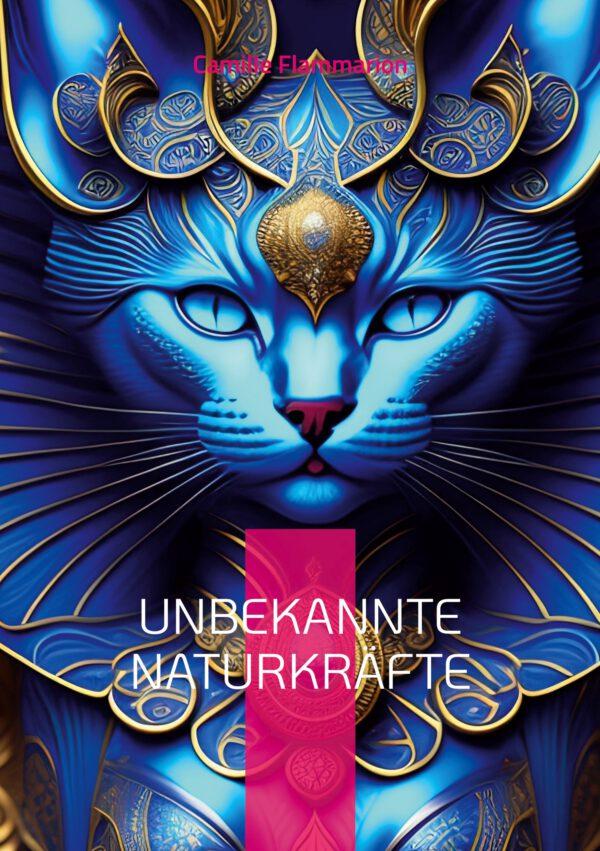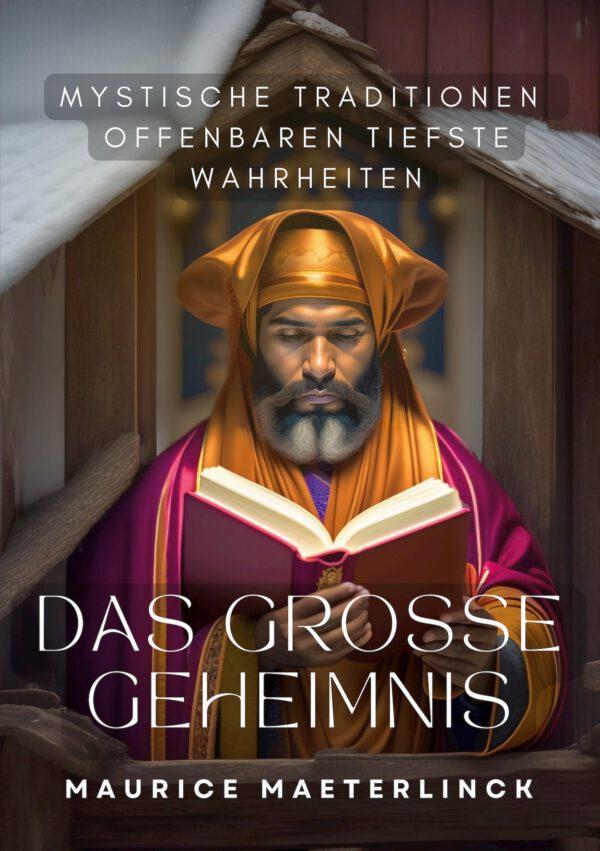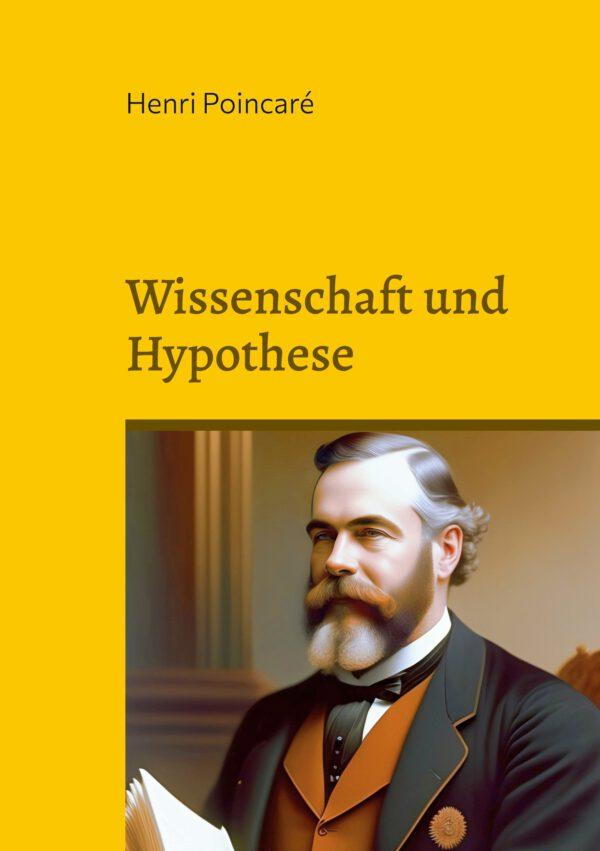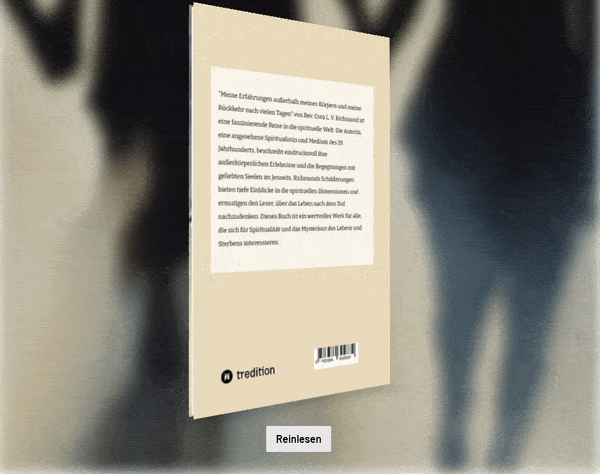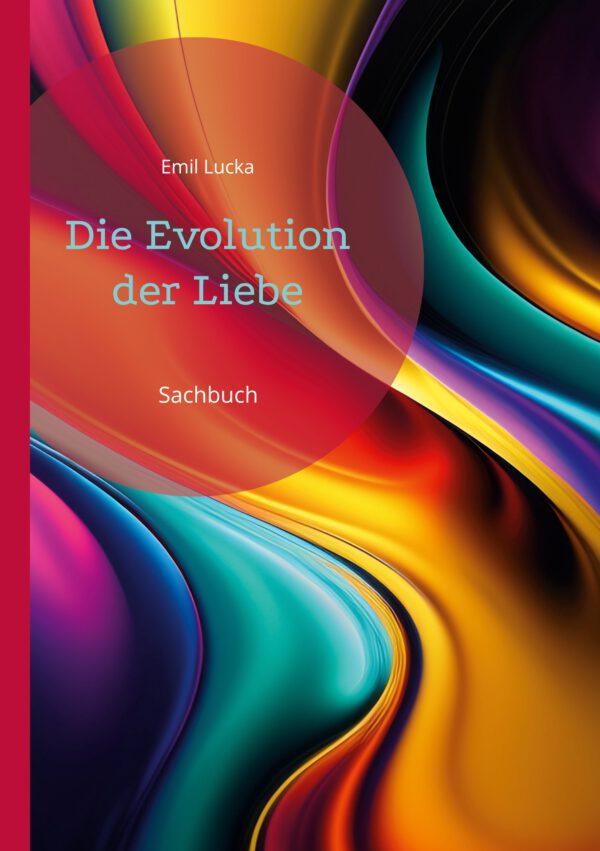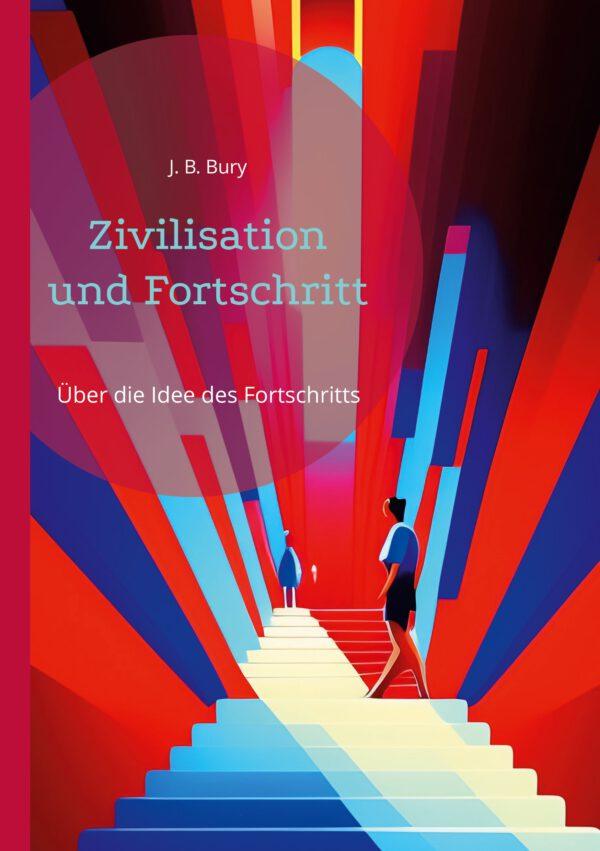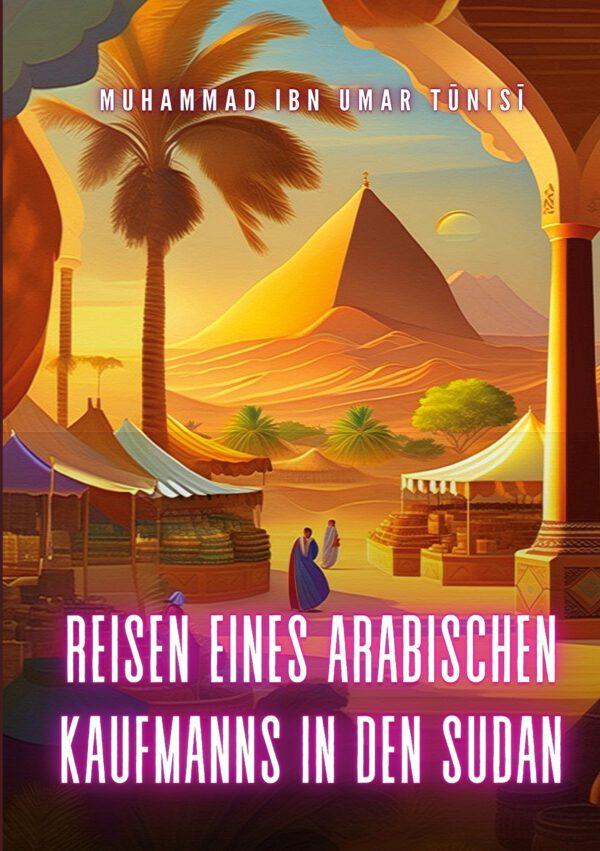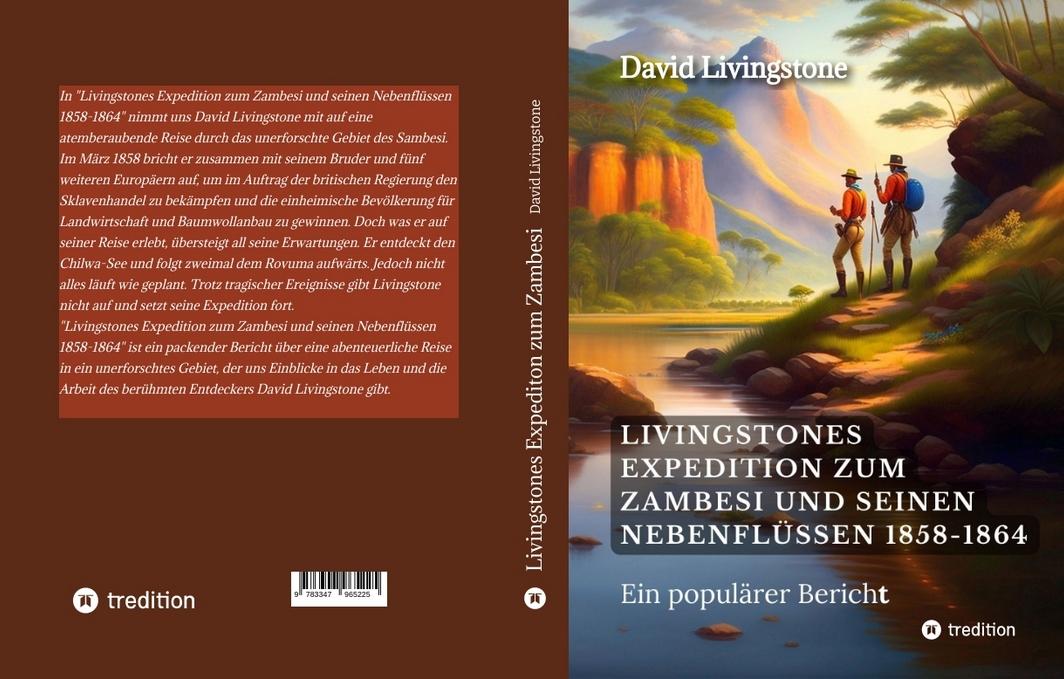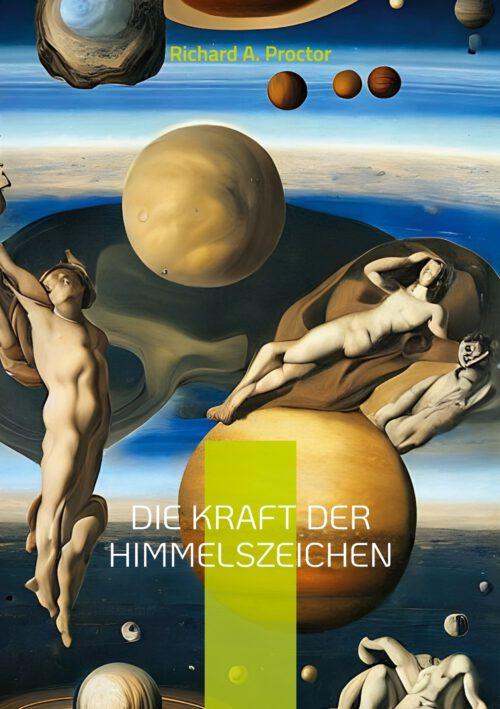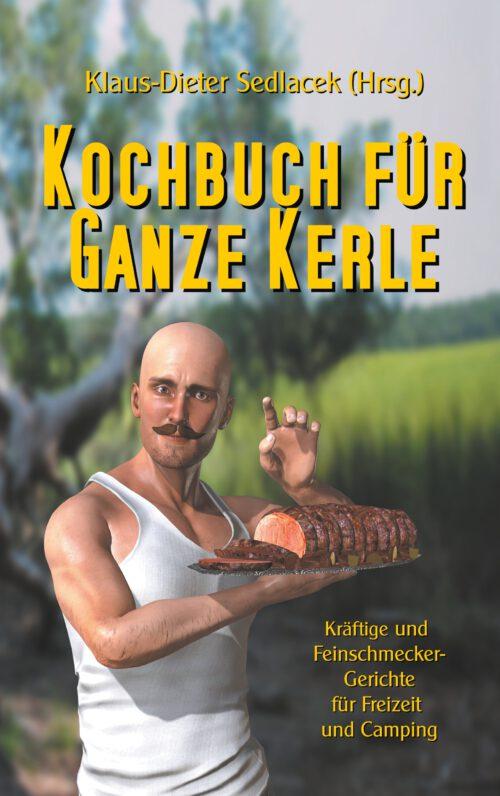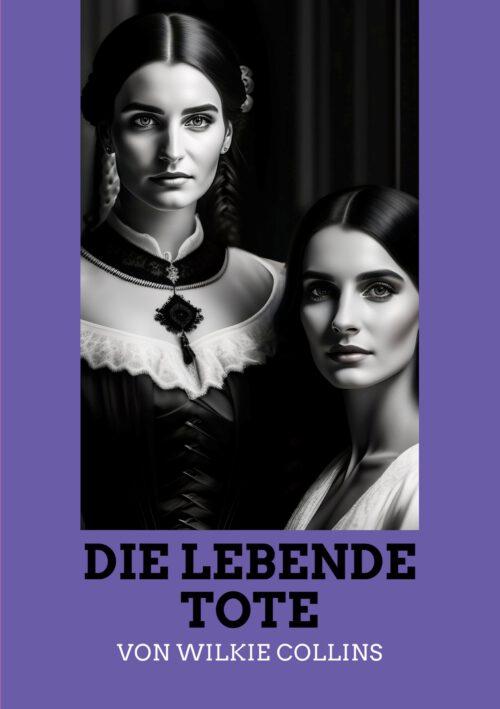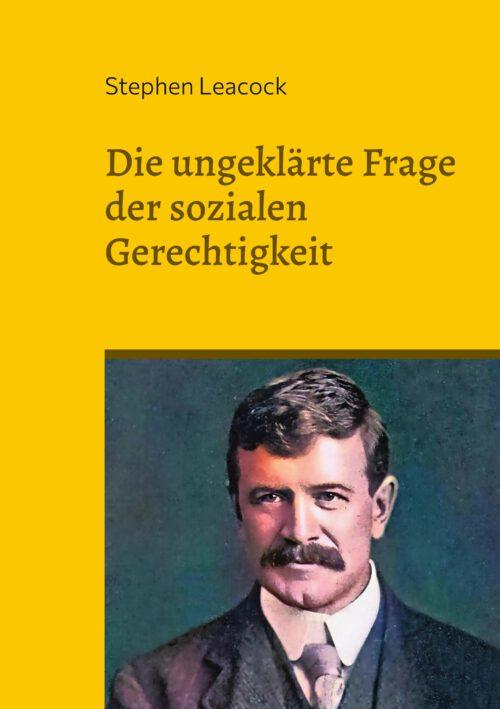DER WAGABOND
von
GUY DE MAUPASSANT
Seit vierzig Tagen war er unterwegs und suchte überall nach Arbeit. Er hatte seine Heimat Ville-Avaray, im Ärmelkanal, verlassen, weil es dort keine Arbeit gab. Als Zimmermannsgeselle, siebenundzwanzig Jahre alt, gutmütig und tapfer, war er zwei Monate lang seiner Familie zur Last gefallen, er, der älteste Sohn, hatte nichts anderes zu tun, als seine kräftigen Arme in der allgemeinen Arbeitslosigkeit zu verschränken. Das Brot im Haus wurde knapp, die beiden Schwestern gingen zur Arbeit, verdienten aber wenig und er, Jacques Randel, der Stärkste, tat nichts, weil er nichts zu tun hatte und aß die Suppe der anderen.
Er fragte im Rathaus nach und der Sekretär antwortete, dass man im Zentrum eine Beschäftigung finden könne.
Er machte sich also mit Papieren und Bescheinigungen auf den Weg, hatte sieben Franken in der Tasche und trug ein Paar Ersatzschuhe, eine Hose und ein Hemd in einem blauen Taschentuch, das an der Spitze seines Stocks befestigt war, über der Schulter.
Und er marschierte unruhig, Tage und Nächte lang, auf endlosen Straßen, in der Sonne und im Regen, ohne jemals das geheimnisvolle Land zu erreichen, in dem die Arbeiter Arbeit finden.
Zunächst hielt er an seiner Idee fest, dass er nur als Zimmermann arbeiten sollte, da er Zimmermann war. Aber auf allen Baustellen, auf denen er sich vorstellte, wurde ihm gesagt, dass man gerade Männer entlassen hatte, weil es keine Aufträge gab und er entschied sich, da er keine Ressourcen mehr hatte, jede Arbeit zu erledigen, die er auf seinem Weg finden würde.
Er brach Holz, entwurzelte Bäume, grub einen Brunnen, mischte Mörtel, band Bündel und hütete Ziegen auf einem Berg, alles für ein paar Pfennige, denn er bekam nur ab und zu zwei oder drei Tage Arbeit, wenn er sich selbst zu einem niedrigen Preis anbot, um die Gier der Arbeitgeber und Bauern zu reizen.
Und jetzt, seit einer Woche, konnte er nichts mehr finden, er hatte nichts mehr und er aß ein wenig Brot, dank der Wohltätigkeit der Frauen, die er auf den Türschwellen anflehte, während er die Straßen entlang ging.
Als es Abend wurde, lief Jacques Randel mit gebrochenen Beinen, leerem Magen und einer Seele in Not barfuß über das Gras am Wegesrand, weil er sein letztes Paar Schuhe schonte, da das andere schon lange nicht mehr existierte. Es war ein Samstag im Spätherbst. Die grauen Wolken rollten schwer und schnell über den Himmel, während der Wind durch die Bäume pfiff. Man spürte, dass es bald regnen würde. Das Land war verlassen, an diesem frühen Abend, am Vorabend eines Sonntags. Auf den Feldern ragten gelbe, monströse Pilzhaufen aus Stroh auf und das Land schien kahl zu sein, da es bereits für das nächste Jahr gesät wurde.
Randel hatte Hunger, einen tierischen Hunger, einen der Art von Hunger, die Wölfe auf Menschen werfen. Erschöpft streckte er seine Beine aus, um weniger Schritte zu machen, und mit einem schweren Kopf, Blut in den Schläfen, roten Augen und einem trockenen Mund umklammerte er seinen Stock in der Hand mit dem unbestimmten Wunsch, den ersten Passanten, den er auf dem Weg nach Hause zum Essen traf, zu schlagen.
Er schaute auf die Straßenränder und hatte das Bild von Kartoffeln vor Augen, die auf dem aufgewühlten Boden liegen geblieben waren. Wenn er ein paar Kartoffeln gefunden hätte, hätte er Totholz gesammelt, ein kleines Feuer im Graben gemacht und ein gutes Abendessen gehabt, mit dem warmen, runden Gemüse, das er zuerst brennend in seinen kalten Händen gehalten hätte.
Aber die Jahreszeit war vorbei und er sollte, wie am Vortag, eine rohe Rübe abnagen, die er aus einer Furche gezogen hatte.
Seit zwei Tagen hatte er laut gesprochen und seine Schritte unter der Besessenheit seiner Gedanken verlängert. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum gedacht, da er seinen ganzen Geist, all seine einfachen Fähigkeiten, auf seine Arbeit anwandte. Aber nun kam die Müdigkeit, die hartnäckige Verfolgung einer unauffindbaren Arbeit, die Ablehnungen, die Zurückweisungen, die auf dem Gras verbrachten Nächte, das Fasten, die Verachtung, die er bei den Sesshaften für den Landstreicher spürte, die täglich gestellte Frage: „Warum bleiben Sie nicht zu Hause? „Der Kummer, dass er seine tapferen Arme, die er als voller Kraft empfand, nicht beschäftigen konnte, die Erinnerung an die Eltern, die zu Hause geblieben waren und auch kaum Geld hatten, füllten ihn nach und nach mit einer langsamen Wut, die sich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ansammelte und die gegen seinen Willen in kurzen, donnernden Sätzen aus seinem Mund kam.
Während er über die Steine stolperte, die unter seinen nackten Füßen wegrollten, knurrte er: „Elend… Elend… Schweinehaufen… einen Mann verhungern lassen… einen Zimmermann… Schweinehaufen… keine vier Pfennige… keine vier Pfennige… jetzt regnet es… Schweinehaufen!
Er empörte sich über die Ungerechtigkeit des Schicksals und schimpfte auf die Menschen, auf alle Menschen, dass die Natur, die große blinde Mutter, unfair, grausam und tückisch ist.
Er wiederholte mit zusammengebissenen Zähnen: „Schweinehunde“ und blickte auf den dünnen grauen Rauch, der zu dieser Abendstunde von den Dächern aufstieg. Und ohne über die andere, menschliche Ungerechtigkeit nachzudenken, die sich Gewalt und Diebstahl nennt, hatte er Lust, in eines der Häuser einzudringen, die Bewohner zu verprügeln und sich an ihrer Stelle an den Tisch zu setzen.
Er sagte: „Ich habe jetzt kein Recht zu leben… da sie mich verhungern lassen… ich will doch nur arbeiten… ihr Schweine…“. Und das Leiden seiner Glieder, das Leiden seines Bauches, das Leiden seines Herzens stieg ihm wie ein furchterregender Rausch in den Kopf und ließ in seinem Gehirn die einfache Idee entstehen: „Ich habe das Recht zu leben, da ich atme, da die Luft allen gehört. Also hat man nicht das Recht, mich ohne Brot zurückzulassen.
Der Regen fiel, fein, dicht und eiskalt. Er blieb stehen und murmelte: „Elend… noch einen Monat unterwegs, bevor ich nach Hause komme…“. Er war jetzt tatsächlich auf dem Weg nach Hause und wusste, dass er in seiner Heimatstadt, wo er bekannt war, eher etwas zu tun finden würde, indem er alles Mögliche tat, als auf den großen Straßen, wo ihn jeder verdächtigte.
Da der Dachstuhl nicht passte, würde er Hilfsarbeiter, Putzmacher, Erdarbeiter und Steinbrecher werden. Auch wenn er nur zwanzig Pfennige am Tag verdienen würde, würde es immer noch genug sein, um zu essen.
Er band sich den Rest seines letzten Taschentuchs um den Hals, um zu verhindern, dass das kalte Wasser über seinen Rücken und seine Brust lief. Aber bald spürte er, dass es bereits durch den dünnen Stoff seiner Kleidung drang und er blickte sich ängstlich um, wie ein verlorener Mensch, der nicht weiß, wo er seinen Körper verstecken und seinen Kopf ausruhen soll, der keinen Schutz in der Welt hat.
Die Nacht kam und legte einen Schatten über die Felder. Er sah in der Ferne auf einer Wiese einen dunklen Fleck auf dem Gras, eine Kuh. Er kletterte über den Straßengraben und ging zu ihr, ohne zu wissen, was er tat.
Als er bei ihr war, hob sie ihren großen Kopf zu ihm hoch und er dachte: „Wenn ich nur einen Topf hätte, könnte ich ein wenig Milch trinken.“
Er schaute die Kuh an und die Kuh schaute ihn an und plötzlich trat er sie in die Seite und sagte: „Steh auf!
Das Tier erhob sich langsam und ließ sein schweres Euter unter sich hängen, dann legte sich der Mann auf den Rücken zwischen die Beine des Tieres und er trank, lange, lange, und drückte mit beiden Händen das geschwollene, warme und nach Stall riechende Euter. Er trank so lange, bis noch Milch in dieser lebendigen Quelle übrig war.
Aber der eisige Regen fiel dichter und die ganze Ebene war kahl und bot ihm keine Zuflucht. Ihm war kalt und er blickte auf ein Licht, das zwischen den Bäumen am Fenster eines Hauses leuchtete.
Die Kuh hatte sich schwerfällig wieder hingelegt. Er setzte sich neben sie und streichelte ihren Kopf, dankbar, dass er gefüttert worden war. Der dicke und starke Atem des Tieres, der aus seinen Nüstern kam wie zwei Dampfstrahlen in der Abendluft, strich über das Gesicht des Arbeiters, der zu sagen begann: „Da drin ist dir nicht kalt.“
Jetzt fuhr er mit seinen Händen über die Brust und unter die Beine, um dort Wärme zu finden. Dann kam ihm die Idee, sich hinzulegen und die Nacht an diesem großen, warmen Bauch zu verbringen. Er suchte sich einen Platz, um sich wohl zu fühlen und legte seine Stirn an die mächtige Zitze, die ihn zuvor getränkt hatte. Dann schlief er plötzlich ein, da er von der Müdigkeit überwältigt war.
Aber mehrmals wachte er auf und sein Rücken oder Bauch war eiskalt, je nachdem, ob er das eine oder das andere auf die Seite des Tieres legte; dann drehte er sich um, um den Teil seines Körpers, der in der Nachtluft geblieben war, zu wärmen und zu trocknen; und bald schlief er wieder in seinen bedrückenden Schlaf.
Ein krähender Hahn ließ ihn aufstehen. Die Morgendämmerung brach an, es regnete nicht mehr und der Himmel war rein.
Die Kuh lag mit dem Rüssel auf dem Boden und er beugte sich vor, stützte sich auf seine Hände, um das große Nasenloch mit dem feuchten Fleisch zu küssen und sagte: „Leb wohl, meine Schöne… bis ein anderes Mal… du bist ein gutes Tier…“. Adieu…“
Dann zog er seine Schuhe an und ging.
Zwei Stunden lang ging er vor sich hin und folgte immer demselben Weg, aber dann wurde er so müde, dass er sich ins Gras setzte.
Der Tag war angebrochen, die Kirchenglocken läuteten, Männer in blauen Kitteln und Frauen in weißen Mützen, entweder zu Fuß oder auf Karren, begannen die Wege zu passieren, auf dem Weg in die umliegenden Dörfer, um den Sonntag bei Freunden und Verwandten zu feiern.
Ein dicker Bauer erschien und trieb etwa zwanzig unruhige, blökende Schafe vor sich her, die von einem flinken Hund in einer Herde gehalten wurden.
Randel stand auf und grüßte: „Sie haben nicht zufällig Arbeit für einen hungernden Arbeiter“, sagte er.
Der andere antwortete und warf dem Wanderer einen bösen Blick zu:
– Ich habe keine Arbeit für die Menschen, die ich auf der Straße treffe.
Der Zimmermann ging zurück und setzte sich auf den Graben.
Er wartete lange, sah die Landbewohner an sich vorbeiziehen und suchte nach einem guten Gesicht, einem mitfühlenden Gesicht, um sein Gebet zu wiederholen.
Er wählte eine Art Bürger im Gehrock, dessen Bauch mit einer goldenen Kette geschmückt war.
– Ich suche seit zwei Monaten nach Arbeit“, sagte er. Ich finde nichts und ich habe keinen Pfennig mehr in meiner Tasche.
Der halbe Herr erwiderte: „Sie hätten den Hinweis am Eingang des Landes lesen sollen. – Betteln ist auf dem Gebiet der Gemeinde verboten. – Sie sollten wissen, dass ich der Bürgermeister bin und wenn Sie nicht bald abhauen, werde ich Sie einsammeln lassen“.
Randel wurde wütend und murmelte: „Lassen Sie mich aufheben, wenn Sie wollen, das ist mir lieber, dann muss ich wenigstens nicht verhungern“.
Dann setzte er sich wieder auf seinen Graben.
Nach einer Viertelstunde erschienen tatsächlich zwei Gendarmen auf der Straße. Sie gingen langsam nebeneinander, gut sichtbar, glänzend in der Sonne mit ihren gewachsten Hüten, gelben Büffeln und Metallknöpfen, als wollten sie die Verbrecher erschrecken und sie von weit, weit weg in die Flucht schlagen.
Der Zimmermann verstand, dass sie wegen ihm kamen, aber er rührte sich nicht, da er plötzlich von einem dumpfen Verlangen ergriffen wurde, ihnen zu trotzen, von ihnen erwischt zu werden und sich später zu rächen.
Sie näherten sich, ohne ihn zu sehen, und gingen mit ihrem militärischen Schritt, schwer und schwankend wie der Marsch der Gänse. Plötzlich, als sie an ihm vorbeikamen, schienen sie ihn zu entdecken, blieben stehen und starrten ihn mit einem drohenden und wütenden Blick an.
Der Brigadier trat vor und fragte:
– Was machen Sie hier?
Der Mann antwortete ruhig:
– Ich ruhe mich aus.
– Woher kommen Sie?
– Wenn ich Ihnen alle Länder erzählen müsste, in denen ich gewesen bin, würde ich mehr als eine Stunde brauchen.
– Wohin gehen Sie?
– Nach Ville-Avaray.
– Wo ist das?
– In der Manche.
– Ist das Ihr Land?
– Das ist mein Land.
– Warum sind Sie von dort weggegangen?
– Um Arbeit zu suchen.
Der Brigadier drehte sich zu seinem Gendarmen um und sagte mit dem zornigen Tonfall eines Mannes, den die gleiche Täuschung schließlich zur Verzweiflung bringt:
– Das sagen sie alle, diese Kerle. Aber ich kenne sie.
Dann fuhr er fort:
– Haben Sie einen Ausweis?
– Ja, ich habe welche.
– Geben Sie sie mir.
Randel nahm seine Papiere aus der Tasche, seine Zeugnisse, arme, abgenutzte und schmutzige Papiere, die in Stücke zerfielen, und reichte sie dem Soldaten.
Der andere buchstabierte sie und murmelte etwas vor sich hin, dann stellte er fest, dass sie in Ordnung waren und gab sie mit dem verärgerten Gesichtsausdruck eines Mannes zurück, der gerade von einem Klügeren ausgespielt wurde.
Nach einiger Zeit des Nachdenkens fragte er erneut:
– Haben Sie Geld bei sich?
– Nein.
– Haben Sie nichts?
– Nichts.
– Nicht einmal einen Cent?
– Nicht einen einzigen Cent!
– Wovon leben Sie dann?
– Von dem, was man mir gibt.
– Sie haben also gebettelt?
Randel antwortete entschlossen:
– Ja, wenn ich kann.
Aber der Gendarm sagte: „Ich ertappe Sie auf frischer Tat beim Herumlungern und Betteln, ohne Mittel und ohne Beruf, auf der Straße und ich fordere Sie auf, mir zu folgen.“
Der Zimmermann stand auf.
– Wann immer Sie wollen“, sagte er.
Und er stellte sich zwischen die beiden Soldaten, bevor er den Befehl dazu erhielt, und fügte hinzu:
– Los, nehmen Sie mich fest. So habe ich ein Dach über dem Kopf, wenn es regnet.
Sie gingen in Richtung des Dorfes, dessen Dachziegel man durch die blattlosen Bäume in einer Entfernung von einer Viertelmeile sehen konnte.
Es war die Zeit der Messe, als sie durch das Land fuhren. Der Platz war voll von Menschen und zwei Hecken bildeten sich, um den Verbrecher vorbeigehen zu sehen, dem eine Gruppe aufgeregter Kinder folgte. Die Bauern und Bäuerinnen sahen ihn an, diesen Mann, der zwischen zwei Gendarmen verhaftet wurde, mit Hass in den Augen und dem Wunsch, ihn mit Steinen zu bewerfen, ihm die Haut mit den Fingernägeln abzureißen und ihn unter ihren Füßen zu zerquetschen. Man fragte sich, ob er gestohlen und getötet hatte. Der Metzger, ein ehemaliger Spahi, sagte: „Er ist ein Deserteur“. Der Tabakhändler glaubte, ihn als einen Mann zu erkennen, der ihm am Morgen eine falsche 50-Cent-Münze zugesteckt hatte, und der Eisenwarenhändler sah in ihm zweifellos den unauffindbaren Mörder der Witwe Malet, nach dem die Polizei seit sechs Monaten gesucht hatte.
Im Ratssaal, in den ihn seine Bewacher brachten, fand Randel den Bürgermeister vor, der am Beratungstisch saß und vom Lehrer flankiert wurde.
– Ah! Ah!“, rief der Magistrat, „da sind Sie ja wieder, mein Freund. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Sie einbuchten lassen würde. Nun, Brigadier, was ist das?
Der Brigadier antwortete: „Ein Landstreicher ohne Feuer und Ort, Herr Bürgermeister, ohne Mittel und ohne Geld, wie er behauptet, verhaftet im Zustand des Bettelns und der Landstreicherei, mit guten Zeugnissen und ordentlichen Papieren.“
– Zeigen Sie mir diese Papiere“, sagte der Bürgermeister. Er nahm sie, las sie, las sie noch einmal, gab sie zurück und befahl dann: „Durchsuchen Sie ihn“. Randel wurde durchsucht, aber es wurde nichts gefunden.
Der Bürgermeister schien verwirrt zu sein. Er fragte den Arbeiter:
– Was haben Sie heute Morgen auf der Straße gemacht?
– Ich war auf der Suche nach Arbeit.
– Nach Arbeit? Auf der Hauptstraße?
– Wie soll ich denn Arbeit finden, wenn ich mich im Wald verstecke?
Beide starrten sich mit dem Hass von Tieren feindlicher Rassen an. Der Magistrat sagte: „Ich werde Sie auf freien Fuß setzen, aber lassen Sie sich nicht wieder erwischen.
Der Zimmermann antwortete: „Ich möchte lieber, dass Sie mich behalten. Ich habe es satt, auf den Straßen zu laufen.
Der Bürgermeister machte ein ernstes Gesicht:
– Seien Sie still.
Dann befahl er den Gendarmen:
– Bringen Sie den Mann 200 Meter vom Dorf weg und lassen Sie ihn seinen Weg fortsetzen.
Der Arbeiter sagte: „Lassen Sie mir wenigstens etwas zu essen geben“.
Der andere war entrüstet: „Sie müssen nur noch gefüttert werden! Ah, ah, ah, ah, das ist ein starker Mann.
Aber Randel fuhr fort: „Wenn Sie mich wieder verhungern lassen, werden Sie mich zwingen, einen schlechten Job zu machen. So viel zu euch fetten Leuten.“
Der Bürgermeister war aufgestanden und wiederholte: „Führen Sie ihn schnell ab, denn ich werde sonst wütend“.
Die beiden Gendarmen packten den Zimmermann an den Armen und zogen ihn mit sich. Er ließ es geschehen, ging durch das Dorf und fand sich auf der Straße wieder und als die Männer ihn 200 Meter vor den Kilometerstein brachten, sagte der Brigadier: „Ich habe es geschafft:
– Hier, gehen Sie und lassen Sie sich nicht mehr blicken, sonst hören Sie von mir.
Randel ging los, ohne etwas zu erwidern und ohne zu wissen, wohin er ging. Er ging eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten vor sich hin und war so verblödet, dass er an nichts mehr dachte.
Aber plötzlich, als er an einem kleinen Haus mit einem offenen Fenster vorbeikam, stieg ihm der Geruch von Eintopf in die Brust und ließ ihn vor diesem Haus stehen bleiben.
Plötzlich hob ihn der Hunger, ein wilder, verzehrender, panischer Hunger, der ihn fast wie ein Unmensch gegen die Mauern dieses Hauses warf.
Er sagte laut und mit knurrender Stimme: „Um Himmels willen, ich muss es diesmal bekommen“. Und er begann, mit seinem Stock gegen die Tür zu schlagen. Als niemand antwortete, klopfte er stärker und rief: „Hey, hey, hey, hey, Leute da drinnen, hey, macht auf!
Nichts rührte sich, also ging er zum Fenster und drückte es mit der Hand auf und die verschlossene Luft der Küche, die warme Luft mit dem Duft von heißer Brühe, gekochtem Fleisch und Kohl, entwich in die kalte Luft draußen.
Mit einem Sprung war der Zimmermann im Raum. Zwei Gedecke waren auf einem Tisch gedeckt. Die Hausbesitzer, die wahrscheinlich zur Messe gegangen waren, hatten ihr Abendessen auf dem Herd stehen lassen, das gute Sonntagsessen mit der fetten Gemüsesuppe.
Ein frisches Brot wartete auf dem Kamin zwischen zwei Flaschen, die voll zu sein schienen.
Randel stürzte sich zuerst auf das Brot, brach es so heftig, als ob er einen Menschen erwürgt hätte, und begann dann, es in großen Bissen zu essen, die er schnell hinunterschluckte. Der Geruch von Fleisch zog ihn zum Kamin und nachdem er den Deckel des Topfes abgenommen hatte, steckte er eine Gabel hinein und zog ein großes Stück Rindfleisch heraus, das mit einer Schnur zusammengebunden war. Dann nahm er noch mehr Kohl, Karotten und Zwiebeln, bis sein Teller voll war, stellte ihn auf den Tisch, setzte sich davor, teilte das gekochte Fleisch in vier Teile und aß, als wäre er zu Hause. Als er fast das ganze Gericht und eine Menge Gemüse verzehrt hatte, bemerkte er, dass er durstig war und holte eine der Flaschen, die auf dem Kamin standen.
Als er die Flüssigkeit in seinem Glas sah, erkannte er, dass es sich um Brandy handelte. Was soll’s, es war heiß, es würde Feuer in seine Adern bringen, es würde gut schmecken, nachdem ihm so kalt war, und er trank.
Er fand es tatsächlich gut, denn er hatte die Gewohnheit daran verloren und goss sich erneut ein volles Glas ein, das er in zwei Schlucken hinunterspülte. Und fast sofort fühlte er sich fröhlich, vom Alkohol beglückt, als ob ein großes Glück in seinen Bauch geflossen wäre.
Er aß weiter, langsamer, kaute langsam und tauchte sein Brot in die Brühe. Die ganze Haut seines Körpers war heiß geworden, besonders seine Stirn, wo das Blut pulsierte.
Aber plötzlich bimmelte eine Glocke in der Ferne. Es war die Messe, die zu Ende ging und eher ein Instinkt als eine Angst, der Instinkt der Vorsicht, der alle Wesen in Gefahr leitet und scharfsinnig macht, ließ den Zimmermann aufstehen, er steckte den Rest des Brotes in eine Tasche, die Flasche Schnaps in die andere und ging mit schnellen Schritten zum Fenster und schaute auf die Straße.
Sie war immer noch leer. Er sprang auf und ging weiter, aber anstatt dem breiten Weg zu folgen, flüchtete er über die Felder zu einem Wald, den er sehen konnte.
Er fühlte sich wachsam, stark, fröhlich, zufrieden mit dem, was er getan hatte und war so geschmeidig, dass er mit einem Satz über die Zäune der Felder sprang.
Sobald er unter den Bäumen war, zog er die Flasche wieder aus der Tasche und trank wieder in großen Schlucken, während er weiterging. Seine Gedanken verschwammen, seine Augen wurden trübe und seine Beine waren elastisch wie Federn.
Er sang das alte Volkslied:
Ach, wie schön ist es doch!
Wie schön ist es doch, Erdbeeren zu pflücken!
Die Erdbeere pflücken.
Er ging nun auf einem dicken, feuchten und kühlen Moos und dieser weiche Teppich unter seinen Füßen ließ ihn wie ein Kind Purzelbäume schlagen.
Er nahm Anlauf, schlug Kapriolen, stand wieder auf und begann von vorne. Und zwischen jedem Purzelbaum begann er wieder zu singen:
Ach, wie schön ist es doch!
Wie schön ist es doch, Erdbeeren zu pflücken!
Die Erdbeere pflücken.
Plötzlich stand er am Rand eines Hohlweges und sah im Hintergrund ein großes Mädchen, eine Magd, die ins Dorf zurückkehrte, mit zwei Milcheimern in den Händen, die durch einen Fassring von ihr getrennt waren.
Er hielt nach ihr Ausschau, beugte sich vor und seine Augen leuchteten wie die eines Hundes, der eine Wachtel sieht.
Sie entdeckte ihn, hob den Kopf, lachte und rief ihm zu:
– Sind Sie das, der so singt?
Er antwortete nicht und sprang in die Schlucht, obwohl die Böschung mindestens sechs Fuß hoch war.
Als sie ihn plötzlich vor sich stehen sah, sagte sie: „Cristi, Sie haben mich erschreckt“.
Aber er hörte sie nicht, er war betrunken, er war verrückt, angetrieben von einer anderen Wut, die mehr verzehrte als der Hunger, vom Alkohol, von der unwiderstehlichen Wut eines Mannes, dem es seit zwei Monaten an allem fehlt, und der grau ist, und der jung ist, glühend, verbrannt von all den Appetitanregungen, die die Natur in das kräftige Fleisch der Männer gesät hat.
Das Mädchen wich vor ihm zurück, erschrocken über sein Gesicht, seine Augen, seinen halb geöffneten Mund, seine ausgestreckten Hände.
Er packte sie an den Schultern und stieß sie, ohne ein Wort zu sagen, auf den Weg.
Sie ließ ihre Eimer fallen, die mit einem lauten Knall umherrollten und ihre Milch verschütteten, dann schrie sie, dann verstand sie, dass es nichts bringen würde, in dieser Wüste zu rufen, und sah nun, dass er ihr nicht nach dem Leben trachtete, und gab ohne große Mühe nach, nicht sehr wütend, denn er war stark, der Kerl, aber wirklich zu brutal.
Als sie sich wieder aufgerichtet hatte, erfüllte sie der Gedanke an die verschütteten Eimer mit Wut und sie zog ihren Huf mit einem Fuß aus und ging auf den Mann los, um ihm den Kopf einzuschlagen, wenn er nicht für seine Milch bezahlen würde.
Aber er verstand den heftigen Angriff nicht, war etwas ernüchtert, verzweifelt und erschrocken über das, was er getan hatte, und rannte mit der ganzen Geschwindigkeit seiner Beine davon, während sie mit Steinen nach ihm warf, von denen einige ihn im Rücken trafen.
Er lief lange, lange und fühlte sich dann so müde wie noch nie zuvor. Seine Beine wurden so weich, dass sie ihn nicht mehr tragen konnten; alle seine Gedanken waren verschwommen, er konnte sich an nichts mehr erinnern, er konnte an nichts mehr denken.
Er setzte sich an den Fuß eines Baumes.
Nach fünf Minuten schlief er.
Er wurde durch einen lauten Schlag geweckt und als er die Augen öffnete, sah er zwei Lacklederdreispitze über ihn gebeugt und die beiden Gendarmen vom Morgen, die seine Arme festhielten und fesselten.
– Ich wusste, dass ich Sie wiedererkennen würde“, sagte der Brigadier spöttisch.
Randel stand auf, ohne ein Wort zu sagen. Die Männer schüttelten ihn und waren bereit, ihn zu schikanieren, wenn er eine Bewegung machte, denn er war jetzt ihre Beute, er war zu Gefängniswild geworden, gefangen von diesen kriminellen Jägern, die ihn nicht mehr loslassen würden.
– Auf geht’s!“, befahl der Gendarm.
Sie machten sich auf den Weg. Der Abend kam und legte eine schwere und unheimliche Herbstdämmerung über das Land.
Nach einer halben Stunde erreichten sie das Dorf.
Alle Türen standen offen, da man von den Ereignissen wusste. Die Bauern und Bäuerinnen waren wütend, als ob jeder bestohlen und jeder vergewaltigt worden wäre, und wollten den Unglücklichen zurückkehren sehen, um ihn zu beschimpfen.
Es war ein Buh-Ruf, der beim ersten Haus begann und beim Rathaus endete, wo auch der Bürgermeister wartete, der sich an dem Landstreicher gerächt hatte.
Als er ihn sah, rief er schon von weitem:
– Ah, mein Freund, wir sind da.
Er rieb sich die Hände und war zufrieden, wie er es selten war.
Er fuhr fort: „Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, als ich ihn auf der Straße gesehen habe.
Und dann, mit doppelter Freude, sagte er:
– Ah, du Schurke, ah, du dreckiger Schurke, du bist 20 Jahre alt, mein Junge!
(Neuübersetzung 2022: Alle Rechte vorbehalten)