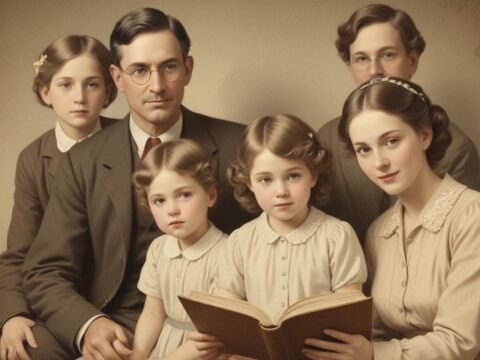Der C.H. Beck Verlag präsentiert eine Neuausgabe von Christoph Martin Wielands bemerkenswertem Werk „Geschichte des Prinzen Biribinker“. Diese Erzählung, die im Kontext der Aufklärung verfasst wurde, bietet nicht nur einen tiefen Einblick in die Herausforderungen der Pubertät, sondern auch eine amüsante und kritische Auseinandersetzung mit Märchenkonventionen. Der Roman, der erstmals im Jahr 1764 veröffentlicht wurde, hat im Laufe der Jahrhunderte an Bedeutung gewonnen und verdient es, neu entdeckt zu werden.
Wieland eröffnet seine Erzählung mit einem klassischen Märchenbeginn: Ein König und eine Königin freuen sich über die Geburt ihres Sohnes, des Thronfolgers, und bemühen sich, ihm eine glückliche Kindheit zu bereiten. Anstelle einer der zahlreichen Bewerberinnen für das Amt der Amme wählt die Königin eine Fee, die in der Gestalt einer dicken Biene auftritt. Diese Entscheidung führt zu Besorgnis im Volk, da die Königin die Amme einer weiteren, weniger vorteilhaften Fee, die als Ziege erscheint, vorzieht. Um dem Prinzen den besten Start ins Leben zu ermöglichen, wird der weiße Zauberer Caramussal konsultiert, der den geheimnisvollen Namen Biribinker vorschlägt. Zudem wird der Prinz in einem geschützten Bienenstock aufgezogen, um ihn vor der Fee Caprosine zu bewahren, die ihm in Form eines Milchmädchens begegnen wird.
Wie es in vielen Märchen der Fall ist, wird Biribinker jedoch unzufrieden mit seinem geschützten Lebensstil. Mit Hilfe einer Hummel, die unter dem Druck der Bienenkönigin leidet, gelingt ihm im Alter von 17 Jahren die Flucht. Auf seiner Reise zu einem verzauberten Schloss trifft er auf das Milchmädchen, in das er sich sofort verliebt. Doch sie flieht, als sie seinen Namen hört, und so beginnt Biribinkers Suche nach der wahren Liebe und seiner eigenen Identität.
Wieland entfaltet in dieser Erzählung die Schwierigkeiten eines heranwachsenden Jugendlichen, der zwischen seinen Sehnsüchten und den Erwartungen der Gesellschaft hin- und hergerissen ist. Auf seiner Reise begegnet Biribinker zahlreichen verzauberten Frauenfiguren, die ihm sowohl seine sexuelle Neugier als auch die Komplexität der zwischenmenschlichen Beziehungen näherbringen. Diese Figuren sind nicht nur schön, sondern auch selbstbewusst und fordern den Prinzen heraus, über seine Vorstellungen von Liebe und Verlangen nachzudenken.
Ein zentrales Motiv in der Geschichte ist die Selbsttäuschung des Prinzen. Trotz seiner literarischen Kenntnisse über Liebe ist er in der Realität unerfahren. Wieland beschreibt Biribinkers innere Konflikte auf humorvolle Weise und zeigt, wie er versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Die Ondine, eine seiner Begegnungen, macht ihm deutlich, dass es nicht genügt, über Leidenschaft zu reden, um eine Verbindung herzustellen. Sie fordert ihn auf, ehrlich und direkt zu sein, was die Konventionen der Liebesdarstellung des 18. Jahrhunderts humorvoll reflektiert.
Wielands Erzählweise kombiniert verschiedene Elemente aus Märchen und Satire. Er hinterfragt die üblichen Gattungsmerkmale, indem er Übertreibungen und absurde Situationen einführt. Ein sprechender Kürbis wünscht dem Prinzen beispielsweise einen Ausgang, den es in keinem Märchen zuvor gegeben hat. Diese spielerische Herangehensweise an das Erzählen macht das Werk sowohl unterhaltsam als auch tiefgründig. Jan Philipp Reemtsma, ein Wieland-Experte, beschreibt die Erzählung als ein Möbiusband, das sich in sich selbst schlingt und die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt.
Die Neuausgabe von „Geschichte des Prinzen Biribinker“ ermöglicht es, Wielands kreativen Geist und seine Fähigkeit, humorvolle und tiefgründige Geschichten zu erzählen, neu zu würdigen. Der historische Duktus und die ungewohnte Schreibweise könnten heutige Leser zwar zunächst herausfordern, doch sie verleihen dem Werk einen besonderen Charme. Es bleibt zu hoffen, dass diese Neuauflage dazu beiträgt, Christoph Martin Wielands literarisches Erbe wieder ins Bewusstsein zu rücken und ein breiteres Publikum zu erreichen.