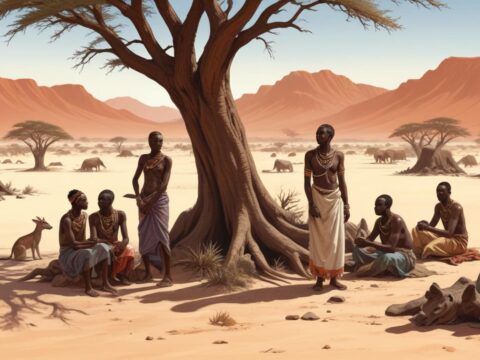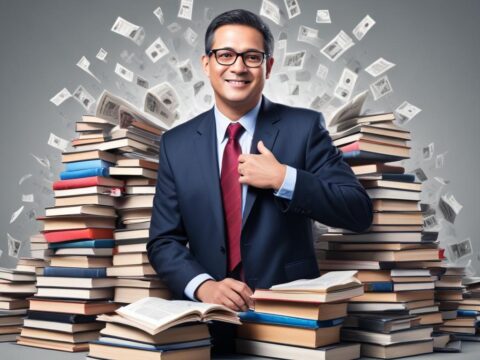In seinem Werk „Irrläufe. Herta Müllers Poetik des Eigen-Sinns“ widmet sich Norbert Otto Eke intensiv der literarischen Welt der Nobelpreisträgerin Herta Müller. Eke, der als Literaturprofessor in Paderborn tätig ist, beleuchtet die verschiedenen Aspekte von Müllers Schaffen und den Einfluss ihrer Erfahrungen in einem repressiven Regime auf ihre Literatur. Das Buch ist eine umfassende Analyse, die sich sowohl an ein akademisches Publikum als auch an interessierte Laien richtet und wertvolle Einblicke in Müllers Poetik bietet.
Herta Müller gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der rumäniendeutschen Literatur und ist besonders bekannt für ihre Auseinandersetzung mit der Diktatur in Rumänien. Eke strukturiert seine Untersuchung in zwei Hauptteile: Im ersten Teil mit dem Titel „Eigen / Sinn: Poetik“ analysiert er die grundlegenden Elemente von Müllers literarischer Poetik. Der zweite Teil trägt den Titel „Narrative Ordnungen: Chronotopografien der Repression“ und widmet sich der konkreten Umsetzung dieser Poetik in ihren Erzählungen und Gedichten, stets im Kontext der autokratischen Lebensverhältnisse, die Müller geprägt haben.
Ein zentrales Thema in Ekes Analyse ist die Art und Weise, wie Müllers literarisches Werk vom Erinnern und dessen ästhetischer Transformation geprägt ist. Eke zitiert Aleida Assmann, um zu verdeutlichen, dass Zeichen, die aus den gewohnten Ordnungen entlassen werden, neue, unerwartete Verbindungen eingehen können. Dies führt zu einer subversiven und innovativen Schreib- und Lesepraxis, die in Müllers Werk deutlich wird. Ein Beispiel hierfür ist ihr Gedicht „Wer hat den Vagabundenhund erfunden“, das die surrealen und oft verstörenden Elemente ihrer Sprache verdeutlicht. Eke beschreibt, wie die Verschmelzung von Bildern und Begriffen in Müllers Texten zu einem Gefühl der Beklemmung führt, das aber auch Raum für Humor und das Ungesagte lässt.
Eke hebt hervor, dass Müllers Kunst in der Lage ist, die Realität auf eine Weise abzubilden, die oft „wahrer“ ist als die Realität selbst. Während die Politik und Geschichtsschreibung oft Gefahr laufen, in die Irre zu führen oder Fakten zu verzerren, bietet die Literatur einen Raum für „ästhetische Setzungen“, die durch den kreativen Prozess zu einer tieferen Wahrheit führen. Müller selbst betont, dass „die Wahrheit der geschriebenen Erinnerung erfunden werden muss“, was die transformative Kraft ihrer Kunst unterstreicht.
Ein weiterer Aspekt, den Eke untersucht, ist Müllers Beziehung zur Musik und zu folkloristischen Elementen. Er stellt fest, dass Müller eine kritische Haltung gegenüber der rumänischen Folklore einnimmt, da sie diese für unvereinbar mit den autokratischen Strukturen hält. Eke thematisiert auch die Erzählbarkeit von Diktaturerfahrungen, die für Müllers Werk von zentraler Bedeutung sind. Dabei analysiert er Konzepte wie „Entzeitlichung“ und „Entortung“ und diskutiert, wie diese Themen in den Machtstrukturen ihrer Erzählungen reflektiert werden.
Die Rolle von Angst und deren Verbindung zu Macht wird von Eke ebenfalls ausführlich behandelt. Frauen sind in Müllers Schilderungen oft doppelt betroffen, da sie sowohl unter dem totalitären Regime als auch unter patriarchalischen Strukturen leiden. Eke widmet diesem Thema ein eigenes Kapitel, in dem er die komplexen Beziehungen zwischen Angst, Tradition und Intimität beleuchtet. Er beschreibt, wie die staatliche Kontrolle bis in die privatesten Bereiche des Lebens hineinreicht und wie Müller in ihren Texten die Praxis einer „lieblosen Erotik“ darstellt.
Abschließend lässt sich sagen, dass Ekes Studie nicht nur Müllers literarisches Werk in seiner Gesamtheit betrachtet, sondern auch die lyrischen und bildnerischen Elemente ihrer Arbeit in den Fokus rückt. Dies ist besonders wertvoll, da viele frühere Analysen sich überwiegend auf ihre Romane konzentrierten. Eke gelingt es, die Verbindung zwischen Müllers Gedichten und ihrer übergreifenden poetischen Vision aufzuzeigen, wodurch er ein tieferes Verständnis für die Komplexität ihrer Kunst vermittelt.
Insgesamt bietet „Irrläufe. Herta Müllers Poetik des Eigen-Sinns“ einen tiefen Einblick in das literarische Schaffen von Herta Müller und die Bedingungen, unter denen sie arbeitet. Es ist eine fundierte und einfühlsame Auseinandersetzung mit einer der bedeutendsten Stimmen der zeit