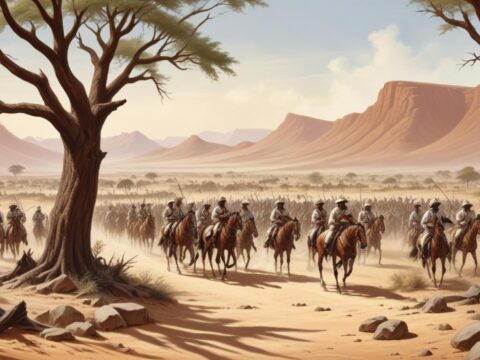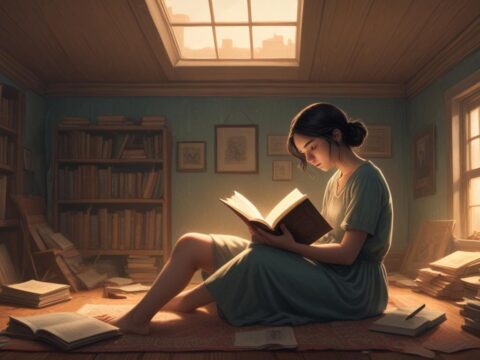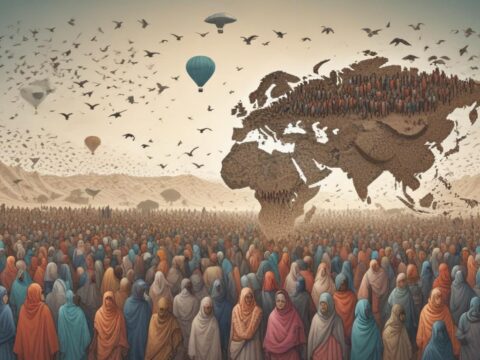Anlässlich des 125. Geburtstags von Anna Seghers wurden bisher unveröffentlichte Liebesbriefe der Autorin veröffentlicht, die einen faszinierenden Einblick in ihr inneres Leben und ihre romantischen Gefühle bieten. Diese Briefe stammen aus der Zeit, als die junge Netty Reiling, wie Seghers ursprünglich hieß, eine leidenschaftliche Beziehung zu László Radványi, einem ungarischen Emigranten, pflegte. Die Entdeckung und Veröffentlichung dieser Briefe durch ihren Enkel, Jean Radványi, in Zusammenarbeit mit der Literaturwissenschaftlerin Christiane Zehl Romero, bringt die Leser näher an die persönlichen und politischen Umstände heran, die das Leben und Werk der Schriftstellerin prägten.
Netty Reiling wurde am 19. November 1900 in Mainz geboren und wuchs als Einzelkind in einer bürgerlichen jüdischen Familie auf. Ihr Vater, Isidor Reiling, war ein angesehener Kunsthistoriker und Kunsthändler. Im Jahr 1920 begann sie in Heidelberg ein Studium in Kunst- und Kulturgeschichte sowie Sinologie, wo sie László Radványi traf. Von Beginn an war die Anziehung zwischen den beiden spürbar, und sie verliebte sich in den charismatischen Studenten. Radványi, der aus einer aufgeklärten jüdischen Kaufmannsfamilie stammte und bereits in Budapest studiert hatte, war ein politisch engagierter junger Mann, der nach der Niederschlagung der Ungarischen Räterepublik nach Deutschland geflohen war.
Die Briefe, die zwischen 1921 und 1925 verfasst wurden, dokumentieren eine intensive Liebesgeschichte, die von Hoffnungen, Ängsten und familiären Konflikten geprägt war. Besonders der familiäre Druck auf Netty war enorm, da ihre Eltern, insbesondere ihr Vater, gegen die Beziehung zu dem mittellosen Studenten waren. Trotz dieser Widerstände und ihrer starken Bindung zu ihrer Mutter war Netty entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen und mit Radványi zu leben. Ihre Zuneigung zu ihm spiegelt sich in den vielen Kosenamen wider, die sie ihm in ihren Briefen verleiht.
Ein zentrales Thema in diesen Korrespondenzen ist die Angst vor der Abweisung und der Ungewissheit über die Zukunft. Netty Reiling zeigt sich in ihren Briefen als eine junge Frau, die zwischen ihrer Liebe und den Erwartungen ihrer Eltern hin- und hergerissen ist. Sie gibt Radványi Ratschläge, wie er sich in Gesprächen mit ihrer Familie verhalten solle, um Konflikte zu vermeiden, und sie äußert häufig ihre Sorgen um seine berufliche Zukunft, da er Schwierigkeiten hatte, eine Anstellung zu finden. Diese Briefe sind nicht nur romantische Botschaften, sondern auch Dokumente einer jungen Frau, die ihren Platz in der Welt finden will.
Im Jahr 1925, nach vielen Auseinandersetzungen mit ihrer Familie, heirateten Netty und László in einer Zeremonie, die den jüdischen Traditionen entsprach. Die Briefe zeigen auch, wie eng Netty Reilings politisches Denken mit ihrer jüdischen Identität verknüpft war. Zu dieser Zeit war sie noch kein Mitglied der Kommunistischen Partei, während ihr Mann bereits aktiv war. Diese politischen Überzeugungen und die sozialen Umstände, in denen sie lebten, beeinflussten nicht nur ihr persönliches Leben, sondern auch ihre späteren literarischen Werke.
Die Briefe, die in dem Band „Ich will Wirklichkeit“ veröffentlicht wurden, zeigen eine emotionale und verletzliche Seite von Anna Seghers, die später oft als distanziert beschrieben wurde. Diese Sammlung bietet einen einzigartigen Einblick in die Anfänge ihrer schriftstellerischen Karriere und die tiefen Gefühle, die sie für Radványi hegte. Ihre Beziehung überstand die Herausforderungen des Exils während der nationalsozialistischen Herrschaft und die Jahre in Mexiko, bis zum Tod von László Radványi im Jahr 1978.
Die Neuerscheinung enthält nicht nur die Briefe, sondern auch ein umfangreiches Nachwort von Jean Radványi, das den familiären Hintergrund sowie die politischen und sozialen Herausforderungen seiner Großeltern beleuchtet. Diese Briefe sind ein wertvoller Beitrag zur literarischen und autobiographischen Forschung und gewähren den Lesern einen intimen Blick auf die Gefühlswelt einer der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts.