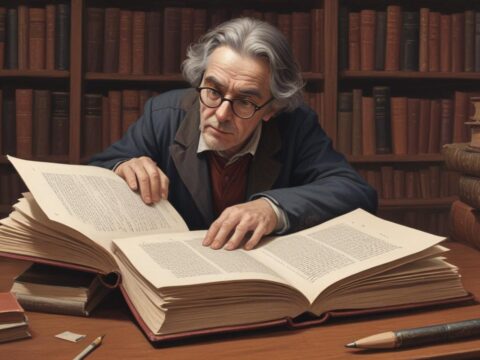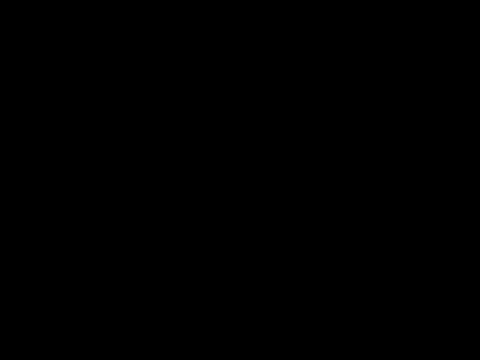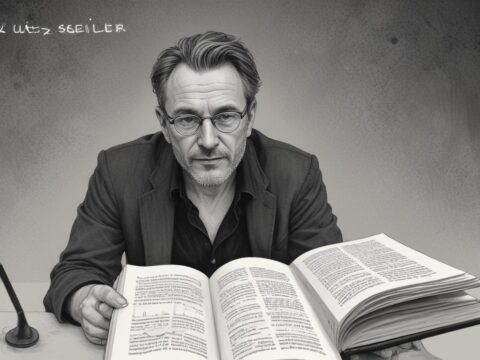Sayaka Muratas Roman „Schwindende Welt“, der im japanischen Original 2015 erschien und in Deutschland 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den sich wandelnden sozialen Normen und Werten der modernen Gesellschaft. Die Autorin, die bereits durch ihren Bestseller „Die Ladenhüterin“ international Beachtung fand, entblößt in diesem dystopischen Werk die Fragilität der menschlichen Überzeugungen und Lebensmodelle. Murata führt ihre Leser in eine Zukunft, in der die traditionellen Vorstellungen von Familie, Beziehung und Sexualität einer radikalen Umformung unterzogen werden und aufzeigt, wie diese Veränderungen den Einzelnen entmenschlichen können.
Die Handlung des Romans ist in drei Teile untergliedert und beginnt mit einem Dialog zwischen der zwanzigjährigen Protagonistin Amane und ihrem Freund. Während sie im Bett liegen, äußert ihr Partner, dass Amane vermutlich die letzte Person sei, die noch sexuelle Erfahrungen macht, da die Menschheit in einen neuen, sanitär und kollektiv orientierten Zustand eingetreten ist. Diese neue Ordnung hat die alten, biologisch verankerten Lebensmodelle verdrängt. Die intime Beziehung zwischen den Geschlechtern wird durch staatliche Regulierungen kontrolliert, die vor allem darauf abzielen, die Reproduktion zu beschränken.
Im zweiten Teil des Romans wird Amanes Leben nach ihrer Heirat mit Saku geschildert, die in einer Welt lebt, in der Privatheit und Individualität zunehmend verschwinden. Ihre Ehe wird von einer Art emotionaler Kälte geprägt, in der intime Beziehungen außerhalb der Ehe stattfinden und die Fortpflanzung durch Anonymität und technologische Interventionen ersetzt wird. Amane empfindet Scham über ihre eigene Entstehung, da sie auf traditionellem Wege gezeugt wurde, während die vorherrschenden Normen dieser Praxis abträglich gegenüberstehen.
Die dritte Phase des Romans führt das Paar in die idealisierte Stadt Experimenta, die als Modell für eine zukünftige Gesellschaft dient. Hier wird die Entfremdung zwischen Amane und Saku weiter verstärkt, als Saku zum ersten Mann wird, der ein Kind in einer künstlichen Gebärmutter austrägt. Murata beschreibt die grotesken Aspekte dieser neuen Normalität eindringlich, etwa durch die Darstellung von Saku, dessen Körper von medizinischen Apparaturen geprägt ist. In Experimenta wird das Kind, das sie zeugen, nicht von den biologischen Eltern aufgezogen, sondern in einem Kollektiv, was die Auflösung traditioneller Familienstrukturen symbolisiert.
Die dystopische Vision Muratas zeigt sich in der erschreckenden Gleichschaltung der Gesellschaft, in der individuelle Merkmale, sexuelle Identität und zwischenmenschliche Bindungen systematisch eliminiert werden. Die Kinder in Experimenta sind nicht nur androgyn, sondern auch in ihrer Mimik und ihrem Verhalten uniformiert, was auf die vollständige Entindividualisierung hinweist. Murata illustriert die grotesken Ergebnisse dieser neuen Normalität, indem sie die Leser mit Bildern konfrontiert, die sowohl faszinierend als auch verstörend sind.
Am Ende des Romans findet eine dramatische Enthüllung statt, die die verheerenden Konsequenzen dieser gesellschaftlichen Transformation offenbart. Murata lässt Amane erkennen, dass sie sich in einer „Fabrik zur Herstellung einheitlicher, pflegeleichter Menschen“ befindet. Diese Erkenntnis ist eine scharfe Kritik an der menschlichen Natur, die oft nicht bereit ist, die eigene Identität und Freiheit zu verteidigen.
„Schwindende Welt“ thematisiert nicht nur das Verschwinden individueller Identität, sondern hinterfragt auch die manipulativen Strukturen, die in der modernen Gesellschaft vorherrschen. Murata beleuchtet die Gefahren der Konformität und den Drang des Menschen, sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen. Die Protagonistin diagnostiziert: „Diese Welt war verrückt“, was die verzweifelte Suche nach Identität und Zugehörigkeit in einer zunehmend entfremdeten Gesellschaft widerspiegelt.
Insgesamt bietet Muratas Werk eine eindringliche Warnung vor den Folgen einer Gesellschaft, die sich in ihrer Suche nach Gleichheit und Sicherheit selbst entmenschlicht. „Schwindende Welt“ ist nicht nur eine fesselnde Dystopie, sondern auch ein zeitgenössischer Kommentar zu den Herausforderungen und Gefahren, die mit der Abkehr von individuellen Lebensmodellen und der Unterordnung unter kollektive Ideale verbunden sind.