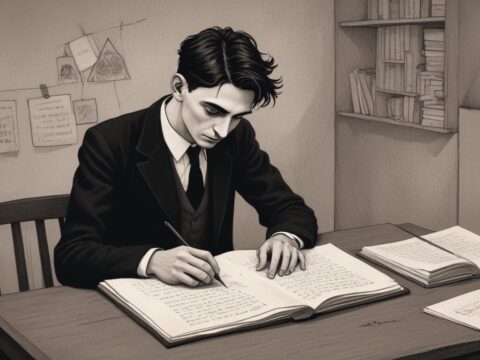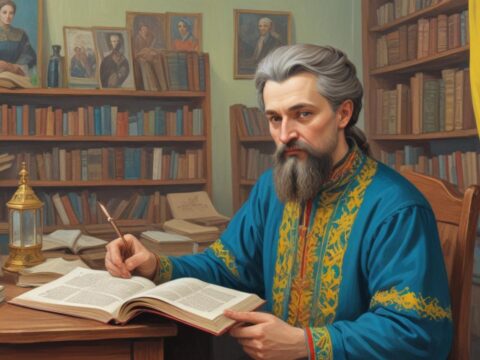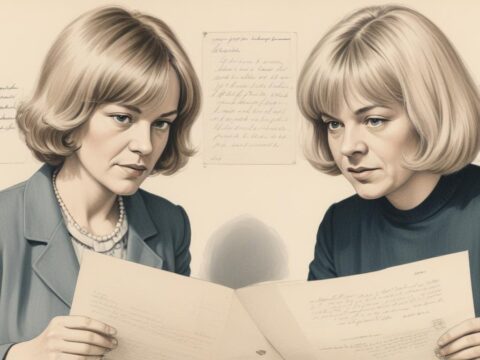Der italienische Mythenforscher und Schriftsteller Furio Jesi, der zwischen 1941 und 1980 lebte, ist vielen in Deutschland möglicherweise unbekannt, doch in seiner Heimat hat er bedeutende Denker wie Umberto Eco und Pier Paolo Pasolini beeinflusst. Mit der Neuausgabe seines Essays „Spartakus. Symbologie der Revolte“ aus dem Jahr 1969 bietet der Matthes & Seitz Verlag eine wertvolle Gelegenheit, Jesis innovative Perspektiven zu erkunden. Sein Werk thematisiert den Spartakusaufstand von 1919, auch bekannt als der Januaraufstand während der deutschen Revolution von 1918/19, und interpretiert dieses historische Ereignis auf eine neuartige Weise, die weit über die bloße Geschichte hinausreicht.
Jesi, der auch Germanist war, kombiniert in seinem Essay eine Analyse des Aufstands mit Beispielen aus der deutschen Literaturgeschichte. Dabei stellt er fest, dass die Revolte für ihn ein überhistorisches Phänomen darstellt, das in der Lage ist, tiefere Wahrheiten über den Menschen und die Gesellschaft zu offenbaren. Der Autor selbst war sich der Herausforderungen bewusst, die sein komplexer Text an die Leser stellte. Daher wurde er von einem Vorwort des Herausgebers Andrea Cavaletti und einem Nachwort der Übersetzer Cinzia Rivieri und Frank Engster umrahmt, die den Kontext und die Prinzipien seiner Übersetzung näher erläutern.
Eine zentrale Differenz in Jesis Argumentation ist die Trennung zwischen der Revolte und der Revolution. Während viele klassische Theoretiker wie Marx oder Lenin die Revolution als entscheidend für den Fortschritt der Geschichte erachten, sieht Jesi in der Revolte etwas Zeitloses, das über die historischen Rahmenbedingungen hinausweist. Für ihn ist die Revolte ein kollektives Ereignis, das aus einem Gefühl des Ausnahmezustands heraus entsteht, wie es nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs der Fall war. Jesi beschreibt das Nein, das die Revolte verkörpert, als ein kollektives Nein, das von den Menschen ausgeht, die nach dem Krieg in eine neue Realität zurückkehren.
Jesi macht jedoch deutlich, dass sein Buch keine detaillierte Geschichte des Spartakusaufstands ist. Vielmehr geht es ihm um die Mythen und Symbole, die in der Revolte verkörpert sind und die weit über die spezifischen Ereignisse in Berlin im Januar 1919 hinausweisen. Der Aufstand, der zunächst von einer massiven Massenbewegung getragen wurde, zeigt sowohl erhabene als auch klägliche Aspekte. Während die Menschen zunächst mit Enthusiasmus auf die Straßen strömten, scheiterte die Führung der Bewegung an internen Konflikten und mangelnder Einigkeit. Jesi beschreibt, wie die Aufständischen nach anfänglichem Erfolg schließlich von regierungstreuen Truppen zurückgedrängt wurden.
Ein markantes Element in Jesis Analyse ist die Betrachtung von Entsagung und Opfer. Er zieht Parallelen zu literarischen Werken, in denen diese Themen eine zentrale Rolle spielen, wie zum Beispiel in Theodor Storms Novelle „Immensee“. Hier wird ein existenzielles Opfer beschrieben, das zur Wiederherstellung der bürgerlichen Ordnung führt. Jesi verknüpft dies mit dem Schicksal der Spartakusführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, deren Ablehnung, Berlin zu verlassen, möglicherweise als bewusstes Opfer interpretiert werden kann.
Darüber hinaus untersucht Jesi die Symbole, die aus der Kriegserfahrung hervorgehen und wie diese die Wahrnehmung der Revolte beeinflussen. Die revoltierenden Arbeiter hatten das Trauma des Krieges im Gepäck, das sich in ihrer Wahrnehmung der urbanen Umgebung und der mächtigen Gebäude, die die herrschende Klasse repräsentierten, widerspiegelte. Diese Symbole werden in der Literatur, zum Beispiel in expressionistischen Gedichten, thematisiert und verdeutlichen das Gefühl der Ohnmacht der Aufständischen.
Für Jesi ist die Revolte ein Moment, in dem der Mythos wieder lebendig wird. Er sieht Mythen als Erzählungen, die universelle Wahrheiten transportieren, die jedoch im Laufe der Geschichte verloren oder missbraucht wurden. Diese Mythen, die im Unterbewusstsein der Menschen weiterleben, eröffnen Möglichkeiten für „Epiphanien“ der Wahrheit, besonders in Zeiten der Revolte. Jesi verknüpft den Spartakusaufstand mit anderen historischen Aufständen, wie der Pariser Kommune oder dem Spanischen Bürgerkrieg, und sieht in ihnen alle die Möglichkeit, eine bessere Welt zu erahnen, auch wenn sie in der Realität oft scheitern.
In den letzten Abschnitten seines Essays