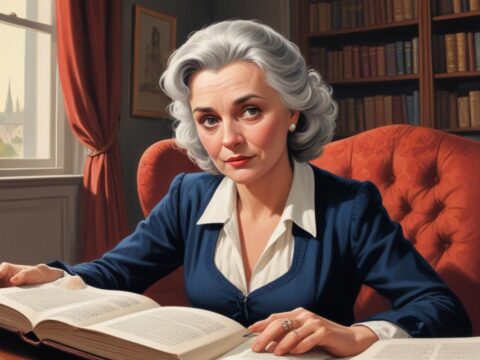Im neuesten Roman „Was wir wissen können“ des Booker-Preisträgers Ian McEwan, der als einer der bekanntesten britischen Autoren gilt, wird die Leserschaft auf eine vielschichtige, jedoch nicht durchweg überzeugende Reise in die Zukunft mitgenommen. McEwan, der mit seinen früheren Werken wie „Abbitte“ und „Liebeswahn“ große Erfolge feierte, lässt in diesem 18. Roman eine tragische Liebesgeschichte, einen komplexen Kriminalfall und eine abenteuerliche Zeitreise verschmelzen, die im Jahr 2119 spielt.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Welt stark dezimiert durch Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnöte und Krankheiten, die die Bevölkerung auf etwa vier Milliarden Menschen reduziert haben. Der Roman beschreibt eine dystopische Realität, in der die Überreste der Zivilisation in kleinen Inselgruppen existieren und die einzige verbliebene Weltmacht Nigeria zu sein scheint. McEwan nutzt diese Kulisse, um die Menschheit nach einem katastrophalen Verlauf der Geschichte zu reflektieren und gleichzeitig eine tiefere Verbindung zur Literatur herzustellen, die in diesen düsteren Zeiten Trost und Hoffnung spenden kann.
Im Mittelpunkt der Erzählung steht Tom Metcalfe, ein einsamer Literaturwissenschaftler, dessen Forschungsinteresse sich um die Literatur der späten 1990er bis frühen 2030er Jahre dreht. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem mysteriösen Werk des fiktiven Dichters Francis Blundy, dessen Gedicht „Sonettenkranz für Vivien“ nur einmal vor Freunden vorgetragen wurde und seitdem von vielen Legenden umwoben ist. Die Suche nach dem verschollenen Manuskript wird zu einer persönlichen Besessenheit für Tom, der sich durch einen Wald aus Briefen, Tagebüchern und über 200.000 SMS gräbt, um die Wahrheit über diesen legendären Abend zu enthüllen.
Trotz seiner akademischen Ambitionen wird Toms Suche bald von einem emotionalen und fast obsessiven Interesse an Vivien, Blundys Frau, überlagert. Die Erzählweise wechselt zwischen verschiedenen Perspektiven, was in der Mitte des Romans zu einem drastischen Perspektivwechsel führt, bei dem Vivien selbst zu Wort kommt. Dieses narrative Experiment soll dem Leser eine tiefere Einsicht in die Komplexität ihrer Beziehung und die Geheimnisse, die sie umgeben, ermöglichen.
Allerdings bleibt die Figur des Tom Metcalfe blass und unscheinbar, was die emotionale Tiefe der Geschichte beeinträchtigt. Trotz der interessanten Prämisse und der historischen Verflechtungen gelingt es McEwan nicht, die Spannung und Tiefe, die in seinen früheren Werken zu finden sind, zu reproduzieren. Stattdessen erlebt der Leser ein Erzähllabyrinth, das oft ohne klaren roten Faden verläuft und in viele inhaltliche Sackgassen führt.
Ein weiterer Schwachpunkt des Romans ist die oft oberflächliche Reflexion über die gegenwärtigen sozialen Medien und die politischen Verhältnisse. Die Figuren, einschließlich Toms Kollegin Rose, bringen Kommentare über die „Gehässigkeit der sozialen Medien“ und die „Selbstsucht“ der Politiker ein, die kaum als tiefgründige Gesellschaftskritik gelten können. Diese Passagen wirken eher wie Anklänge an zeitgenössische Debatten, die den historischen Rahmen des Romans nicht ausreichend berücksichtigen.
Trotz dieser Mängel bleibt der unerschütterliche Glaube Toms an die Kraft und Schönheit der Literatur ein zentrales Element der Erzählung. McEwan scheint mit dieser Botschaft im Hinterkopf zu schreiben, auch wenn der Weg dorthin nicht immer klar und überzeugend ist. „Was wir wissen können“ ist daher als eine Art Liebeserklärung an die Literatur zu verstehen, die inmitten von Chaos und Verzweiflung einen Lichtblick bietet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Was wir wissen können“ zwar einige interessante Ideen und Themen behandelt, jedoch in der Ausführung hinter den Erwartungen zurückbleibt, die man von einem Autor wie Ian McEwan hat. Der Roman zählt zu seinen schwächeren Arbeiten, und es bleibt abzuwarten, ob McEwan in zukünftigen Werken zu seiner gewohnten Form zurückfindet.