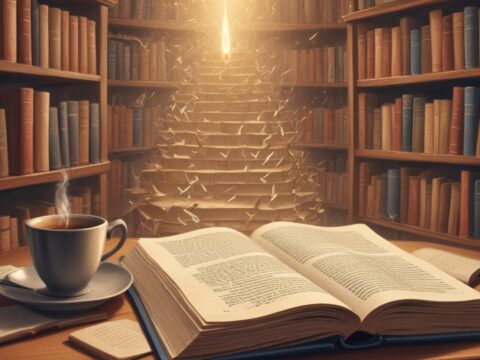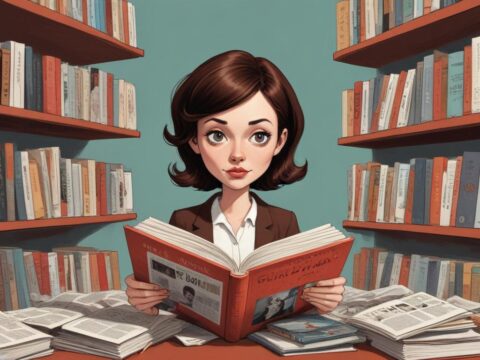In seinem Buch „Keine Macht für Niemand“ beleuchtet Marcus S. Kleiner das Verhältnis zwischen deutscher Popmusik und der politischen sowie gesellschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Kapitel sind thematisch strukturiert und mit Zeilen aus bekannten Popsongs versehen, was den Leser sofort in die Welt der Musik eintauchen lässt. Nach einer persönlichen Einleitung, die autobiografische Elemente enthält, widmet sich Kleiner der Zeitspanne von 1968 bis in die Gegenwart. Dabei wirft er auch einen Blick auf die Geschichte des Schlagers, beginnend mit der Zeit des Nationalsozialismus bis hin zur Wirtschaftswunderära.
Allerdings wird deutlich, dass Kleiner nicht nur eine objektive Geschichte des deutschsprachigen Popsongs erzählt, sondern seine eigene subjektive Sichtweise einfließen lässt. Dies wird besonders durch die Vielzahl an Referenzen zu verschiedenen Songs und Künstlern sichtbar, die eher als lose Zusammenstellung präsentiert werden, ohne eine tiefere theoretische Analyse zu bieten, die für eine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung notwendig wäre. Die Kapitel sind oft nicht chronologisch geordnet, was den Leser manchmal verwirren kann.
Ein auffälliger Aspekt des Buches ist die Vielzahl an Fotos, die Kleiner zusammen mit bekannten Persönlichkeiten der Popmusik zeigt. Diese visuellen Elemente scheinen darauf abzuzielen, seine Expertise durch eine persönliche Verbindung zu diesen Künstlern zu untermauern. Allerdings wird die mangelnde Differenzierung in seiner Argumentation kritisiert. So wird beispielsweise das Lied „Lili Marleen“ als „Kriegsschlager“ bezeichnet, was zwar eine gültige Kritik darstellt, jedoch die komplexe Wirkung des Songs nach 1945 nicht ausreichend berücksichtigt. Das Lied wurde nach dem Krieg zu einem Symbol für Verlust und Sehnsucht und ist nicht nur auf seine nationalsozialistische Instrumentalisierung zu reduzieren.
Kritik übt Kleiner auch an Udo Lindenberg, dessen Musik er als nicht ausreichend kritisch gegenüber dem Kapitalismus einstuft. Diese Behauptung bleibt jedoch unbegründet und verkennt Lindenbergs Rolle als Stimme einer Generation, die Alternativen zu einer als unsozial empfundenen Leistungsgesellschaft suchte. Lindenbergs früher Hit „Alles klar auf der Andrea Doria“ beispielsweise kritisiert satirisch die gesellschaftlichen Missstände der damaligen Zeit und widerspricht Kleiners einschätzenden Argumenten.
Das Buch zitiert auch den Titel „Keine Macht für Niemand“ von Ton Steine Scherben, den Kleiner als Ausdruck von „Machtkritik und produktiver Zerstörung“ interpretiert. Diese Deutung bleibt jedoch vage und es wird nicht klar, inwiefern Kleiner eine produktive Zerstörung in den Texten der Band sieht. Selbst innerhalb der linken Bewegung wurden solche Ansprüche oft als unzureichend oder als bloße Rhetorik wahrgenommen.
Ein weiterer Punkt, der in Kleiners Analyse nicht ausreichend behandelt wird, ist die Auseinandersetzung mit modernen Künstlern wie Reyhan Şahin, bekannt als Lady Bitch Ray. Während er deren Kritik an patriarchalen Strukturen lobt, bleibt unklar, ob diese Kritik tatsächlich die breiten gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen in Deutschland reflektiert oder ob sie sich auf spezifische gesellschaftliche Schichten beschränkt.
Die Schlussfolgerung Kleiners, dass die deutschsprachige Popmusik seit den 1960er Jahren einen kontinuierlichen Einfluss auf die politische Debatte in Deutschland hatte, wird ebenfalls hinterfragt. In einem Land, in dem viele Menschen extremistische Parteien wählen und notwendige gesellschaftliche Reformen oft auf Widerstand stoßen, erscheinen die Erfolge politischer Popsongs als eher begrenzt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob es gerechtfertigt ist, die künstlerische Leistung von Songs allein an ihrem politischen Erfolg zu messen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kleiners Buch eine anregende Lektüre darstellt, die jedoch auch zahlreiche Widersprüche und Unklarheiten aufweist. Es regt dazu an, die Rolle der Popmusik im politischen und gesellschaftlichen Kontext weiter zu untersuchen und die vielschichtigen Beziehungen zwischen Musik und Politik eingehender zu beleuchten.