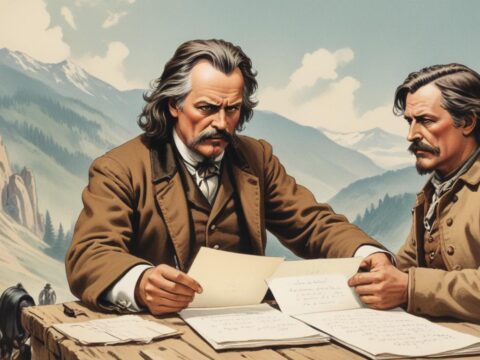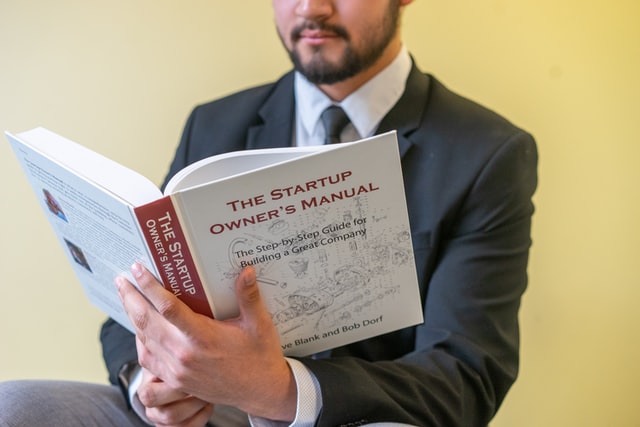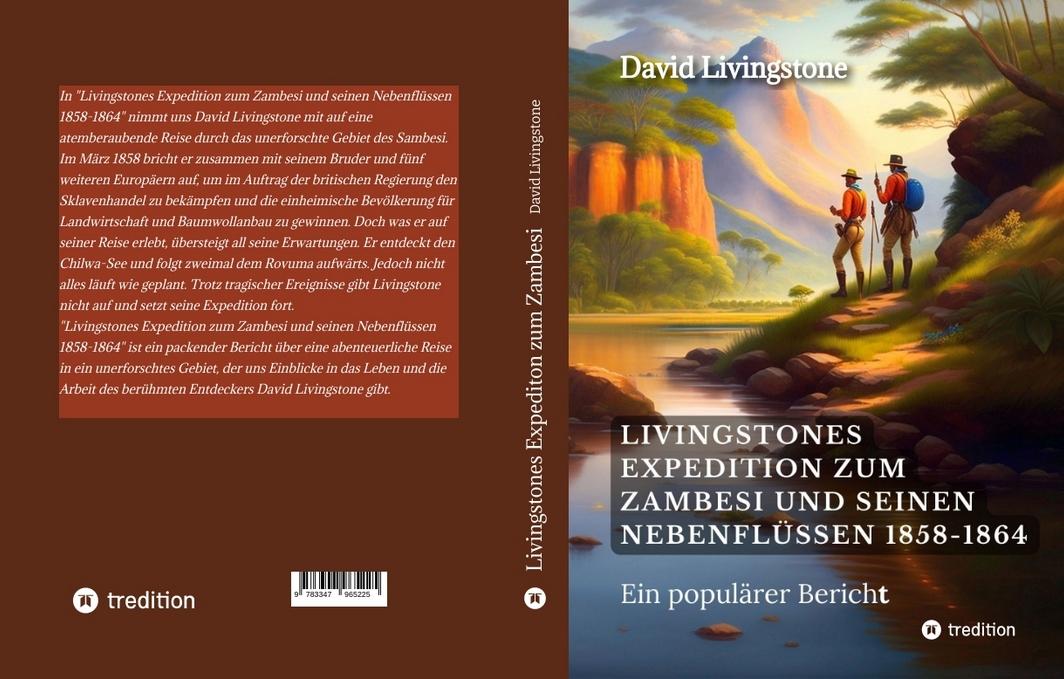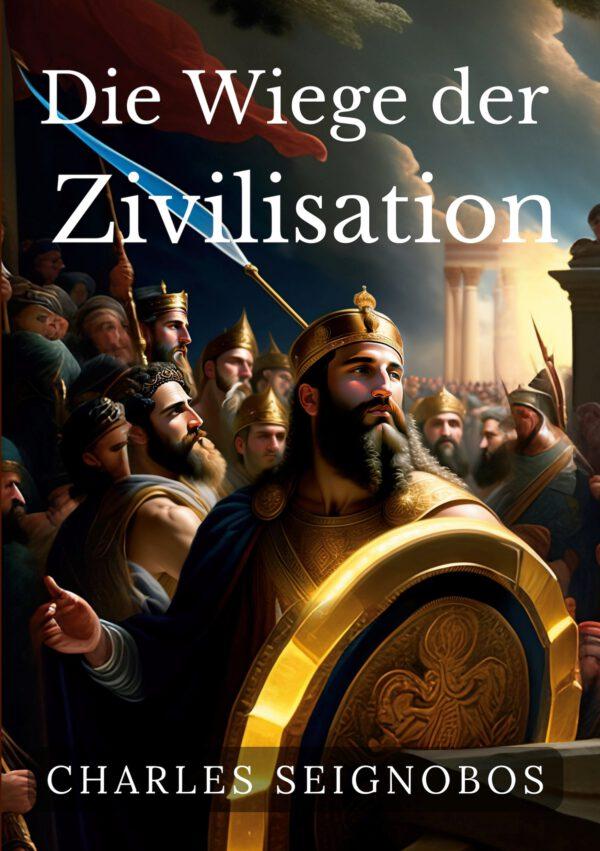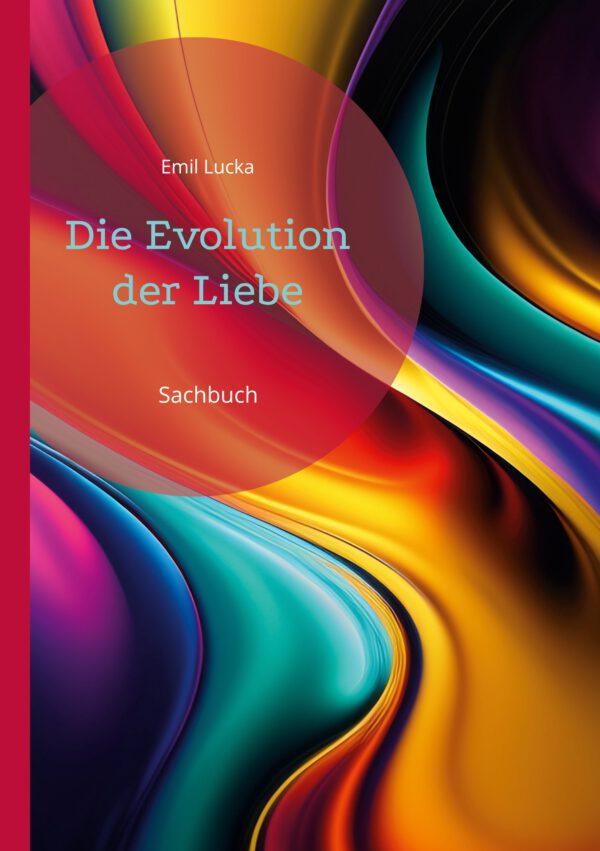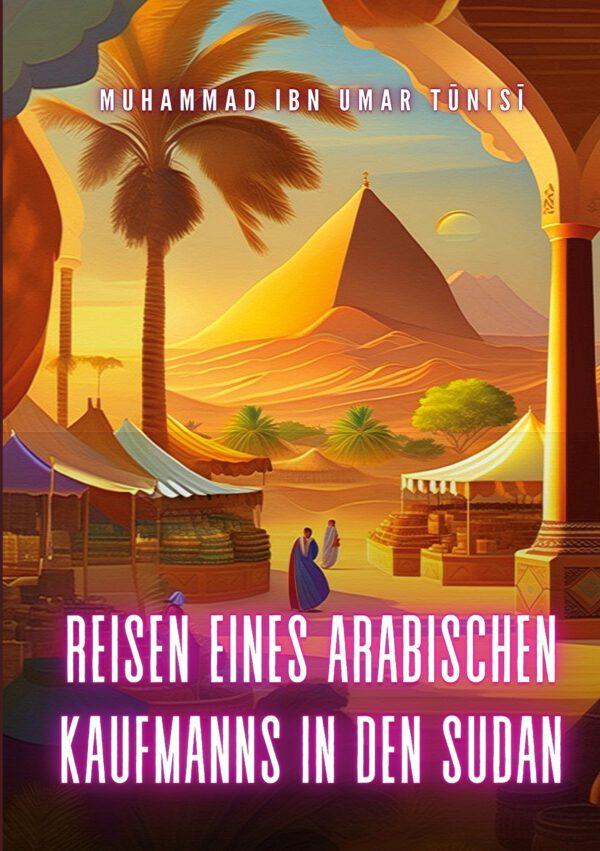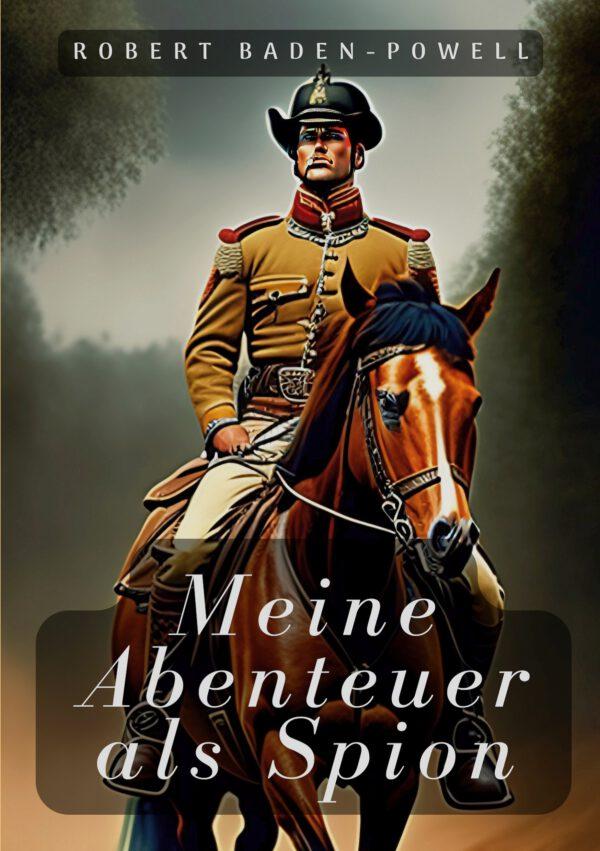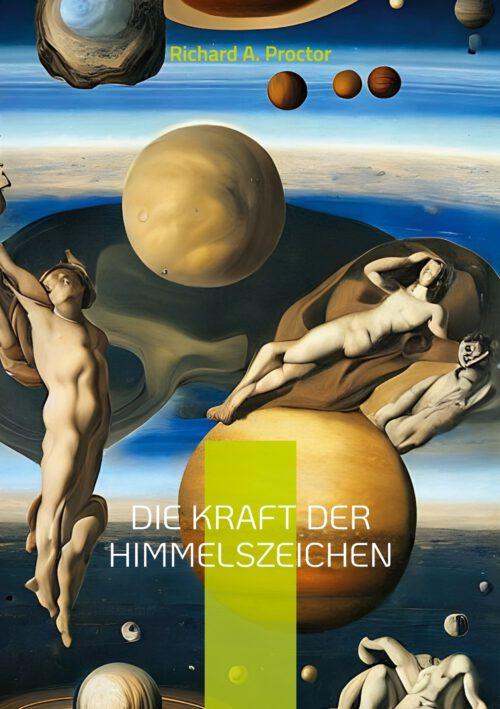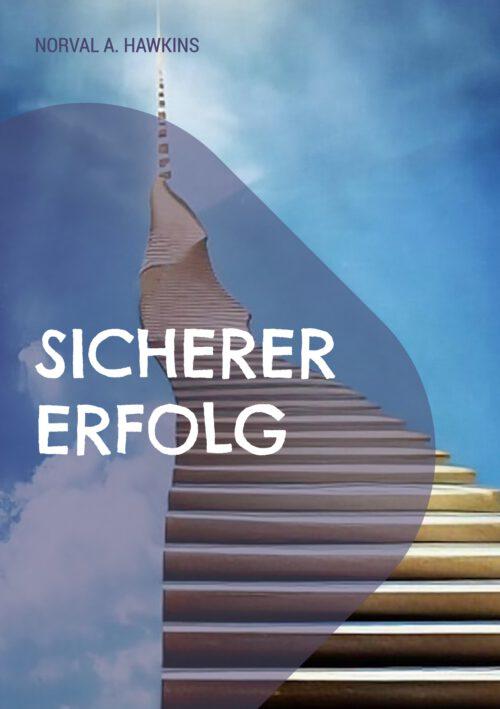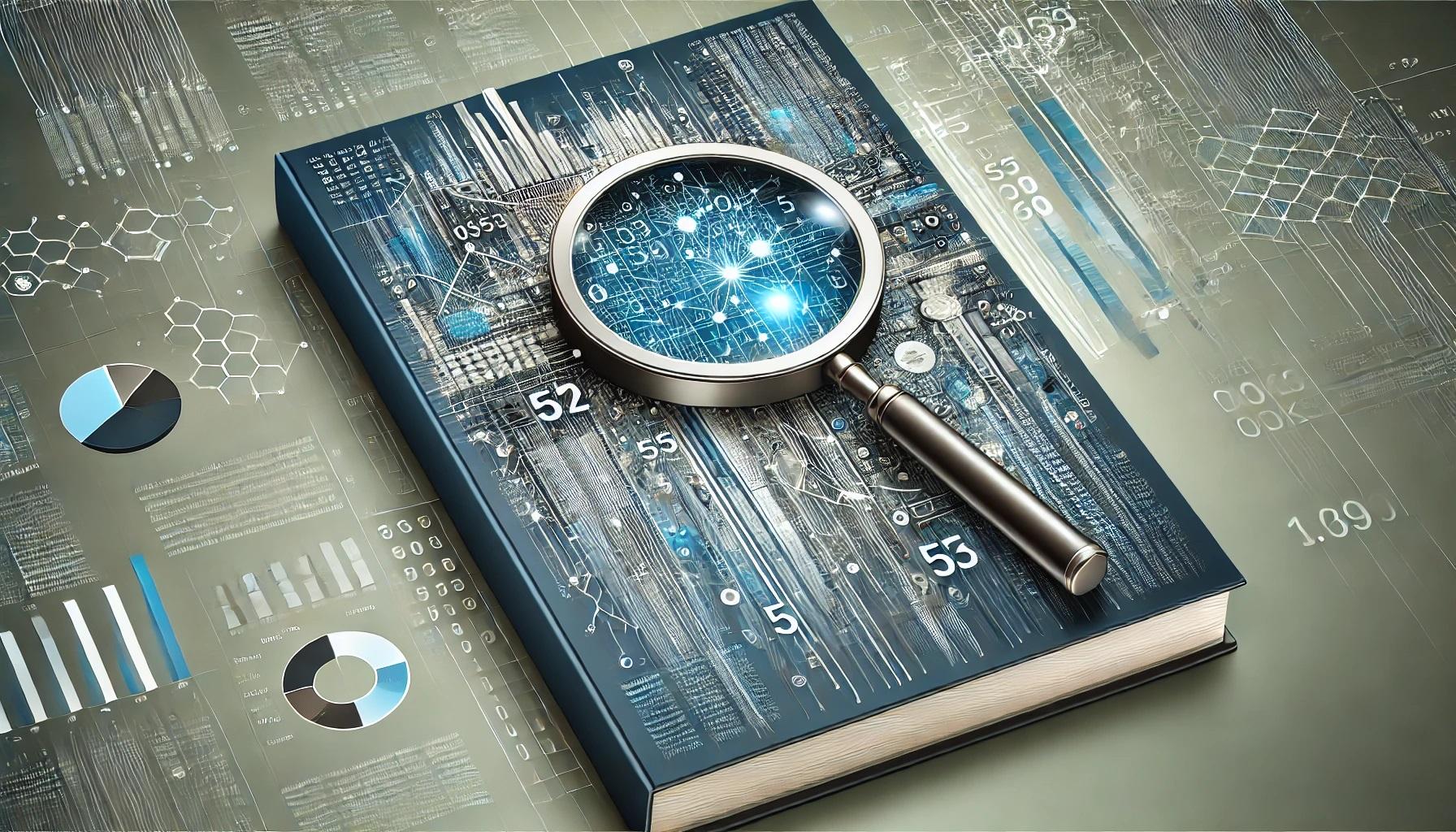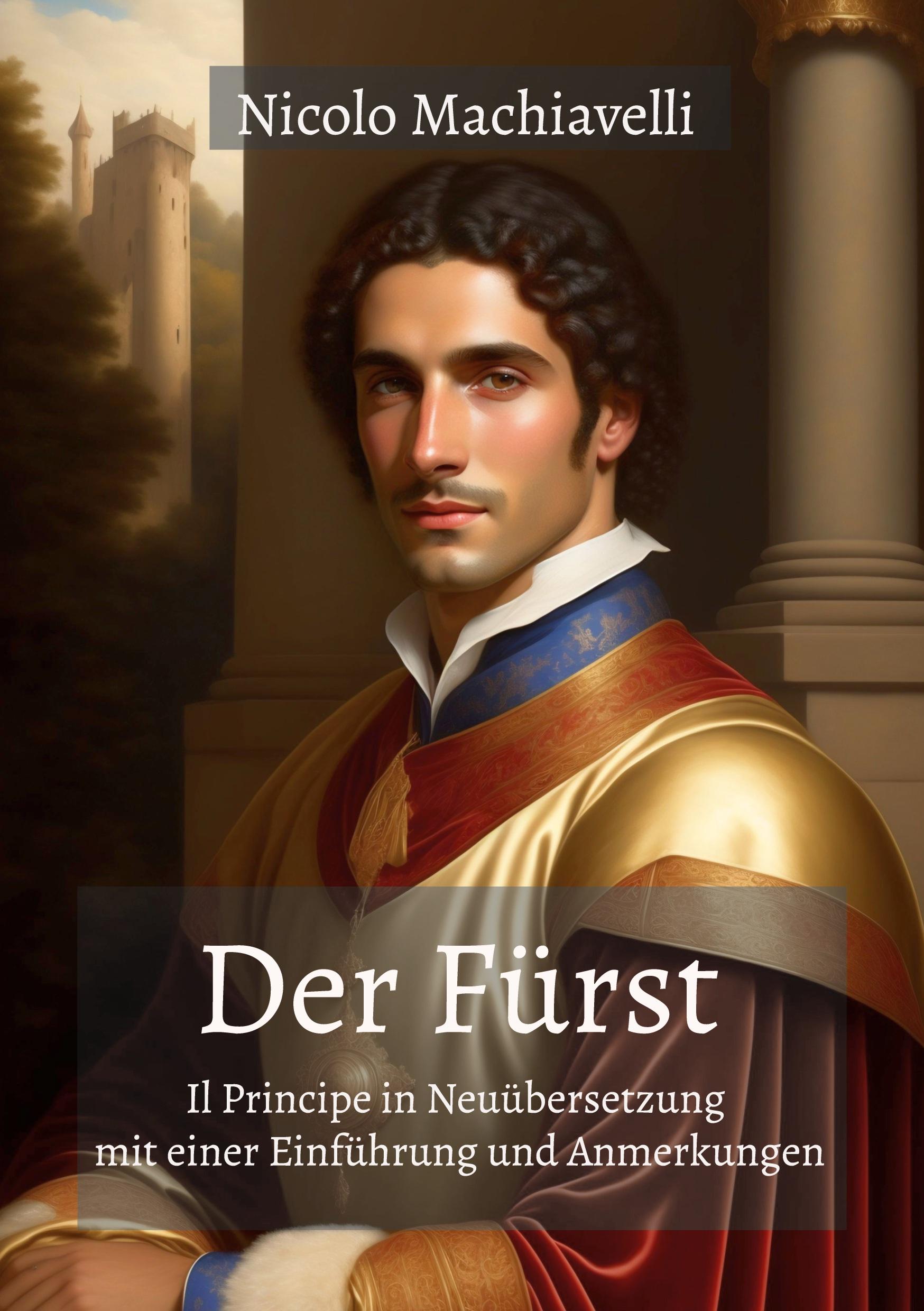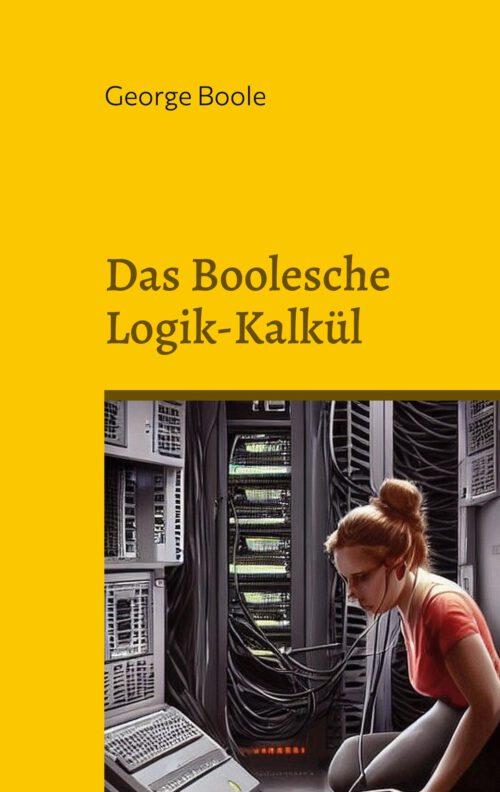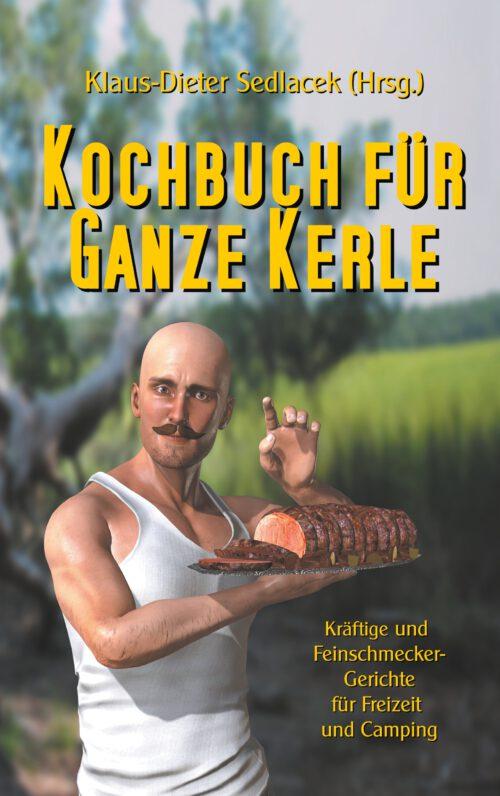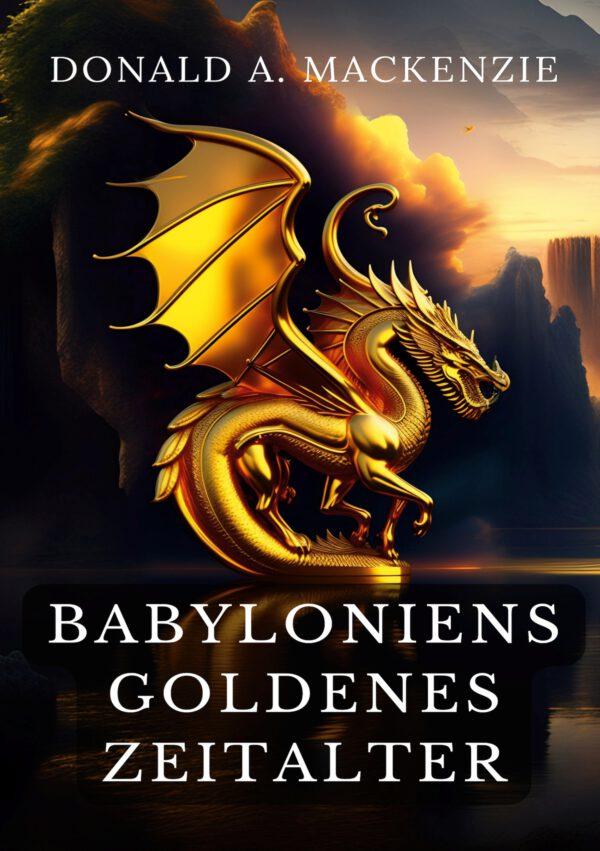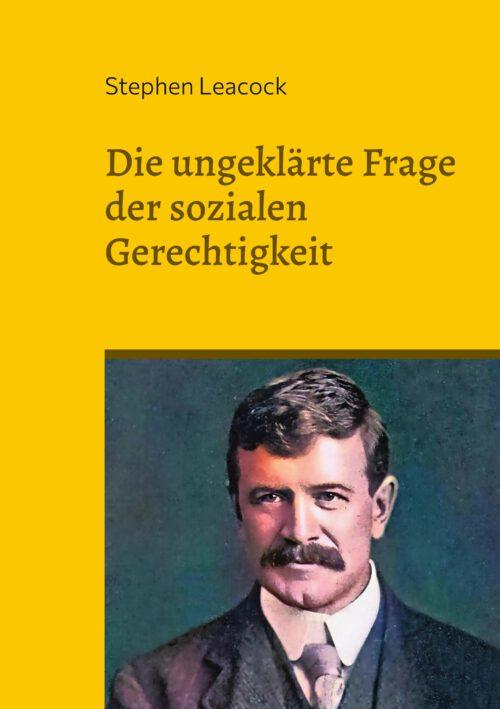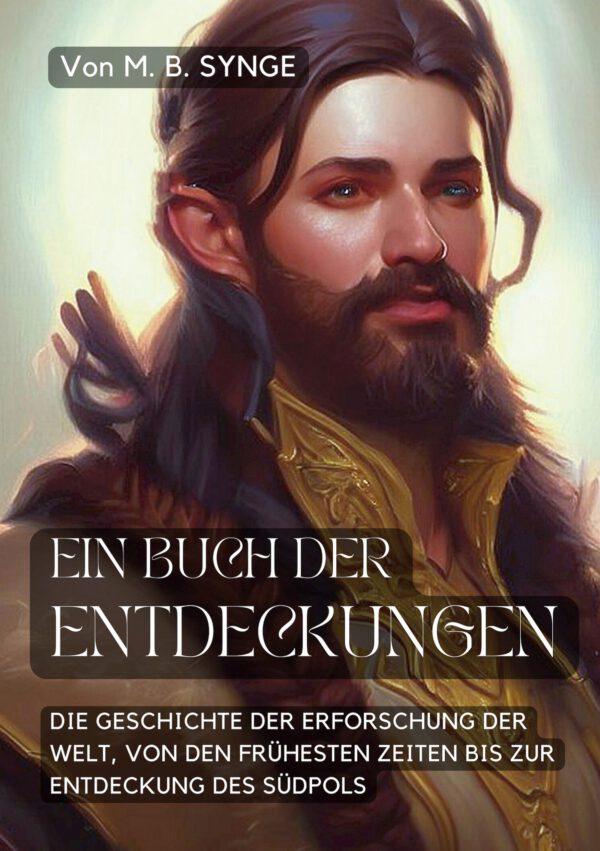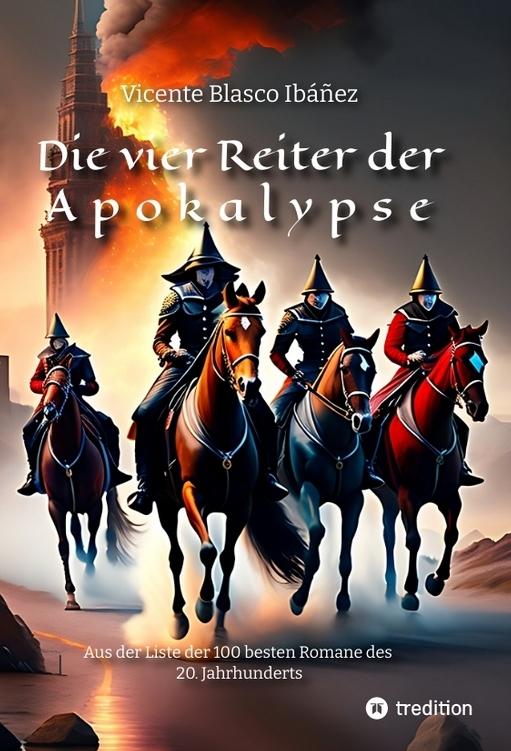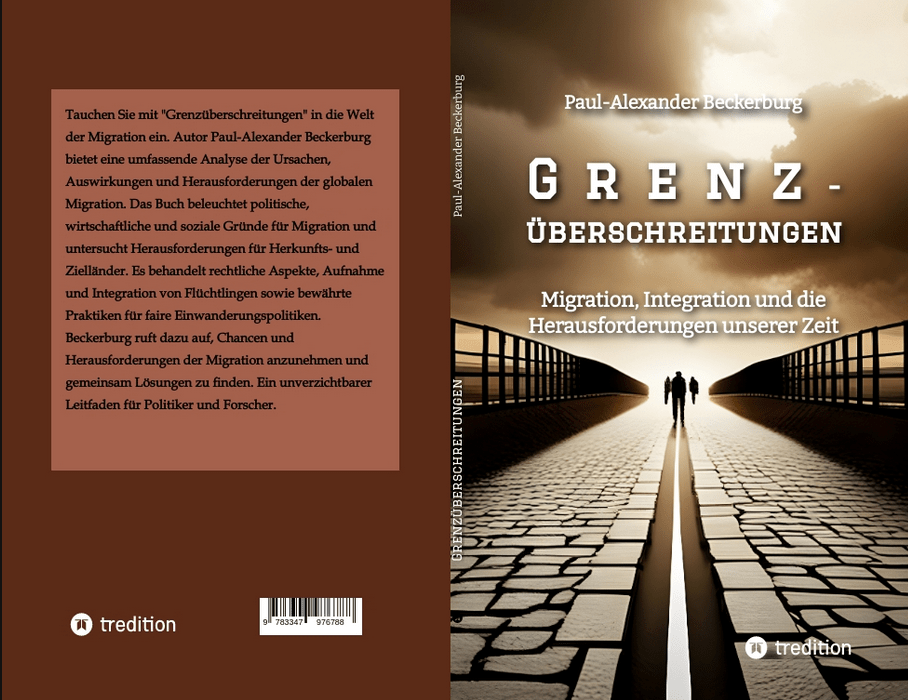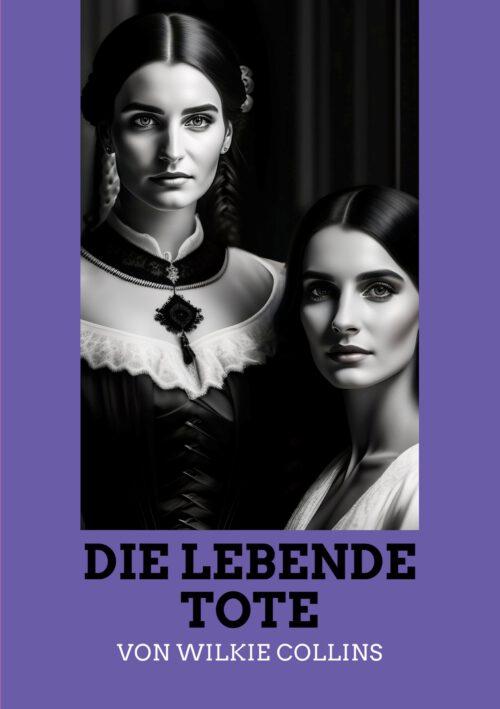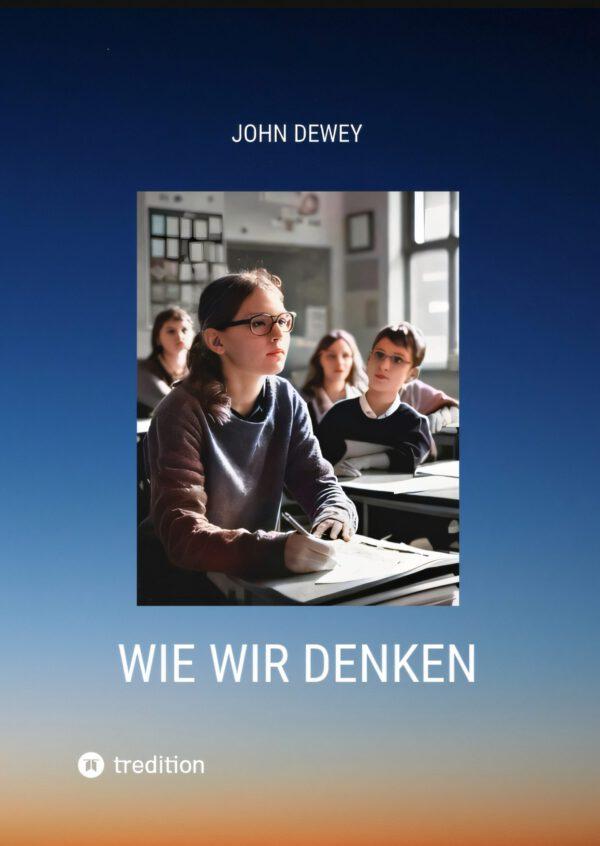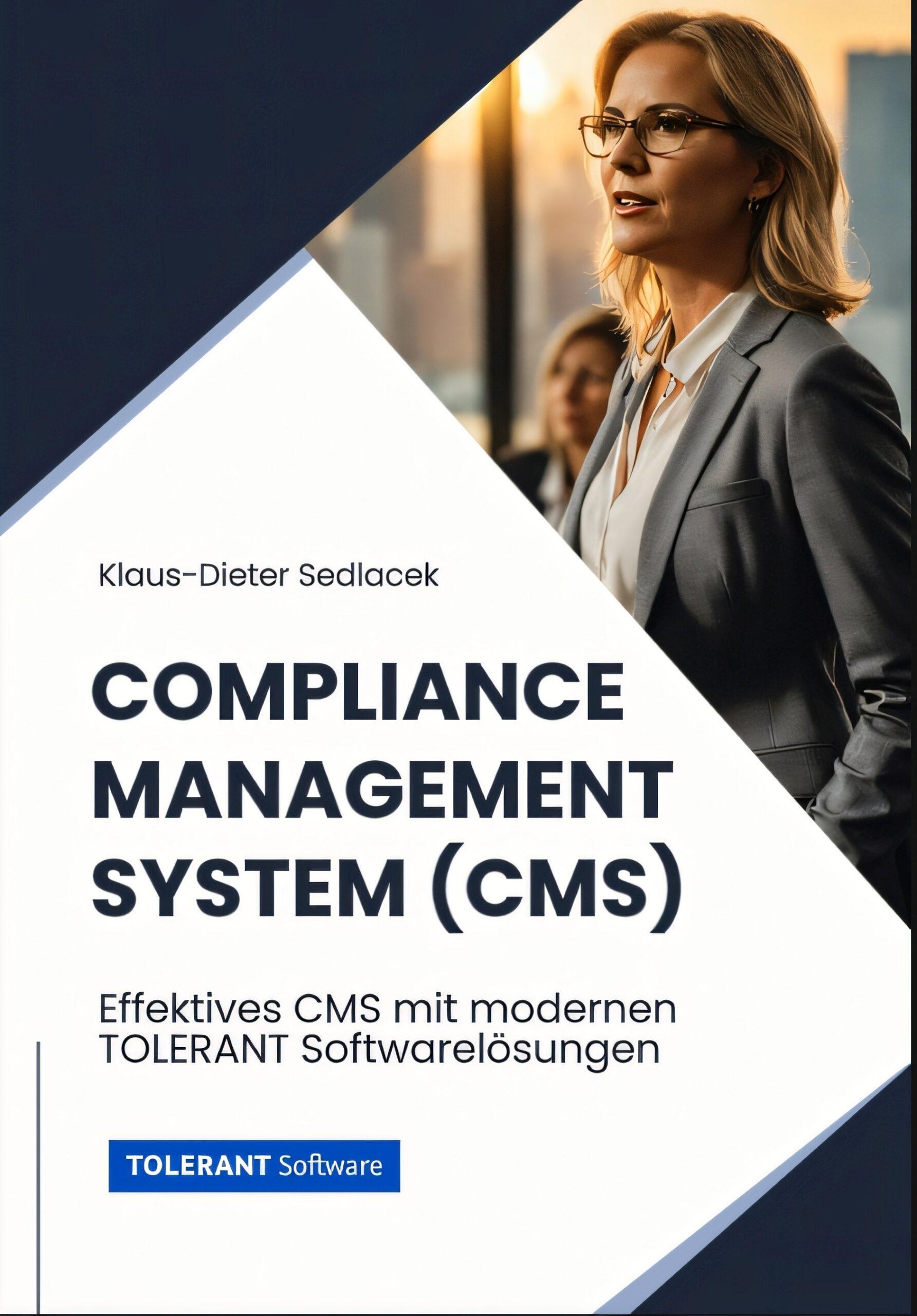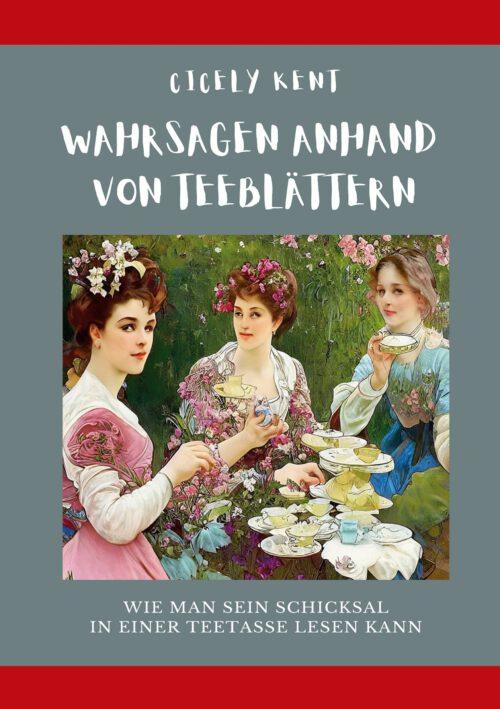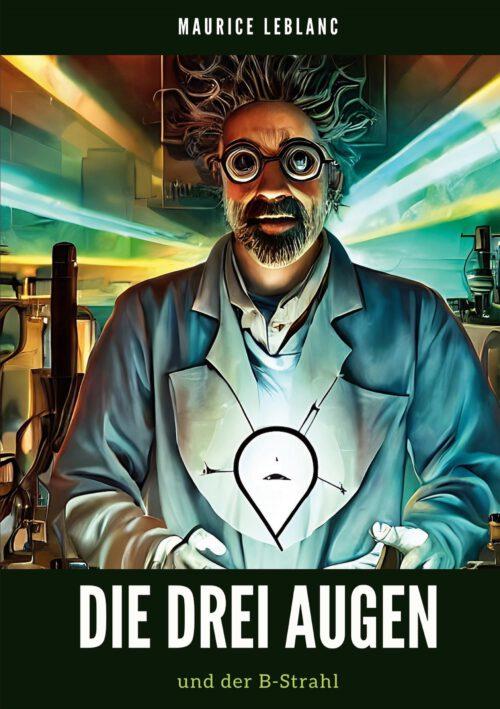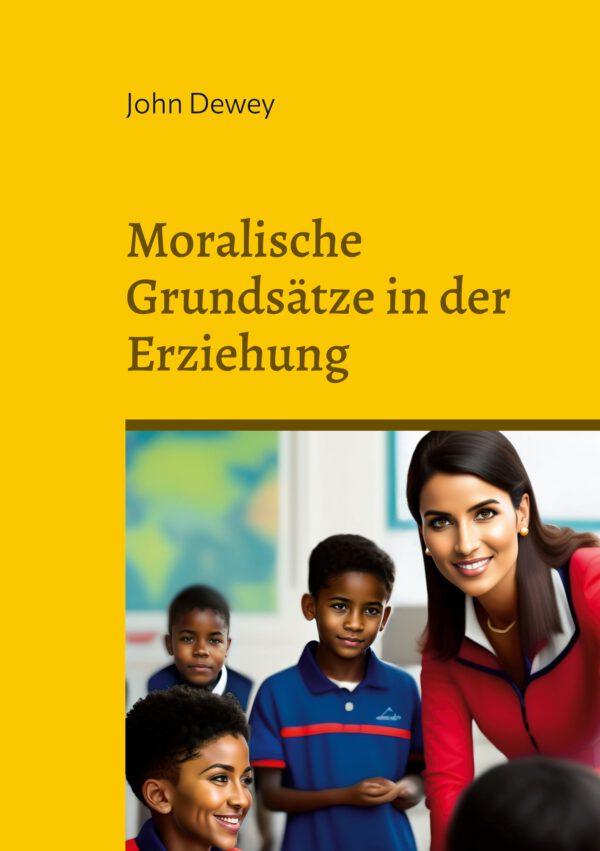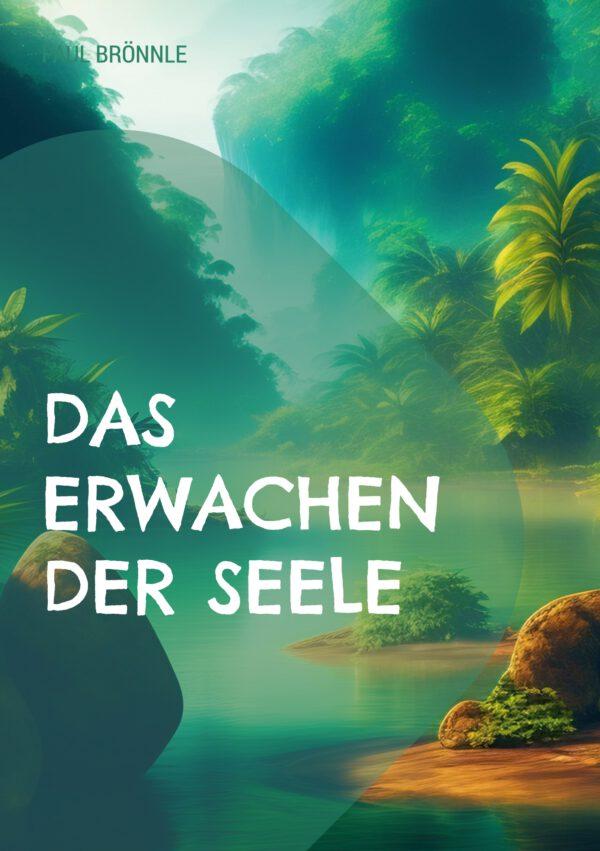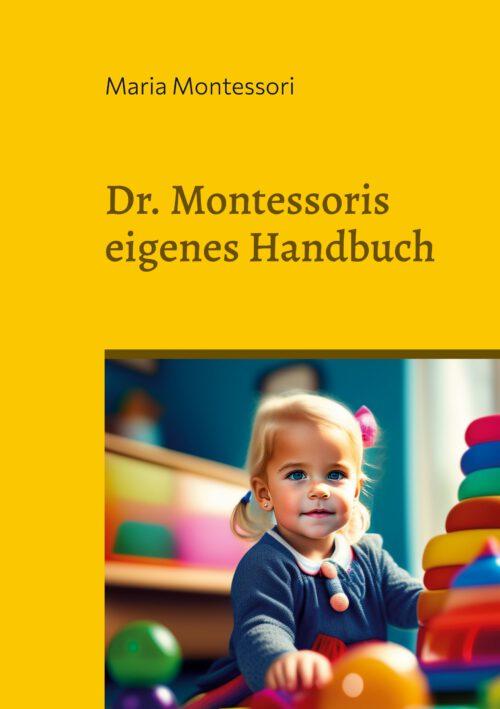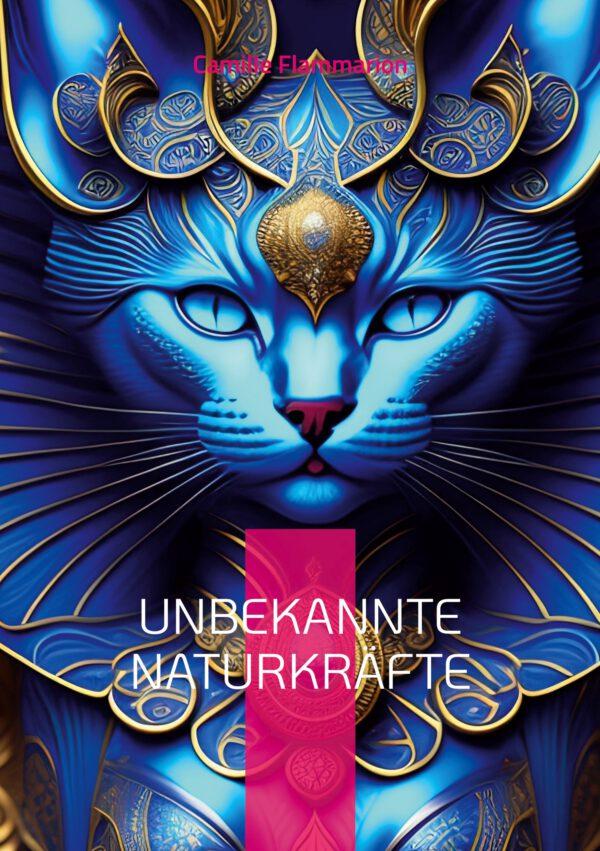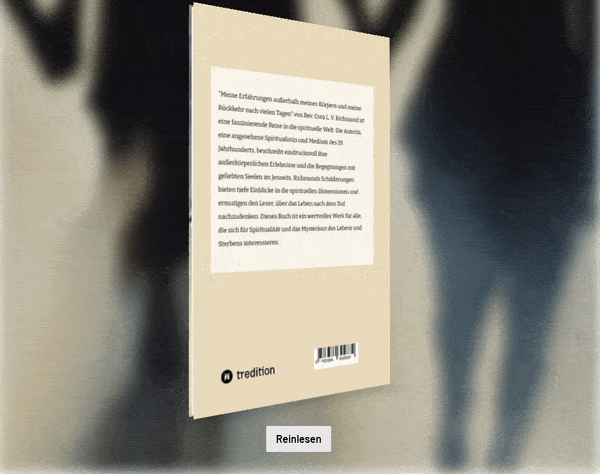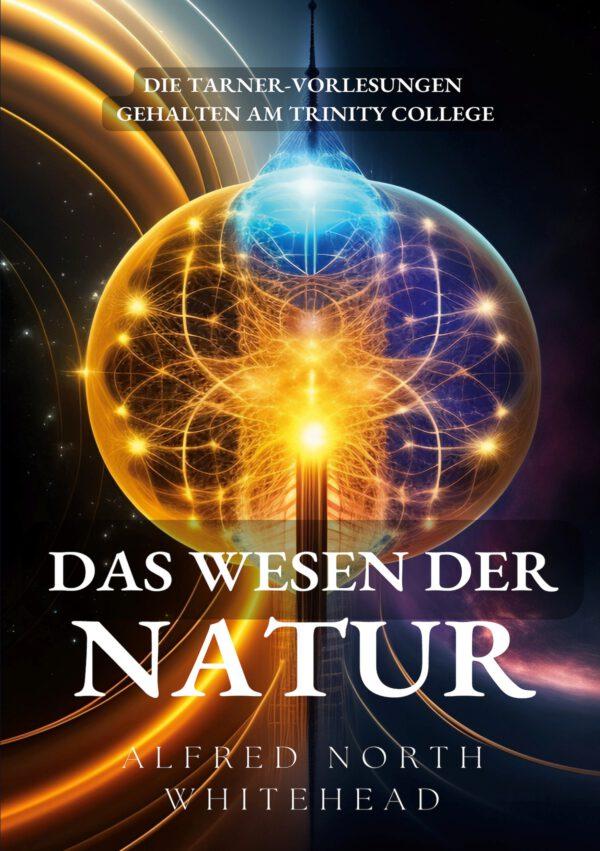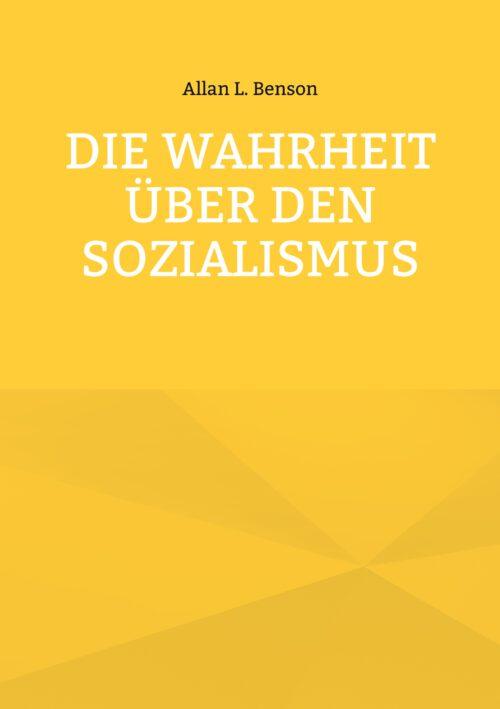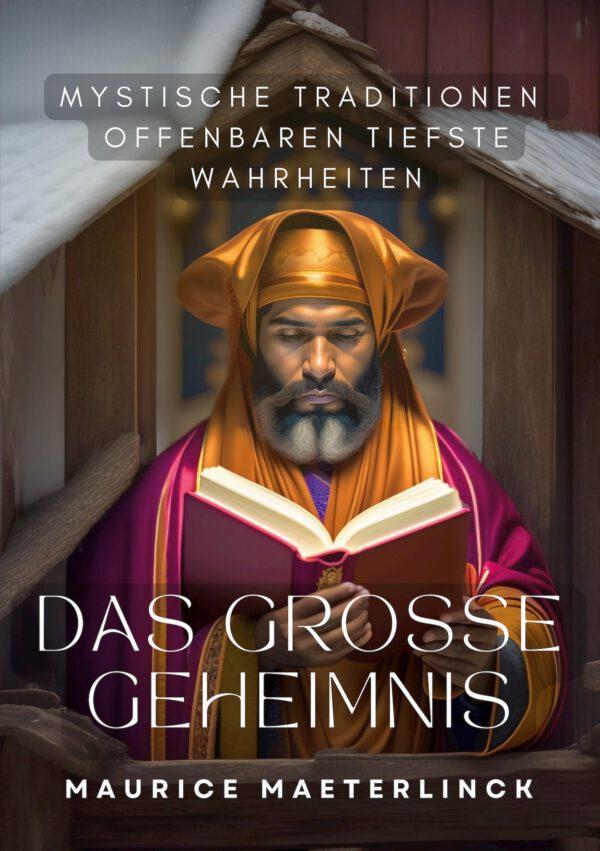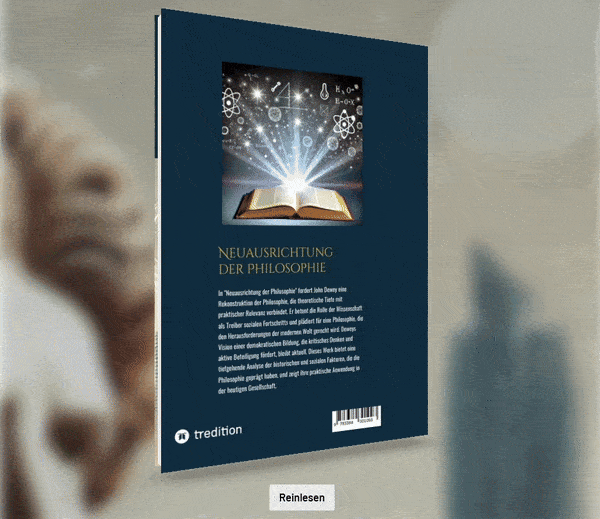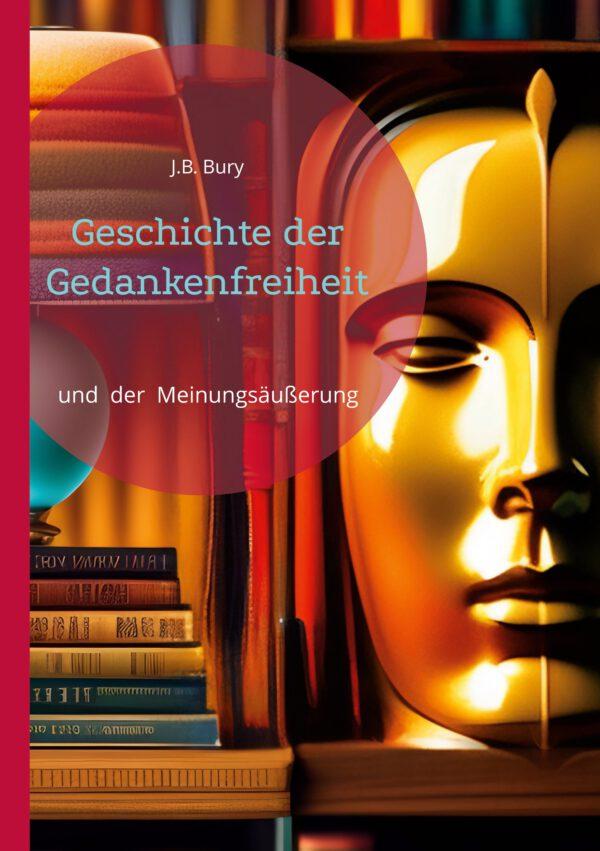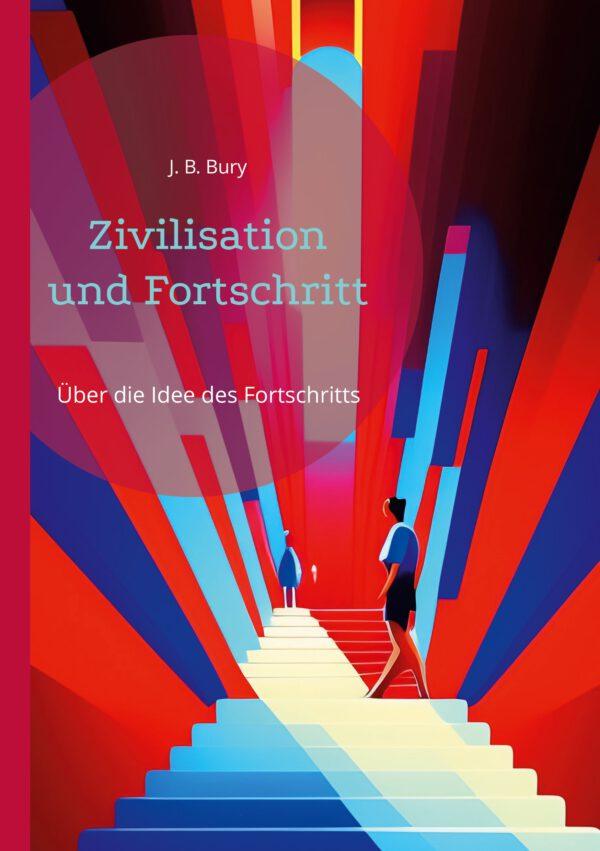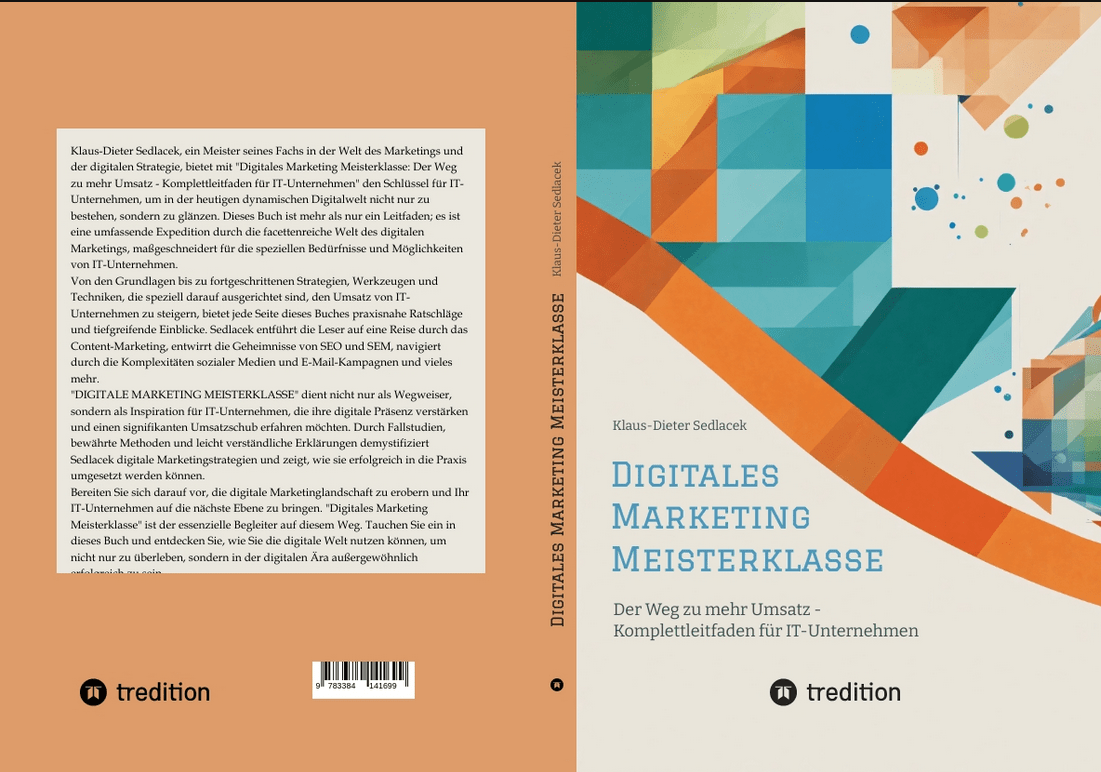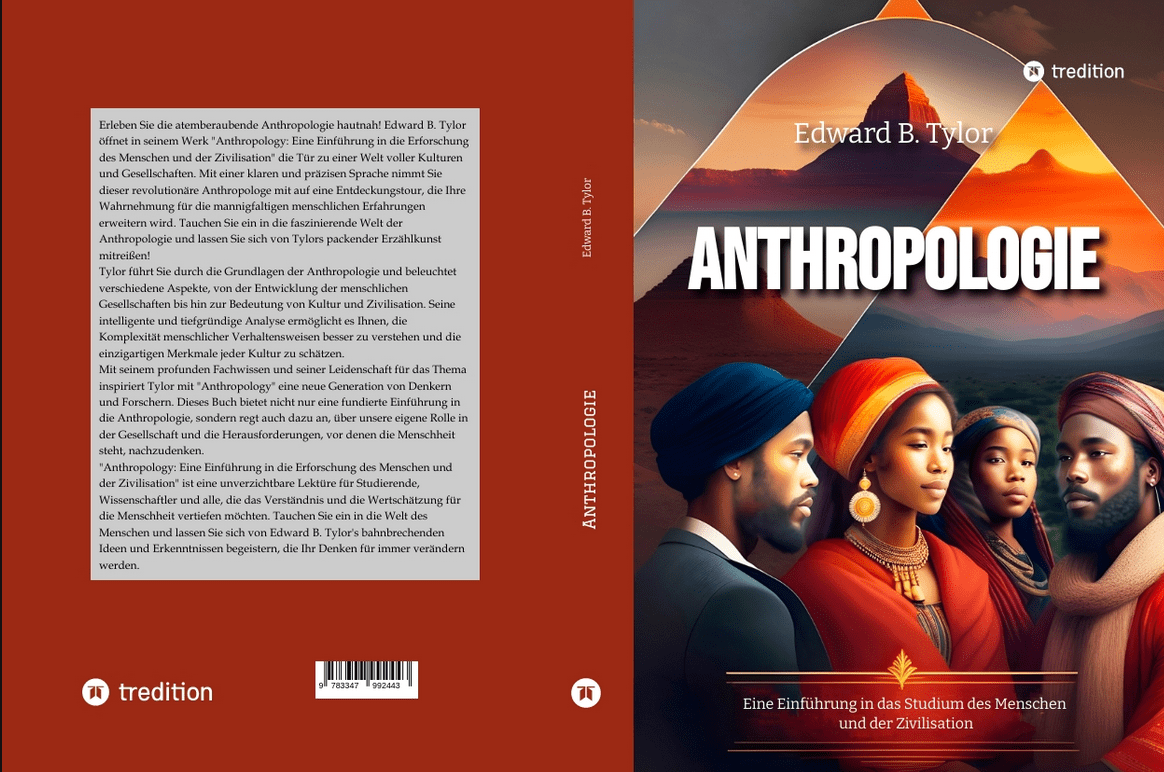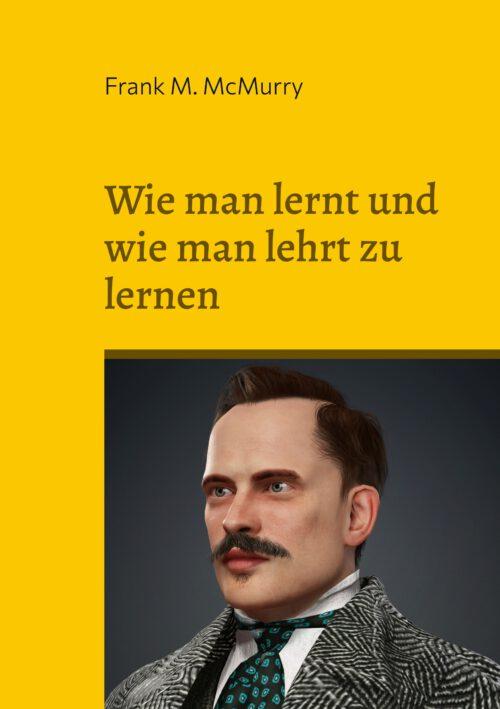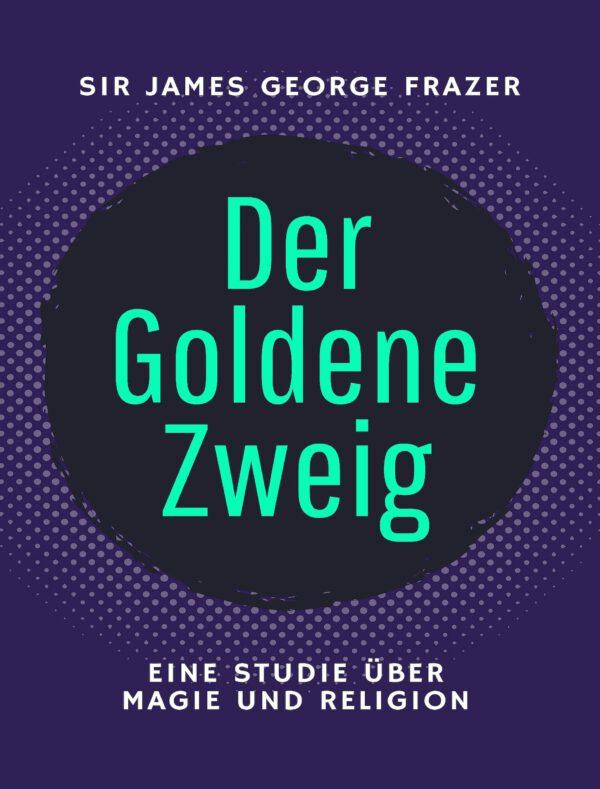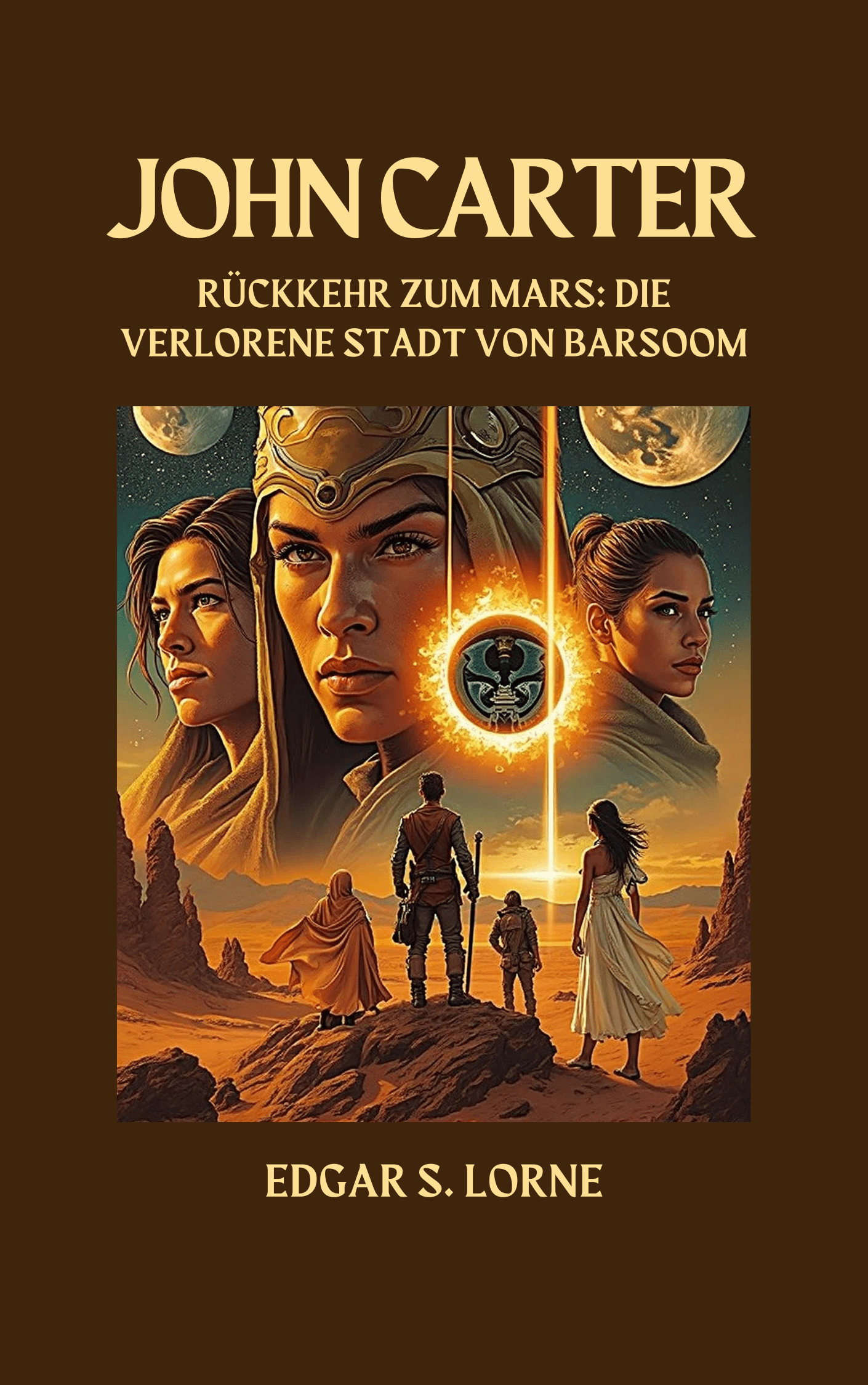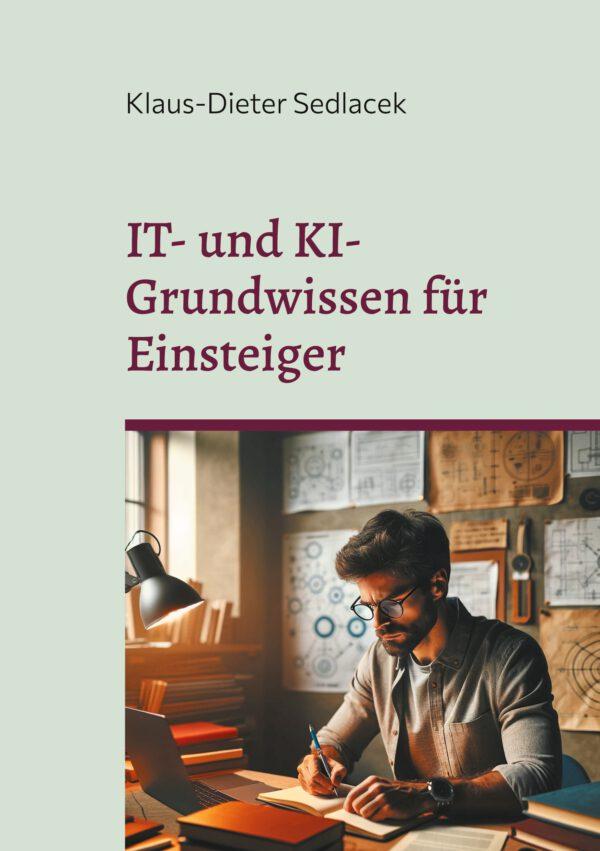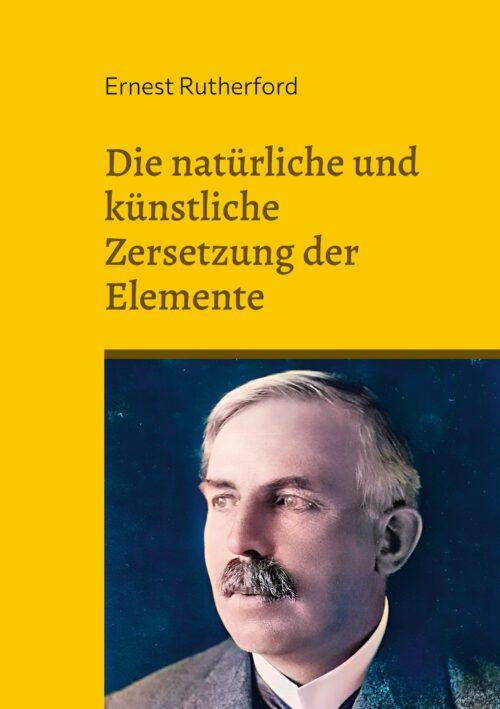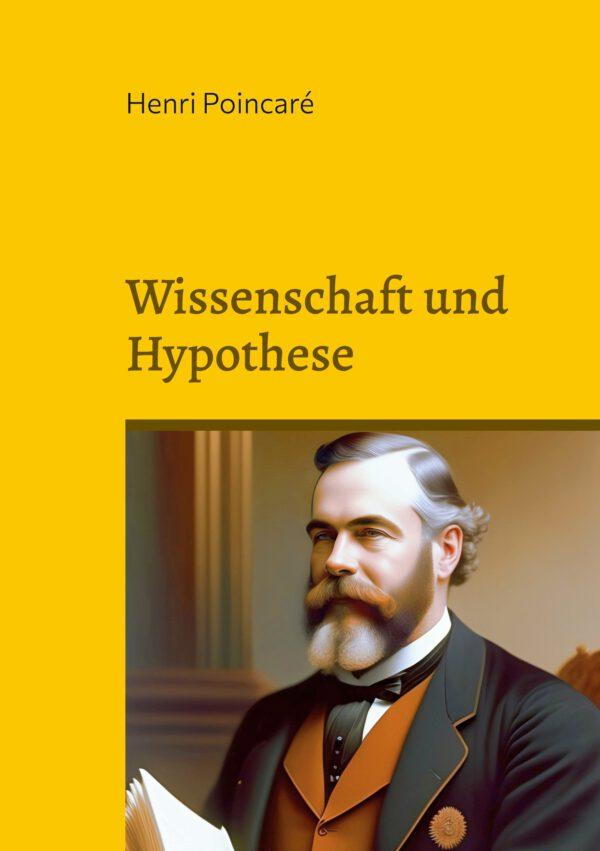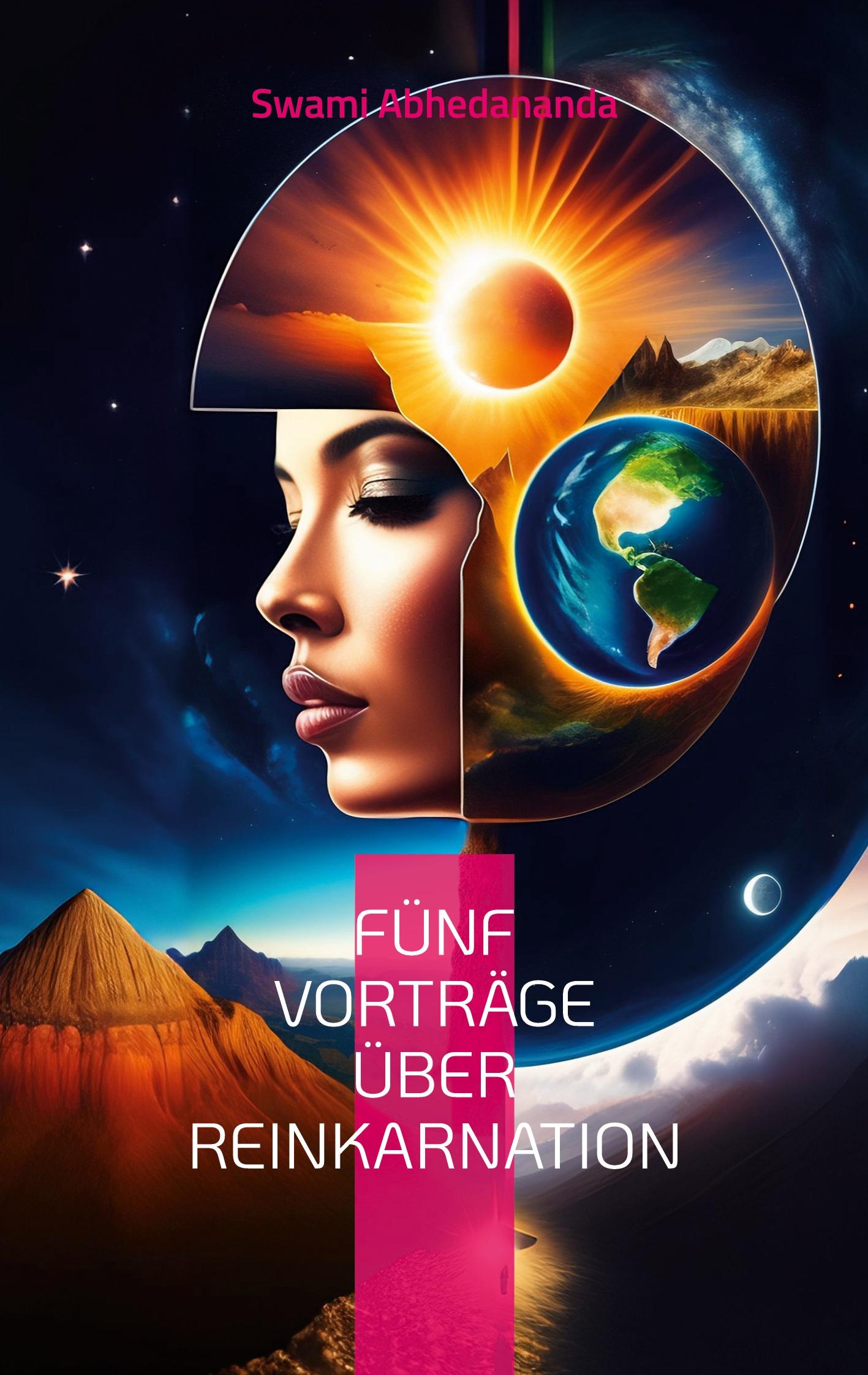Matthias Mayer ist ein aufmerksamer Beobachter der aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere wenn es um die Erstellung von Literatur geht. In seinen Ausführungen beschreibt er die von KI verfassten Bücher als Produkte, die sich in einem Spannungsfeld zwischen der Unwahrhaftigkeit und dem Verdacht der Plagiatsvorwürfe bewegen. Mayer nimmt sich die Zeit, diese neuartigen Werke einer eingehenden Analyse zu unterziehen, um deren Qualität und Authentizität zu bewerten.
In den letzten Jahren hat die technologische Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz rasant zugenommen. Programme, die in der Lage sind, Texte zu generieren, haben die Art und Weise verändert, wie Inhalte erstellt werden. Diese Technologien können in der Lage sein, Geschichten, Artikel oder sogar Gedichte zu schreiben, die auf den ersten Blick ansprechend wirken. Mayer stellt jedoch die Frage, ob diese Texte wirklich originär sind oder ob sie lediglich eine Ansammlung von bereits existierenden Ideen und Formulierungen darstellen.
Ein zentrales Argument von Mayer ist, dass KI-generierte Inhalte oft einen Mangel an Tiefe und echtem Verständnis aufweisen. Während Menschen aus ihren Erfahrungen schöpfen und komplexe emotionale und intellektuelle Schichten in ihre Werke einfließen lassen, sind KI-Modelle darauf programmiert, Muster zu erkennen und diese nachzuahmen. Das Ergebnis sind Texte, die zwar grammatikalisch korrekt und manchmal sogar stilistisch ansprechend sind, jedoch oft flach und ohne echte Substanz erscheinen. Mayer vergleicht diese Kreationen mit einer Art literarischem Fast Food: Sie sind schnell zubereitet, befriedigen den momentanen Hunger nach Informationen oder Unterhaltung, hinterlassen jedoch einen faden Nachgeschmack.
Ein weiterer Aspekt, den Mayer kritisch beleuchtet, ist die Frage der Urheberschaft und der ethischen Verantwortung. Wenn ein KI-System ein Buch verfasst, stellt sich die Frage, wem das Werk gehört. Ist es der Entwickler der KI, der das Programm geschaffen hat? Oder gehört es denjenigen, deren Inhalte als Trainingsdaten verwendet wurden? Diese Fragen sind nicht nur rechtlicher Natur, sondern werfen auch moralische Bedenken auf. Mayer argumentiert, dass die Wertschätzung für die Kunst des Schreibens und die Faszination für die Kreativität des Menschen in Gefahr geraten, wenn wir uns zu sehr auf KI verlassen, um Geschichten zu erzählen.
Mayer fordert daher eine differenzierte Betrachtung der von KI erzeugten Texte. Er plädiert für einen kritischen Umgang mit diesen neuen Medien und ermutigt die Leser, sich nicht blind auf die Inhalte zu verlassen, die aus diesen Maschinen hervorgehen. Es ist wichtig, die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie zu erkennen und zu verstehen, dass das Lesen eines KI-generierten Buches kein Ersatz für die Erlebnisse und Perspektiven ist, die Menschen in ihre Werke einfließen lassen.
Zudem weist Mayer darauf hin, dass die Verwendung von KI in der Literatur auch eine Chance darstellen kann. Sie könnte als Werkzeug dienen, um kreative Prozesse zu unterstützen oder neue Inspirationen zu liefern, ohne jedoch die Rolle des menschlichen Autors zu verdrängen. In einem idealen Szenario könnte eine symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Maschine entstehen, in der beide voneinander lernen und profitieren.
Insgesamt betrachtet Mayer die gegenwärtige Entwicklung im Bereich der KI und Literatur mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier. Er erkennt die Innovationskraft, die in diesen Technologien steckt, warnt jedoch vor einer unkritischen Akzeptanz. Die Literatur sollte nicht nur als Ansammlung von Wörtern betrachtet werden, sondern als Ausdruck des menschlichen Geistes, der untrennbar mit den Erfahrungen, Emotionen und Gedanken des Schriftstellers verbunden ist. Nur so kann die literarische Kunst ihre volle Tiefe und Bedeutung entfalten.