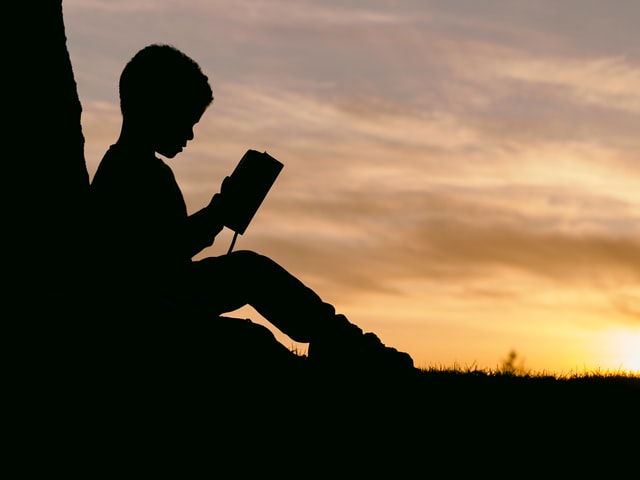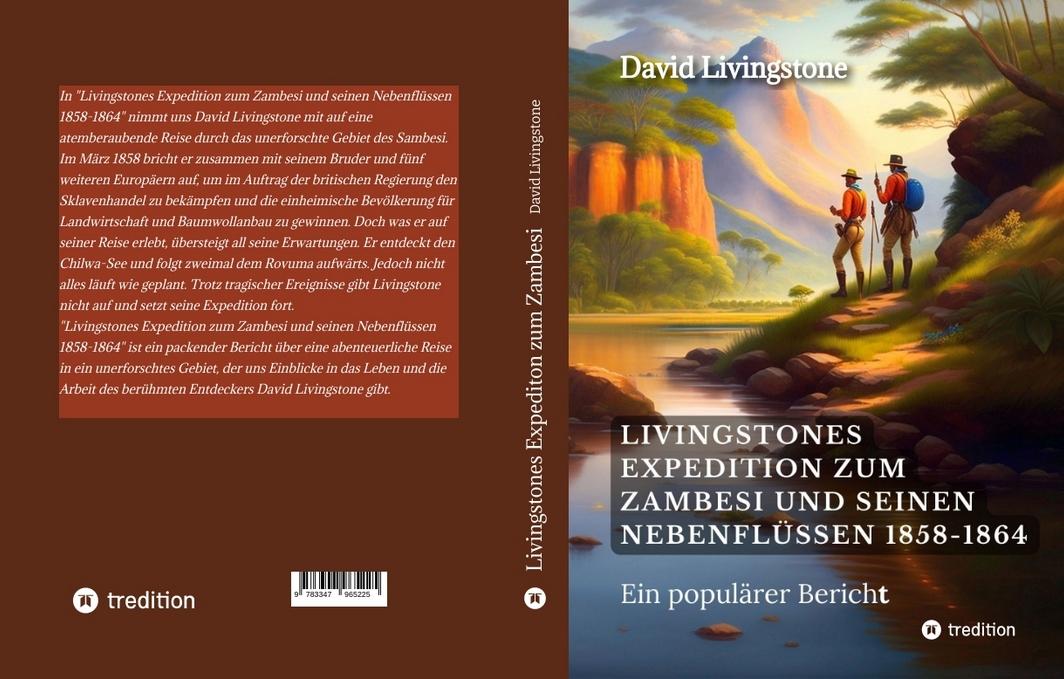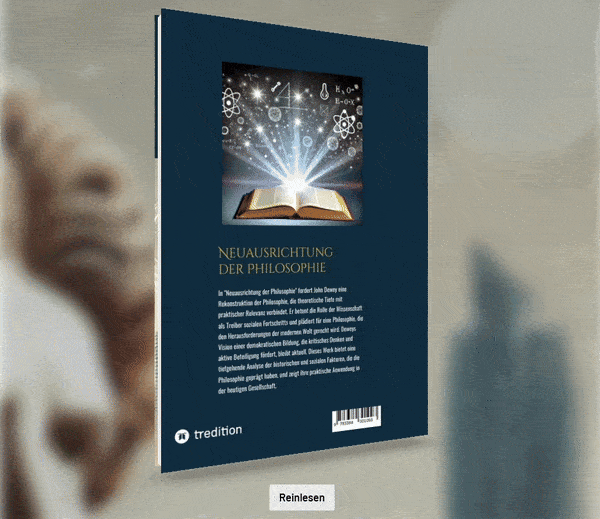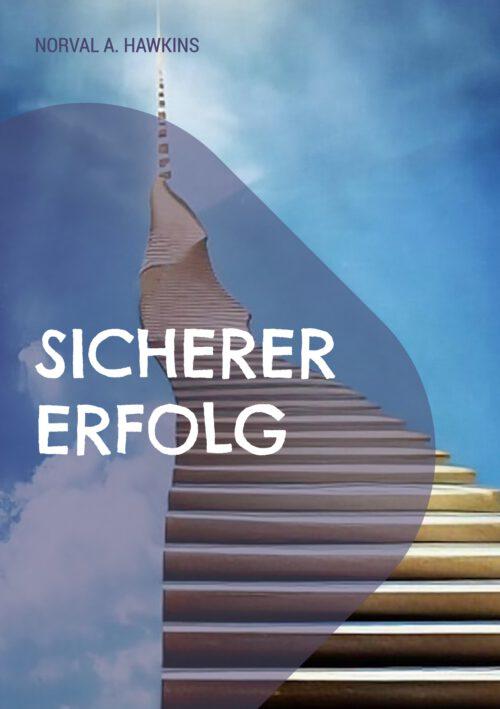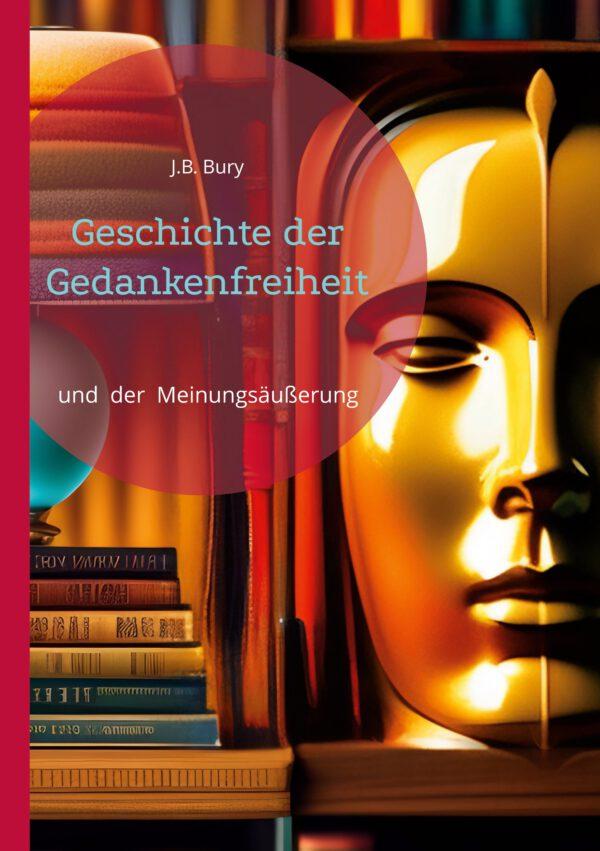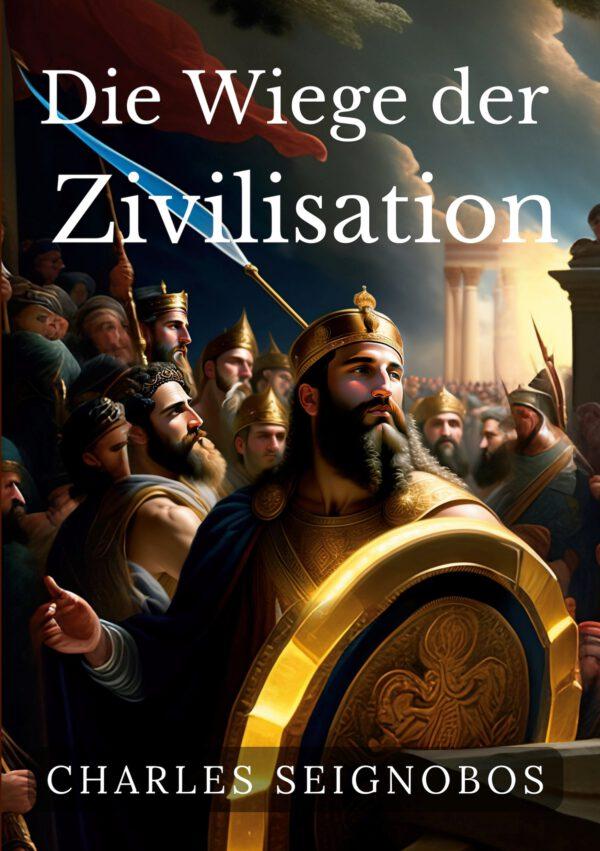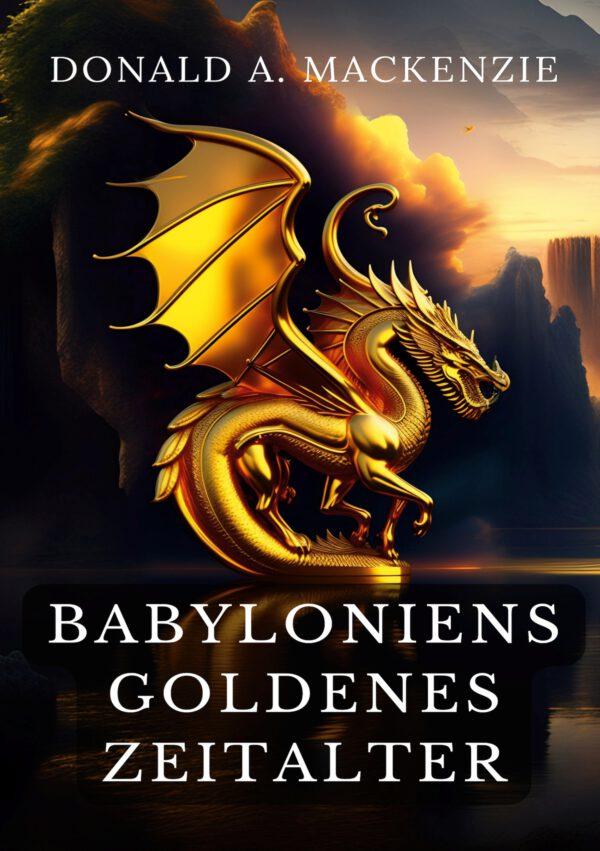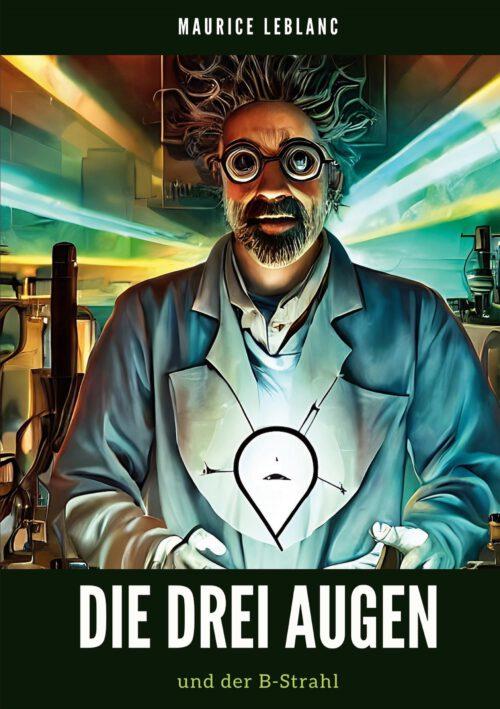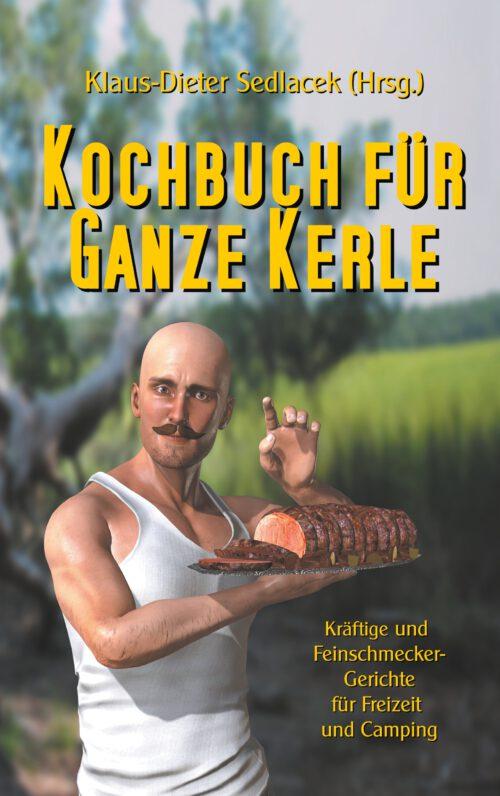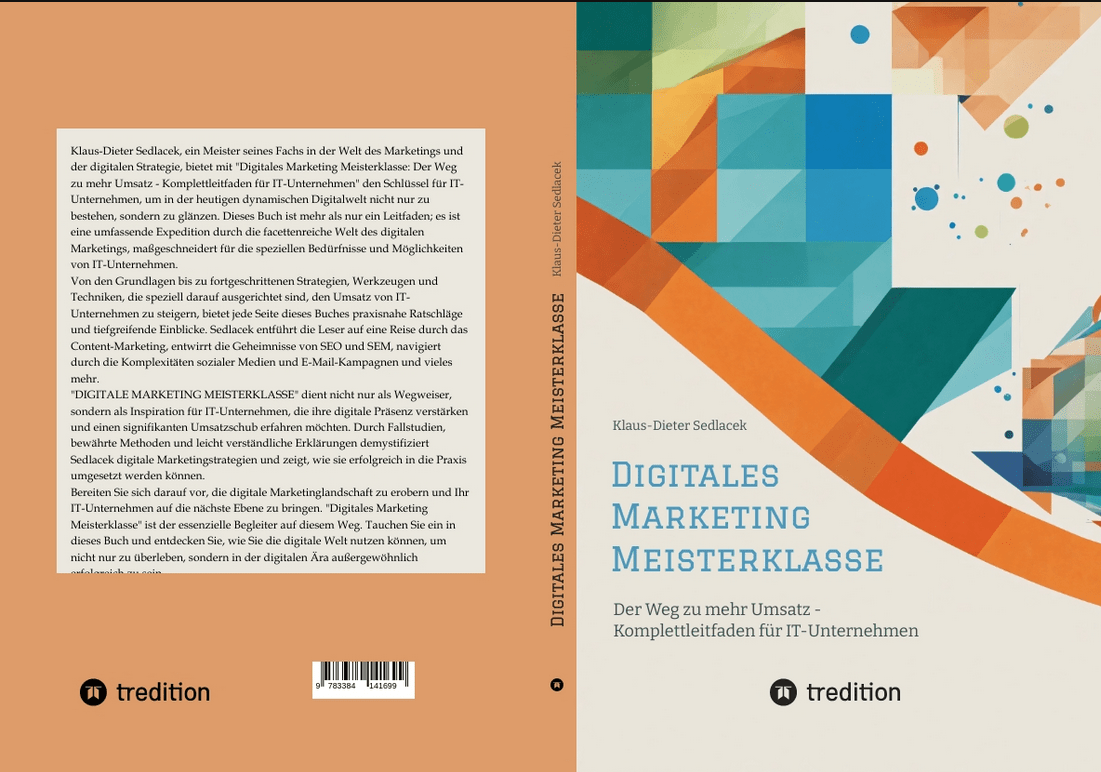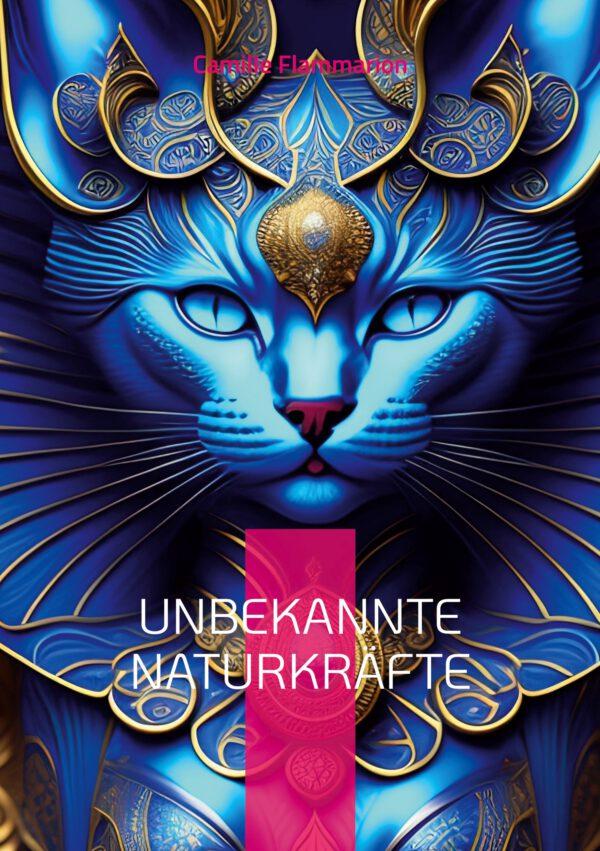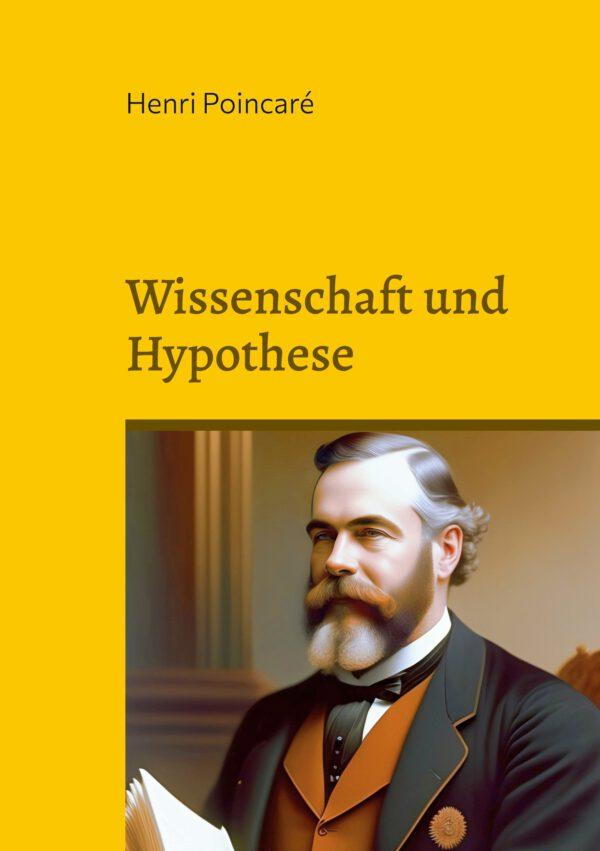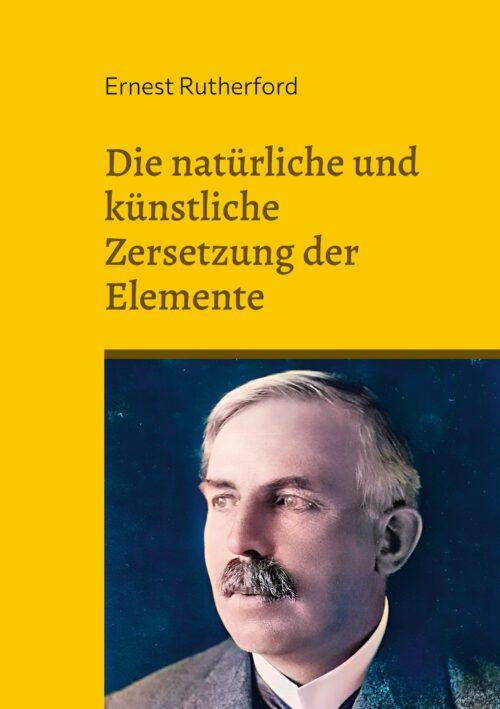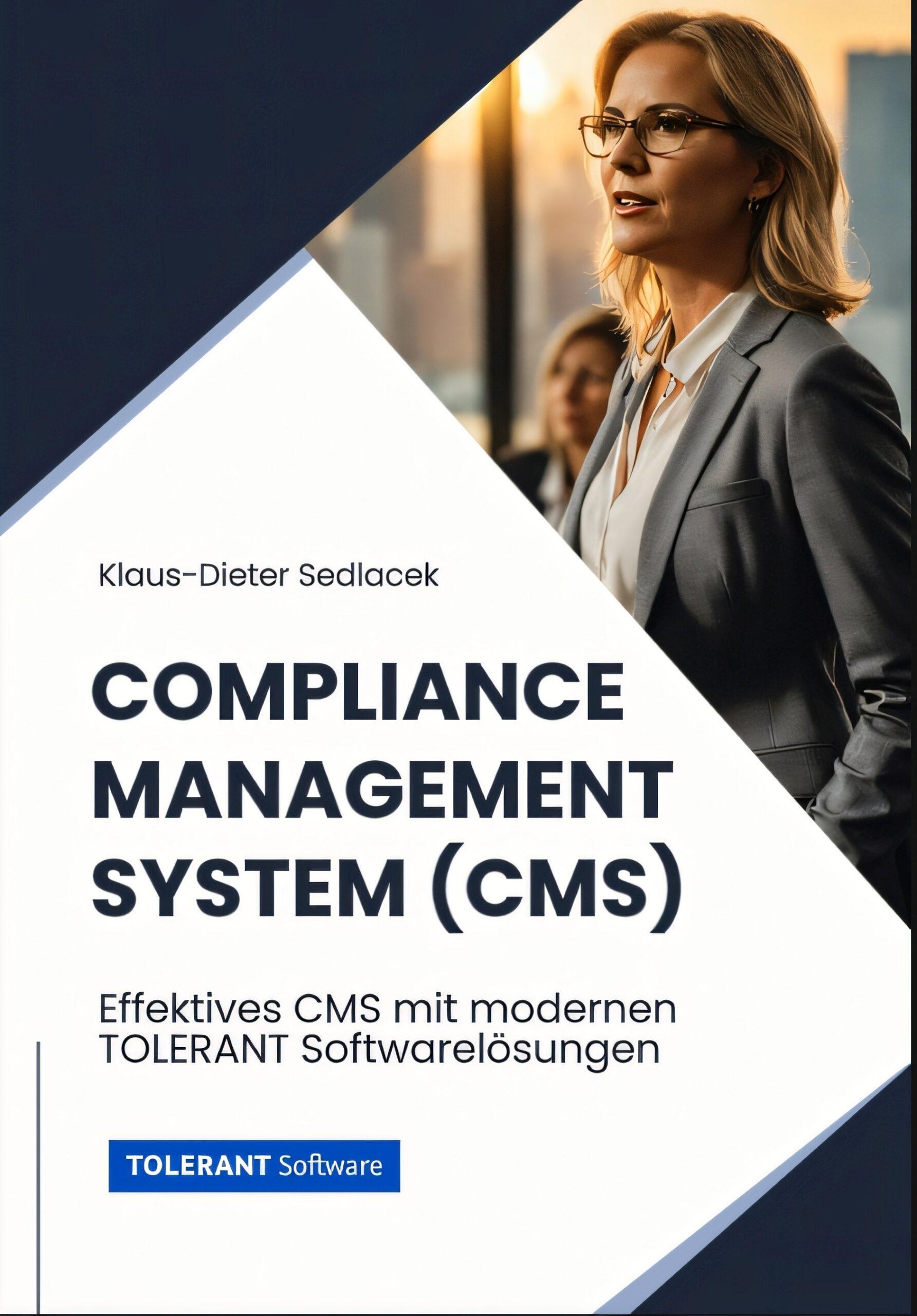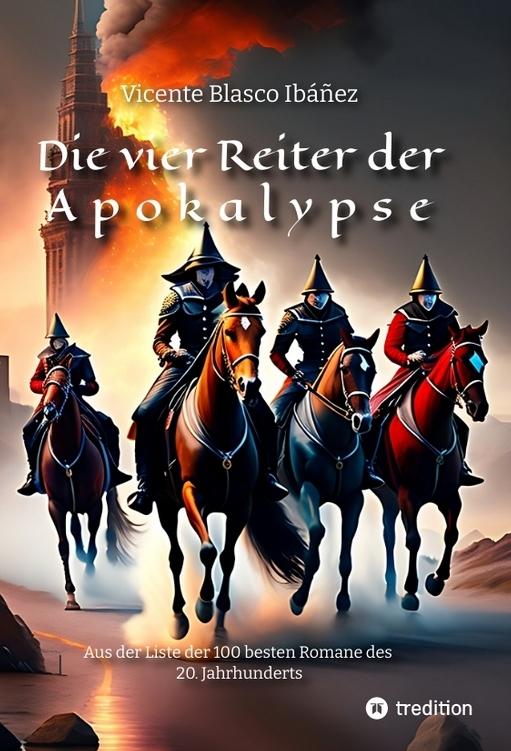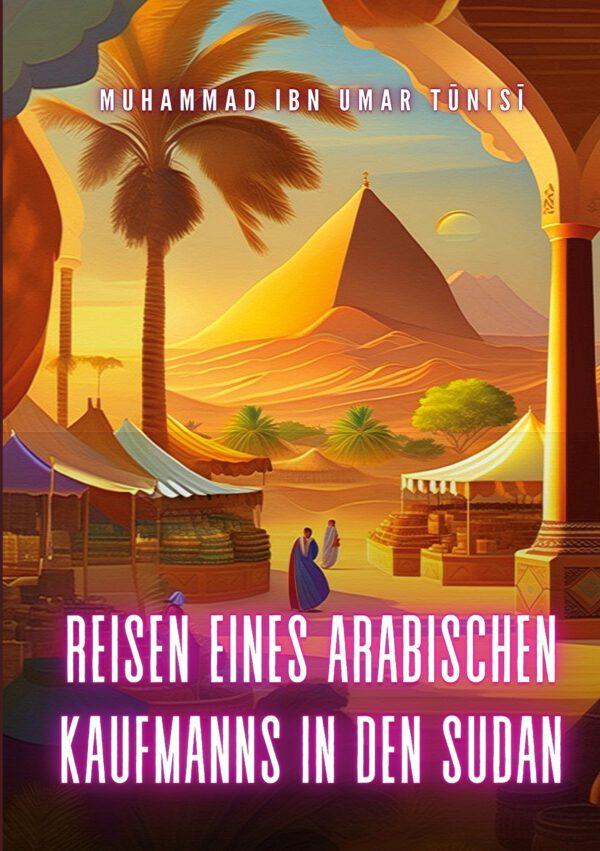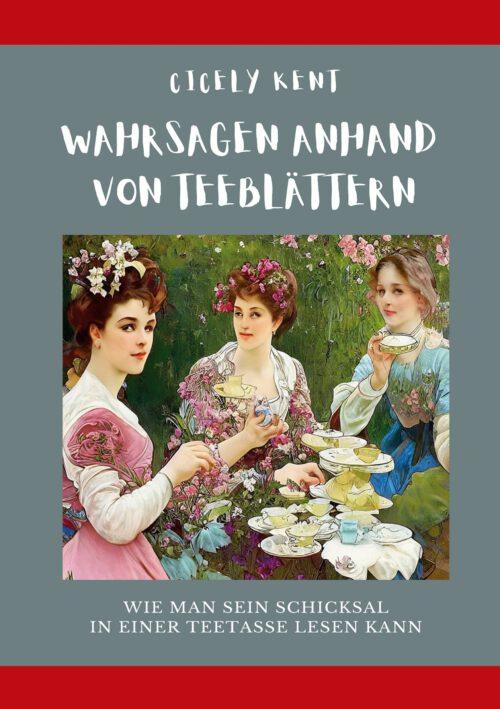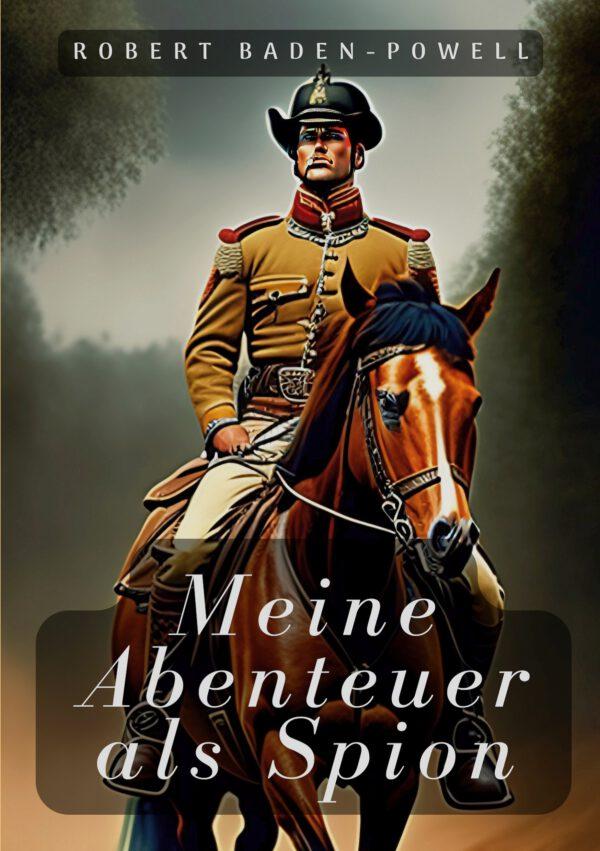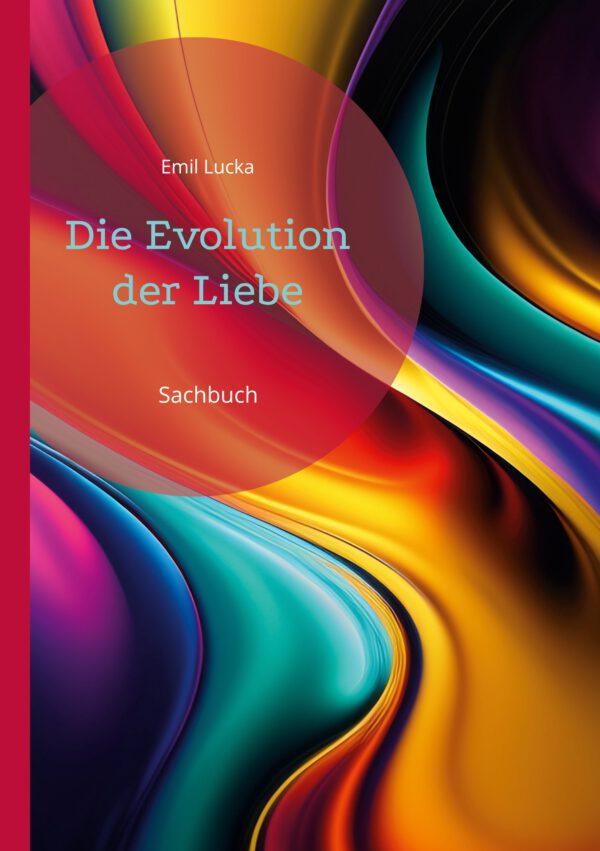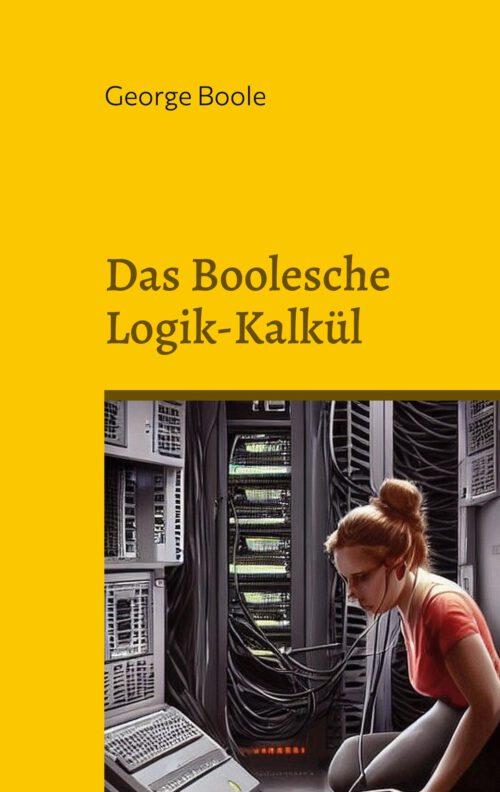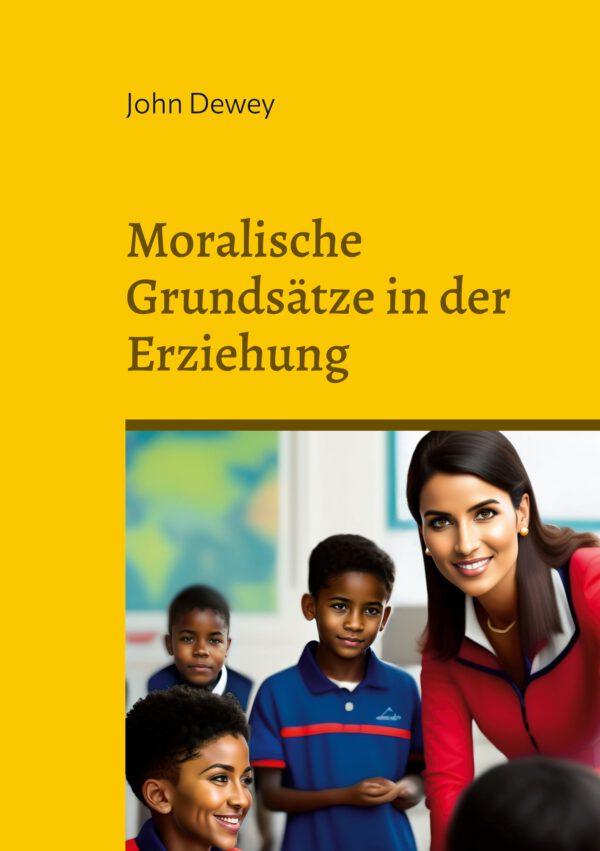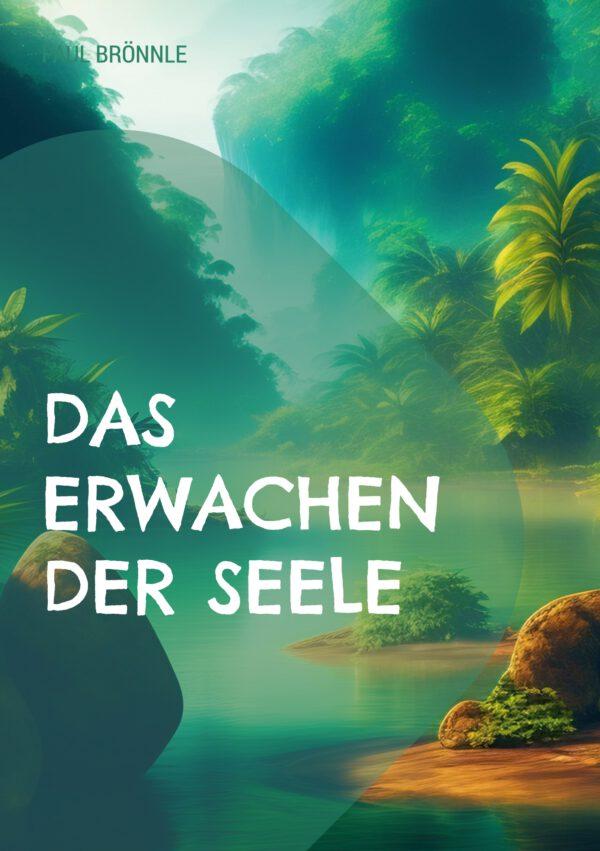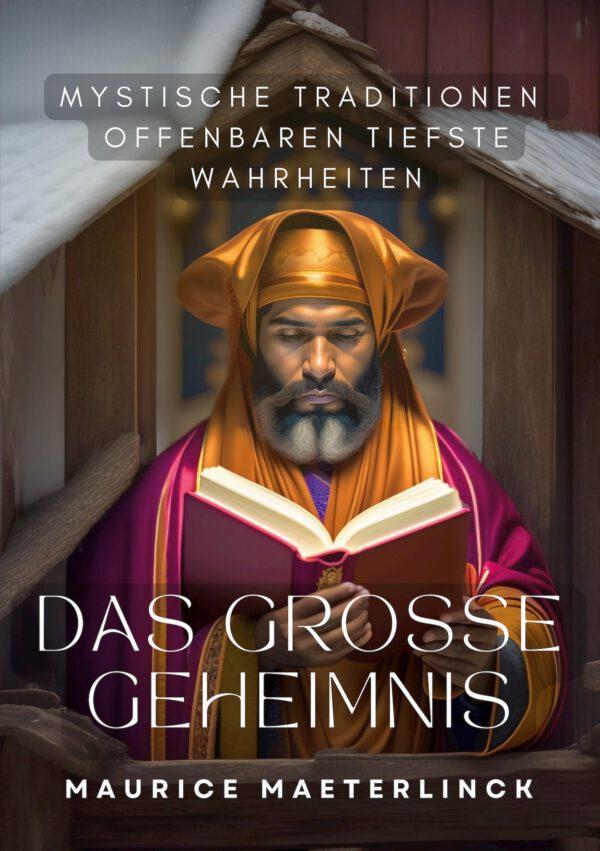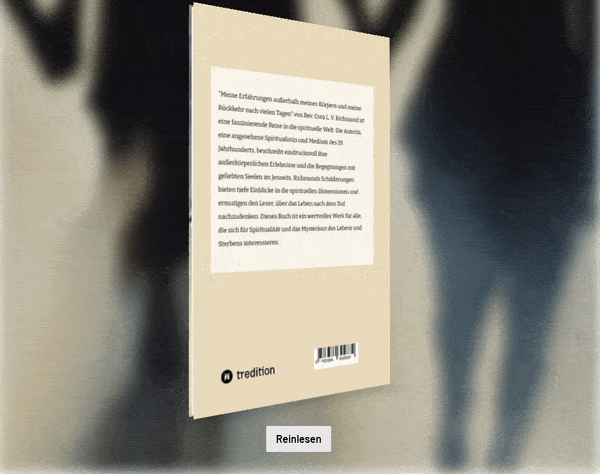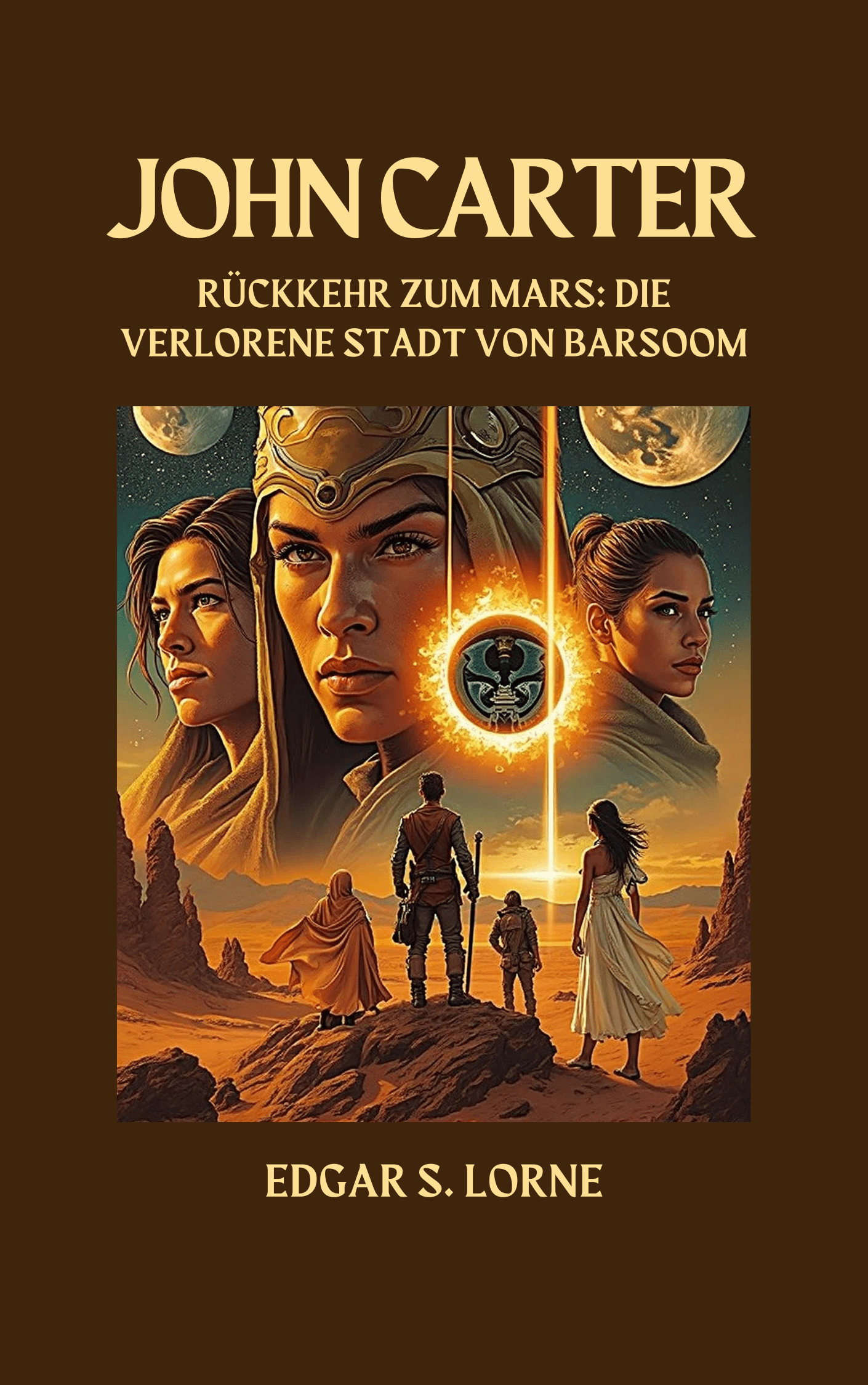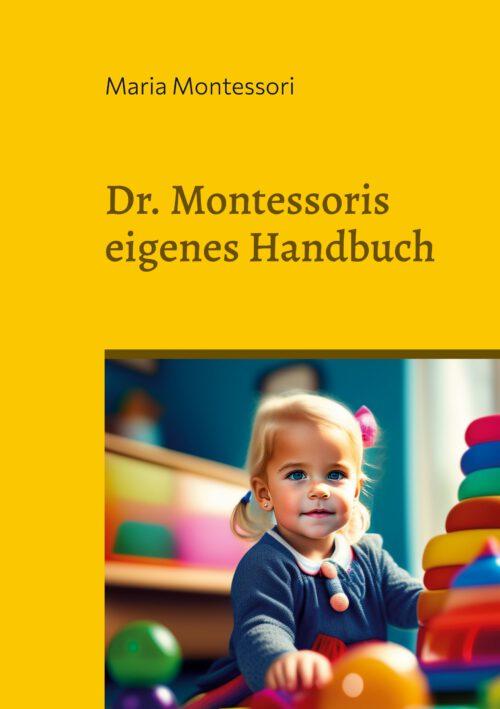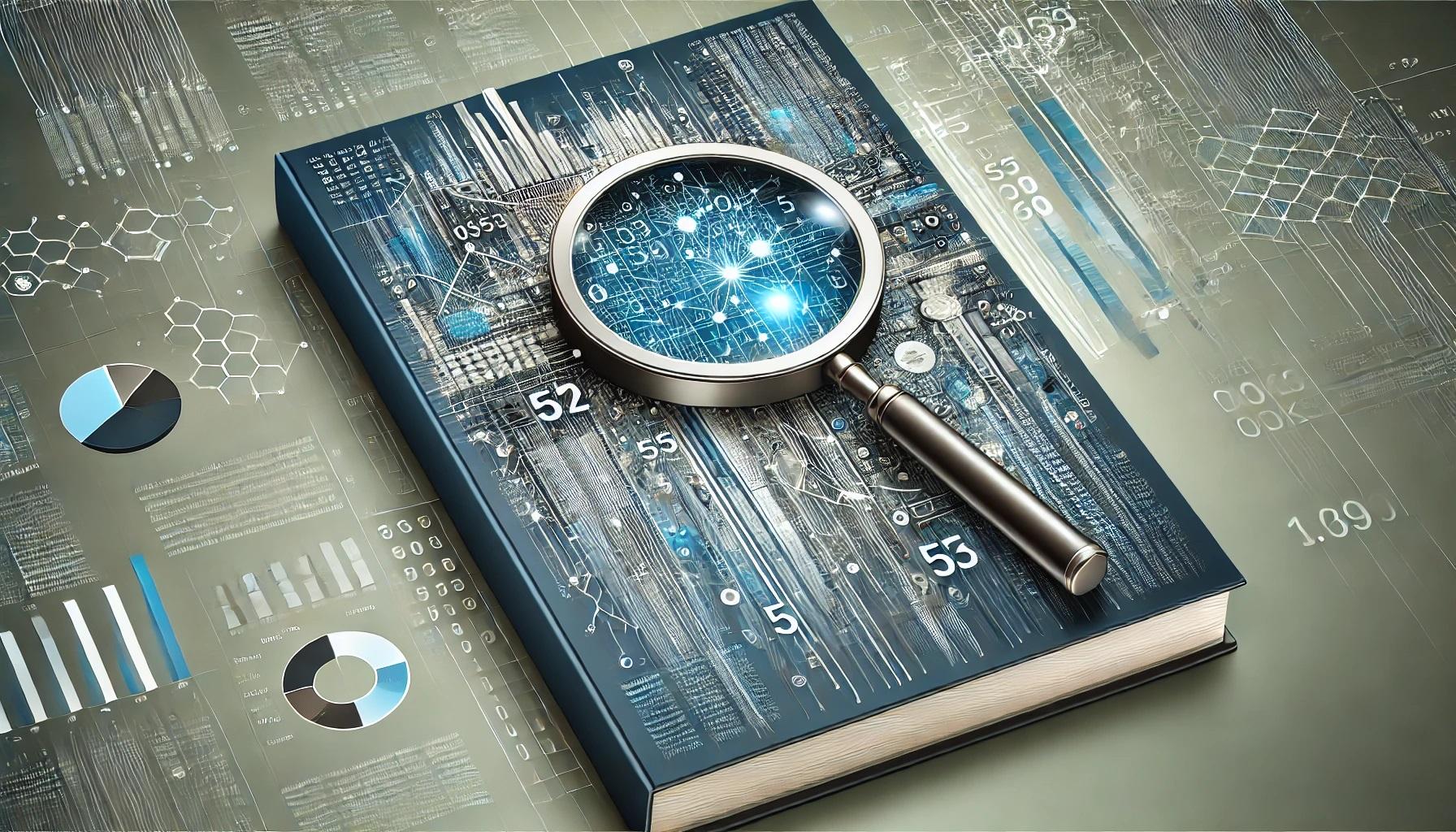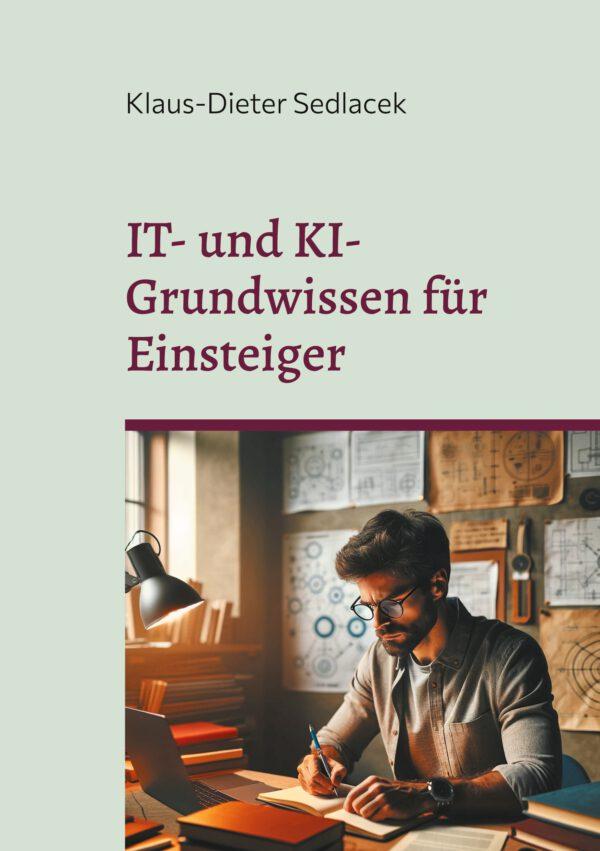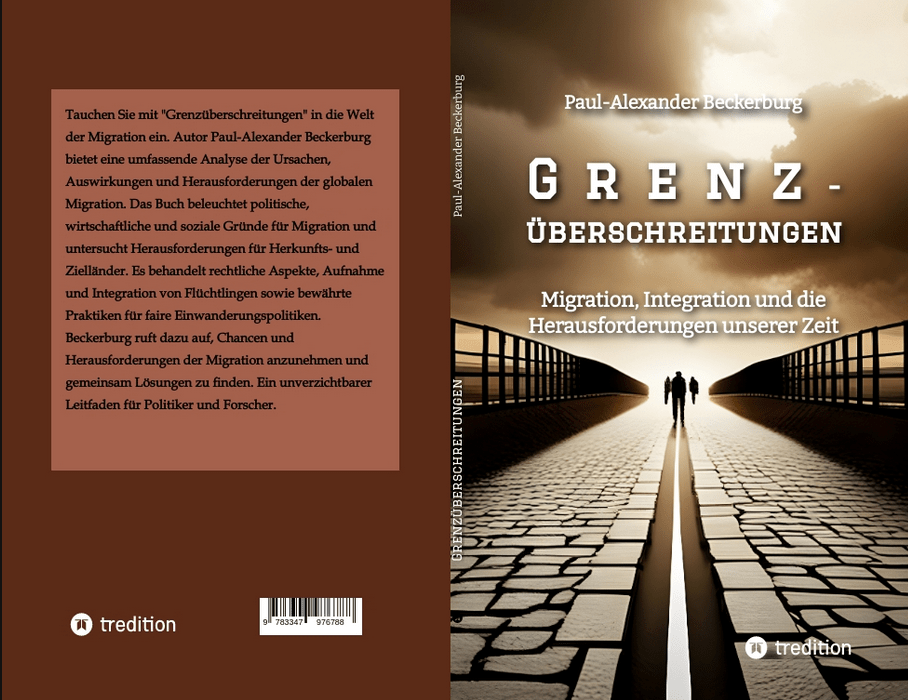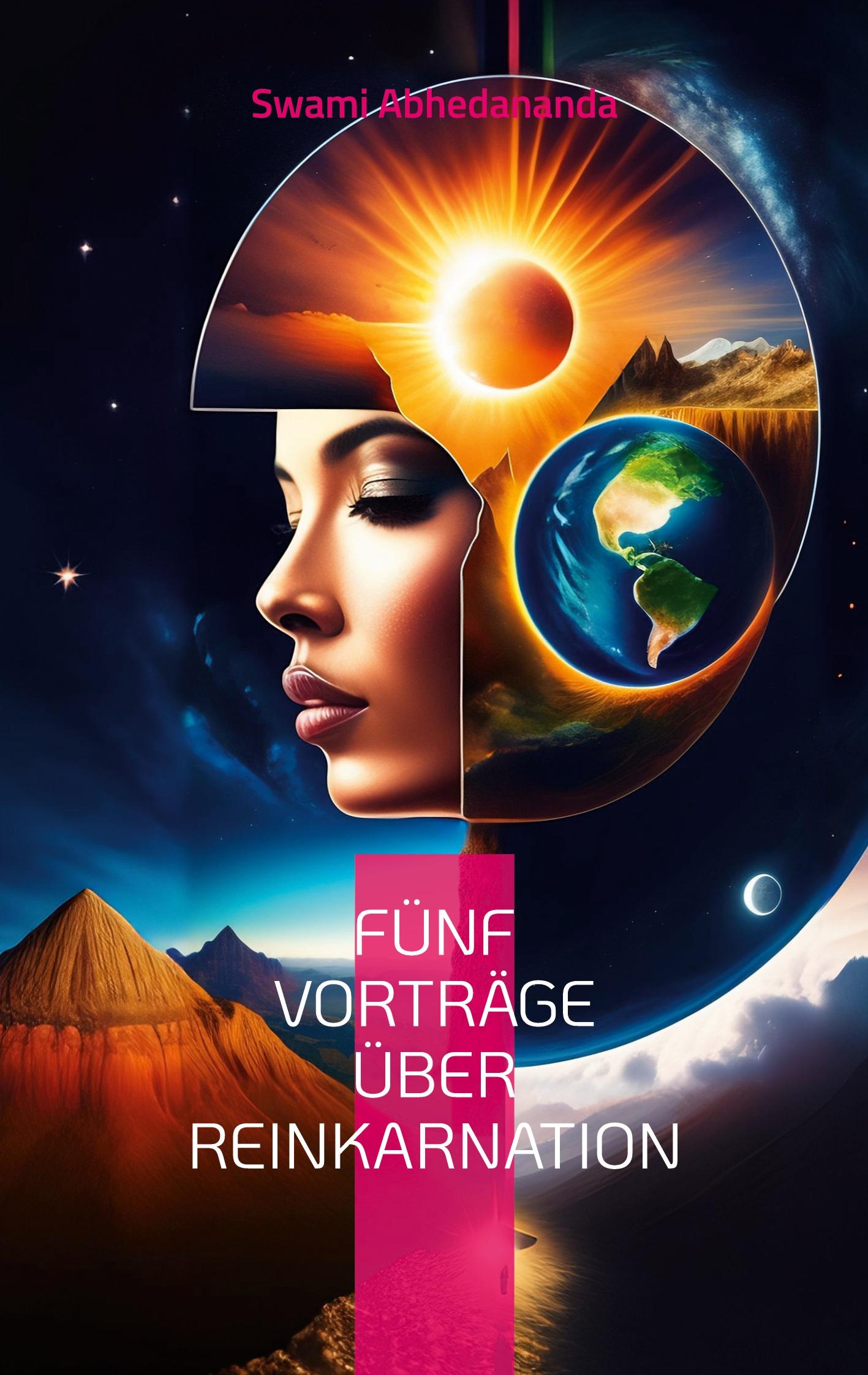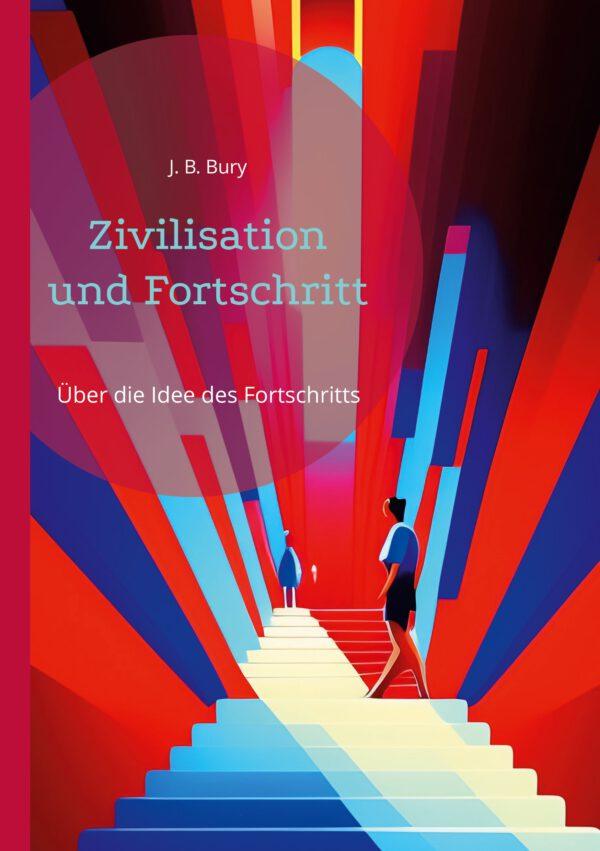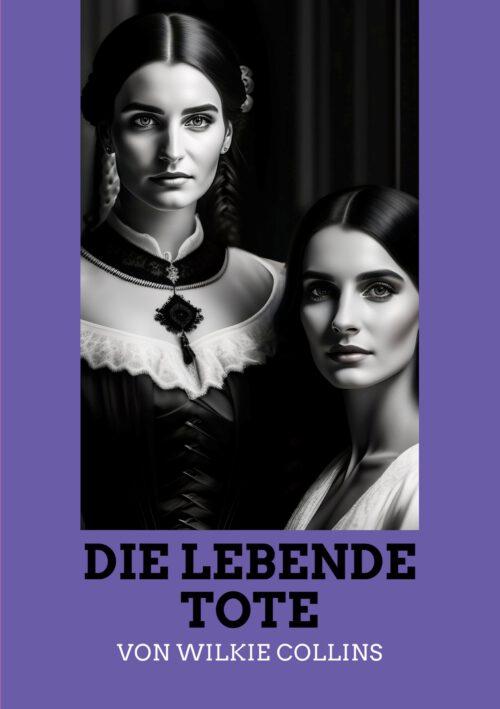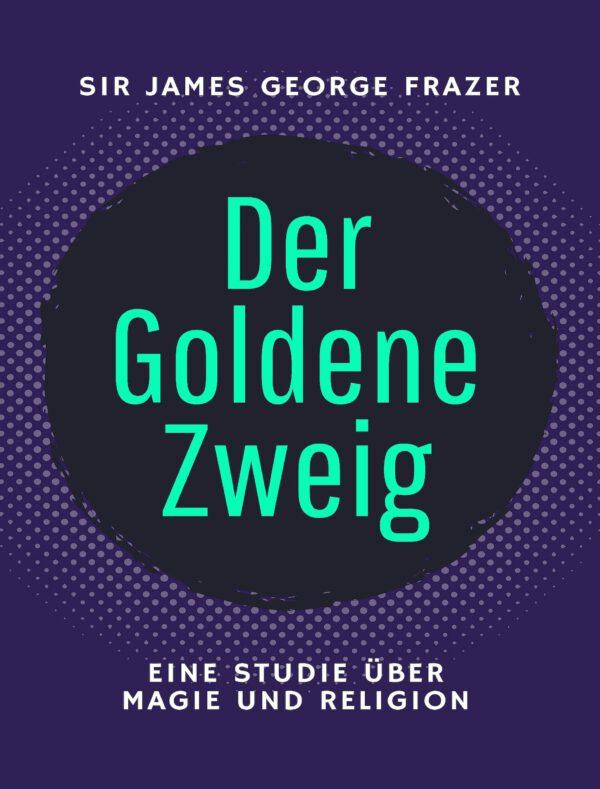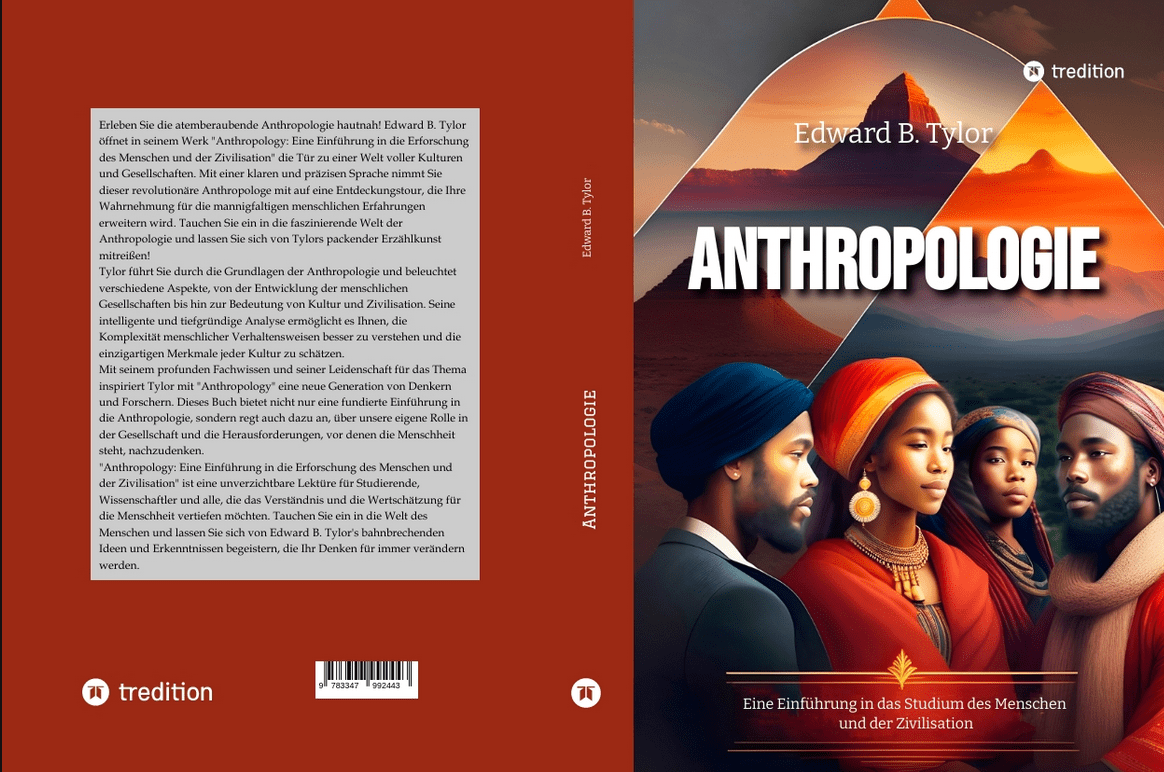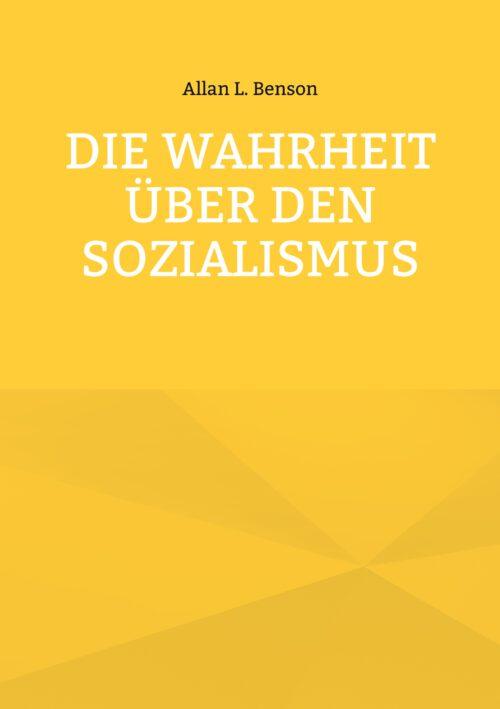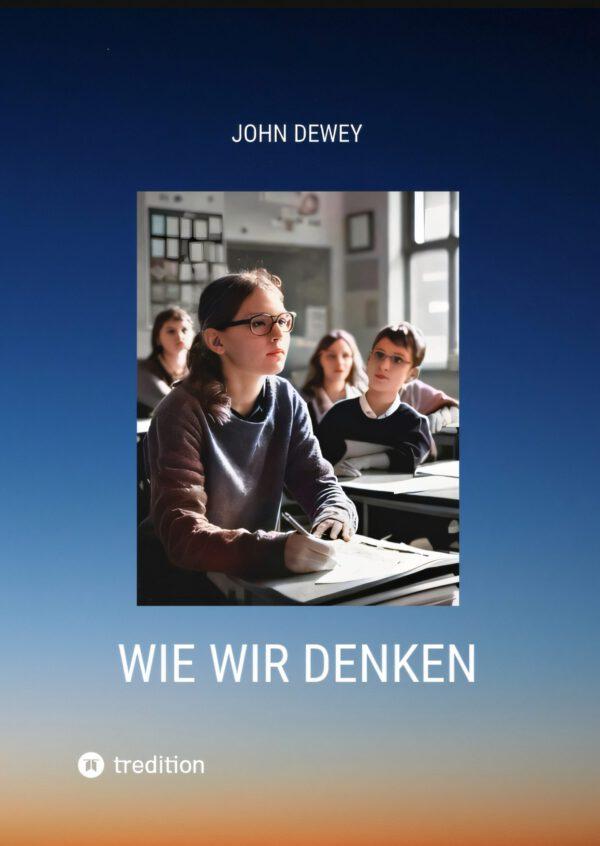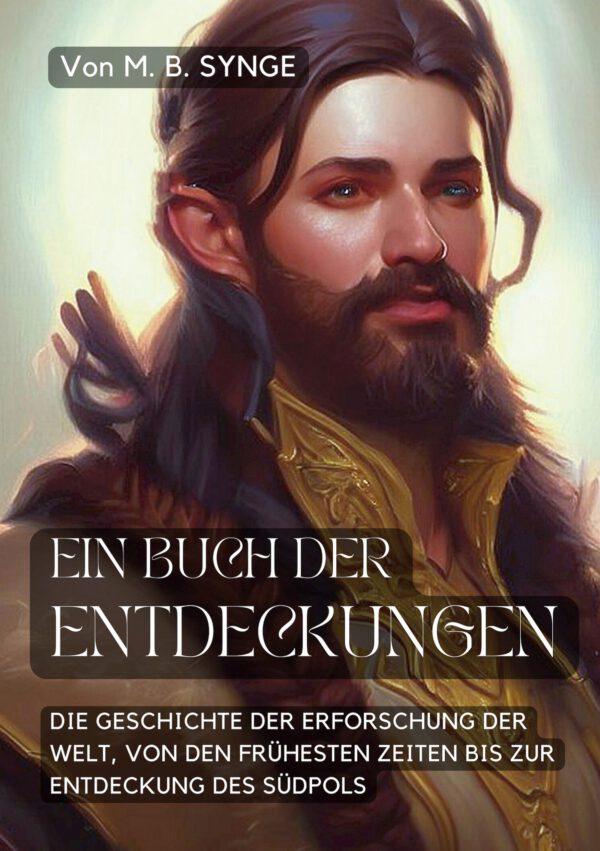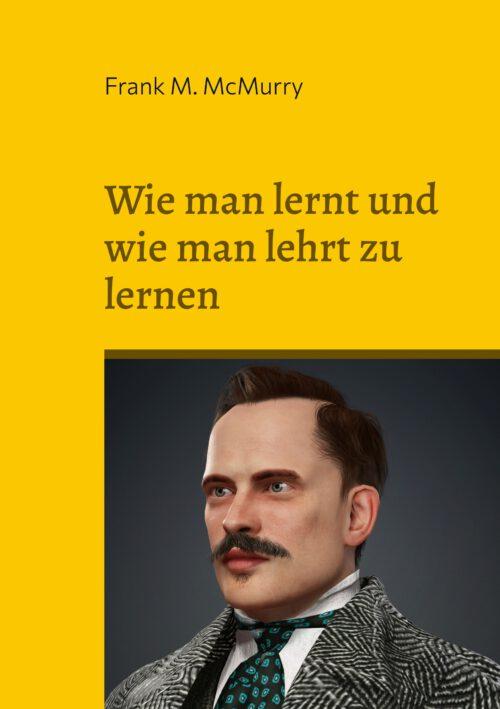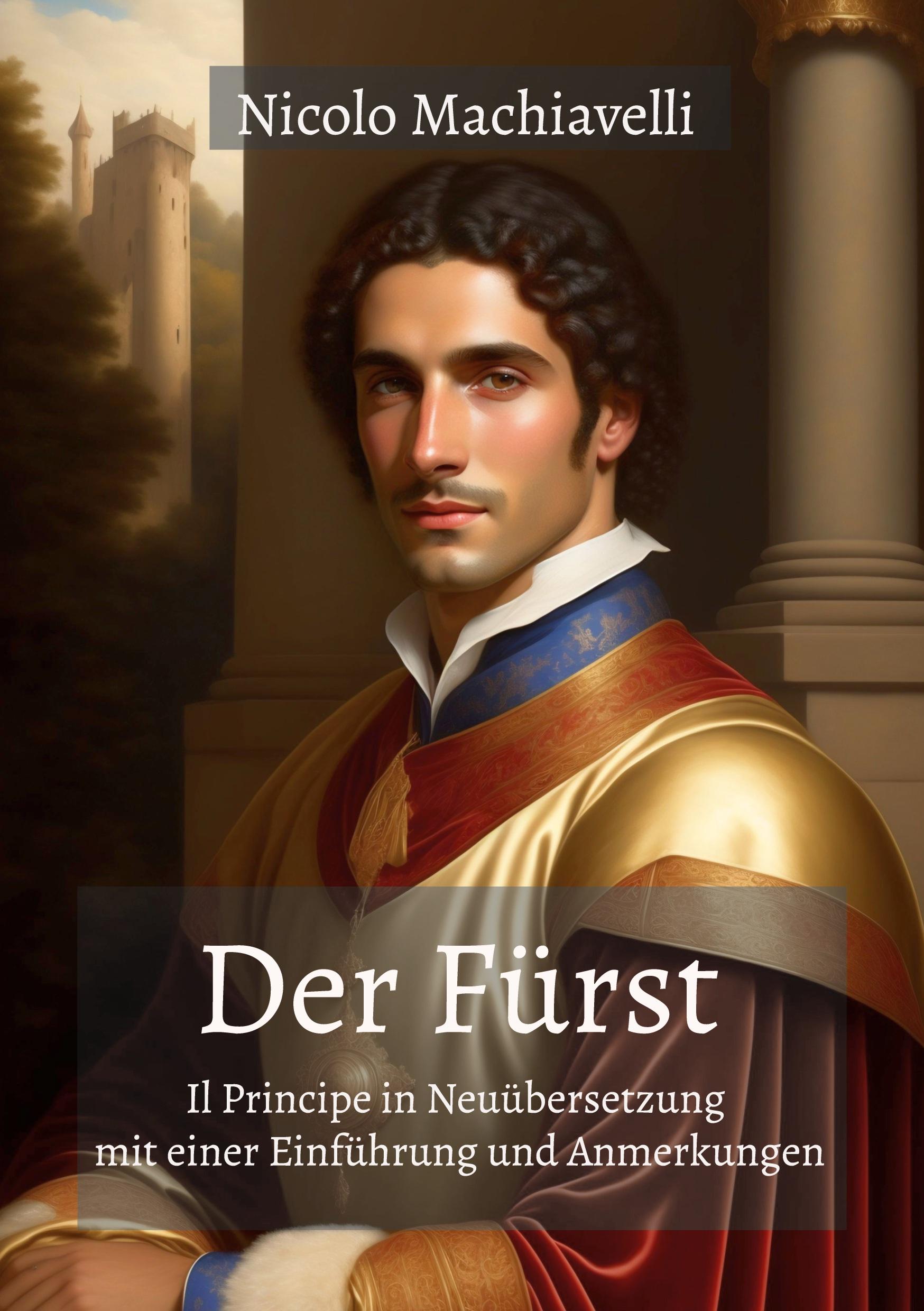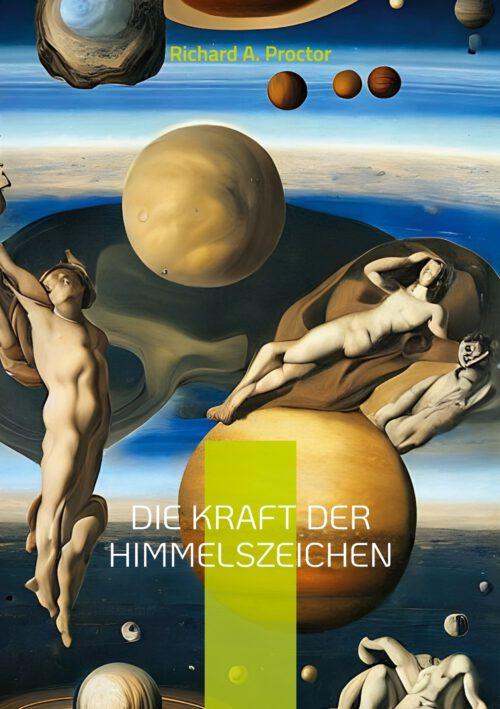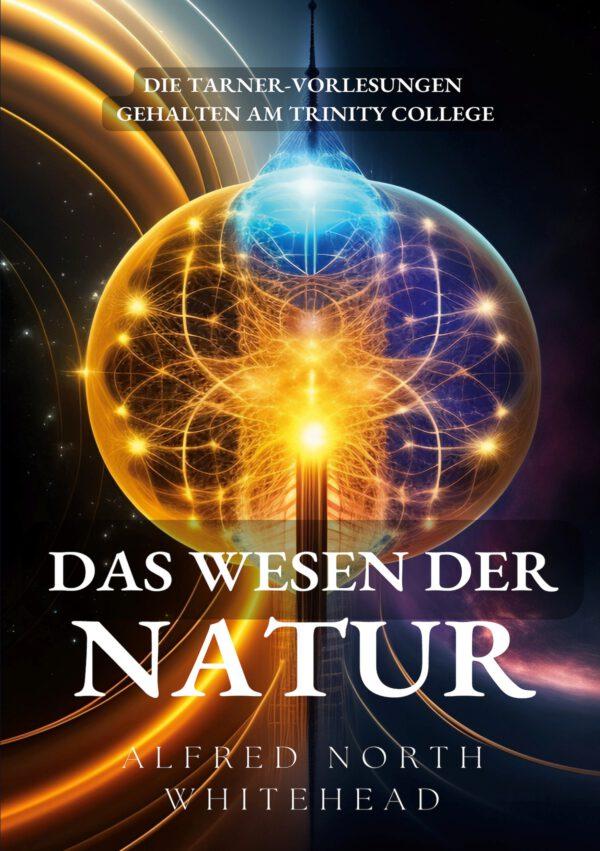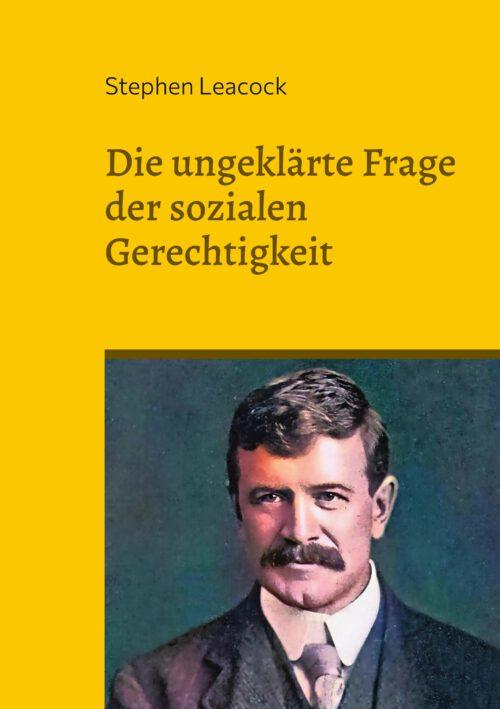Der Galerist Johann König und seine Frau Lea König haben in ihrem Rechtsstreit gegen den Autor Christoph Peters eine neue Phase erreicht. Nachdem sie in erster Instanz vor dem Landgericht Hamburg sowie in der Berufung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht mit ihrem Antrag auf eine einstweilige Verfügung gescheitert sind, haben sie nun den Schritt gewagt, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen.
Der Hintergrund dieser rechtlichen Auseinandersetzung liegt im Inhalt des Romans „Innerstädtischer Tod“, in dem bestimmte Passagen von den Eheleuten König als diffamierend empfunden werden. Sie argumentieren, dass die Darstellungen im Buch ihrer Reputation und ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit schaden, und fordern daher rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung des Werkes. Die beiden Galeristen, die in der Kunstszene bekannt sind, sehen sich durch die Inhalte des Romans in ihrer Ehre und ihrem geschäftlichen Ansehen bedroht.
In den vorangegangenen Gerichtsverfahren haben die Richter entschieden, dass die von den Kings vorgebrachten Argumente nicht ausreichend überzeugend seien, um die beantragte einstweilige Verfügung zu rechtfertigen. Das Landgericht Hamburg wies die Klage zunächst zurück und stellte fest, dass die Meinungsfreiheit des Autors in diesem Fall überwiege. Auch das Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte diese Entscheidung und stellte klar, dass literarische Werke oft provokante Inhalte beinhalten, die nicht per se als verleumderisch oder ehrverletzend gelten können.
Die Entscheidung der beiden Galeristen, den Weg bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, zeigt ihre Entschlossenheit, gegen die vermeintliche Ungerechtigkeit zu kämpfen, die sie in Peters’ Roman sehen. Sie hoffen, dass das Höchstgericht eine andere Sichtweise einnimmt und die Notwendigkeit erkennt, den Schutz der persönlichen Ehre und Reputation in der Kunst- und Literaturszene zu stärken.
Das Thema der Balance zwischen Meinungsfreiheit und dem Recht auf Ehre wird in diesem Fall besonders deutlich. Während die Freiheit des Ausdrucks für Autoren von höchster Bedeutung ist, müssen auch die Rechte von Einzelpersonen, die möglicherweise in einem negativen Licht dargestellt werden, gewahrt bleiben. Dieser Konflikt ist nicht nur für die Beteiligten von Bedeutung, sondern wirft auch grundlegende Fragen über die Grenzen der künstlerischen Freiheit und die Verantwortung von Autoren auf.
Der Ausgang des Verfahrens könnte weitreichende Folgen für die Literaturszene in Deutschland haben. Sollte das Bundesverfassungsgericht zugunsten der Königs entscheiden, könnte dies bedeuten, dass Autoren künftig vorsichtiger mit der Darstellung realer Personen umgehen müssen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Auf der anderen Seite könnte eine Entscheidung, die die Meinungsfreiheit stärkt, ein wichtiges Signal für die Kreativbranche senden, dass künstlerische Ausdrucksformen auch kontroverse Themen ansprechen dürfen, ohne Angst vor Repressalien haben zu müssen.
Die Debatte um die Grenzen der kreativen Freiheit ist nicht neu, doch sie erhält in diesem speziellen Fall eine besondere Brisanz. Der Roman „Innerstädtischer Tod“ ist nicht nur ein literarisches Werk, sondern auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Realität, die durch Kunst und Literatur reflektiert wird. Dies wirft die Frage auf, inwiefern Kunst und Realität miteinander verwoben sind und wie Autoren mit den Auswirkungen ihrer Werke auf das Leben realer Menschen umgehen sollten.
In den kommenden Monaten wird das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich über die Beschwerde der Königs entscheiden. Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet, da sie möglicherweise nicht nur das Schicksal von Christoph Peters’ Roman beeinflussen, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für zukünftige literarische Werke in Deutschland neu definieren könnte. In einer Zeit, in der der Dialog über Kunst, Freiheit und Verantwortung immer wichtiger wird, könnte dieser Fall als richtungsweisend für die Zukunft der literarischen und künstlerischen Ausdrucksformen in Deutschland in die Geschichte eingehen.