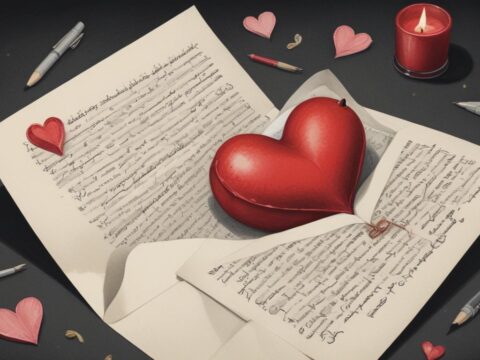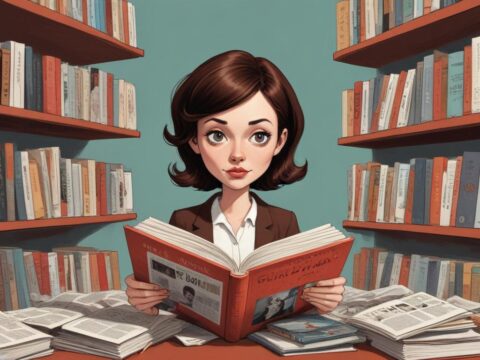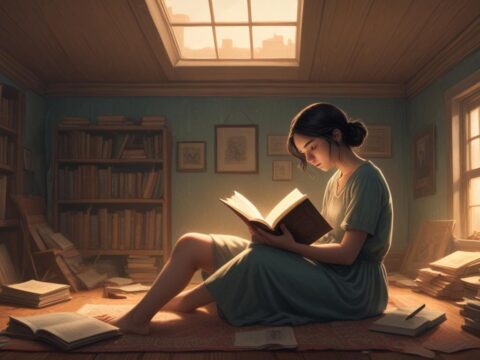In ihrem ersten Roman „Alles ganz schlimm“ entführt uns die Autorin Julia Pustet in die komplexe Welt der Mittdreißigerin Susanne, die sich in einem Geflecht aus queerfeministischen Bingo-Abenden, politischen Gruppierungen und persönlichen Krisen wiederfindet. Diese tragisch-komische Erzählung beleuchtet nicht nur die Herausforderungen im Leben der Protagonistin, sondern thematisiert auch die gegenwärtigen innerlinken Konflikte und die damit verbundenen sozialen Dynamiken.
Die Handlung entfaltet sich, als Susannes frühere Freundin Stella ihre autobiografischen Erlebnisse als Sexarbeiterin in einem Essay unter dem Titel „Die Bar Paris“ veröffentlicht, ohne Susanne die gebührende Anerkennung zukommen zu lassen. Diese Aneignung bringt Susannes Leben aus der Balance und führt zu einem dramatischen Eklat, in dem sie plötzlich als diejenige dasteht, die des Betrugs und der Lüge bezichtigt wird. Ihre Freund*innen, anstatt ein klärendes Gespräch zu suchen, stellen diffuse Vorwürfe auf und verweigern die Auseinandersetzung. Diese Dynamik verdeutlicht die angespannten Beziehungen, die sich in einem Umfeld entwickeln, das von politischen Idealen und persönlichen Konflikten geprägt ist.
Julia Pustet, die bereits als freie Journalistin und Influencerin in der linken Szene bekannt ist, greift in ihrem Debüt nicht nur individuelle Schicksale auf, sondern entblößt auch die Mechanismen, die die gegenwärtige Diskursstruktur im digitalen Raum prägen. Ihre Protagonistin navigiert durch schwierige Freundschaften und Beziehungen, während sie gleichzeitig mit ihrer familiären Vergangenheit und den Folgen ihrer sexuellen Erfahrungen ringt. Pustet nutzt diese persönlichen Erlebnisse, um die innerlinken Auseinandersetzungen über Feminismus, Solidarität und Privilegien zu reflektieren. Der Roman offenbart, wie identitätsstiftende Themen und gesellschaftliche Erwartungen das individuelle Erleben beeinflussen.
Ein besonders anschauliches Beispiel für Pustets Stil ist das Gespräch zwischen Susanne und ihrer Freundin Trixi während eines Klinikaufenthalts. Hier kulminieren die Themen Verleumdung und Verantwortung in einer beinahe komödiantischen Reflexion über die linke Diskussionskultur. Trixis empathische, aber zugleich verworrene Argumentation verdeutlicht die Komplexität und manchmal auch die Absurdität der Debatten innerhalb der Szene. Diese Szenen spiegeln nicht nur die persönlichen Kämpfe der Protagonistin wider, sondern stellen auch die Frage nach der Deutungshoheit innerhalb der feministischen und linken Bewegungen.
Der Roman selbst ist ein facettenreiches Werk, das verschiedene Textformen miteinander verbindet. Neben der zentralen Erzählung gibt es Briefe, autobiografische Essays und Social-Media-Posts, die die narrative Struktur durchbrechen. Diese nicht-lineare Erzählweise sorgt für eine Desorientierung, die die innere Zerrissenheit und Isolation von Susanne eindrucksvoll widerspiegelt. Susannes Schreiben wird zu einem Akt der Selbstbehauptung, der ihr ermöglicht, ihre Emotionen zu verarbeiten und sich mit ihrer Realität auseinanderzusetzen.
Pustets Schreibstil ist geprägt von komplexen Satzstrukturen und reichen Beschreibungen, die das Erleben der Protagonistin greifbar machen. Sie thematisiert die Authentizität von Geschichten und die Frage, wer das Recht hat, über bestimmte Erfahrungen zu berichten. Dabei wird die Problematik des „authentischen“ Erzählens deutlich, die über den Roman hinausreicht und zum Nachdenken über gesellschaftliche Erwartungen an solche Geschichten anregt.
Die philosophischen Anklänge in den vorangestellten Zitaten von Goethe und Horkheimer/Adorno rahmen die Erzählung auf einer tieferen Ebene. Sie laden die Leser*innen dazu ein, die komplexen Themen von Wahrheit, Identität und Erzählung zu hinterfragen. Susannes Stimme wird zur List, einem strategischen Werkzeug, um sich in einer Welt zu behaupten, die oft ihre eigene Geschichte verzerrt. Ihr Schreiben ist ein Versuch, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig den Herausforderungen ihrer Umgebung gerecht zu werden.
„Alles ganz schlimm“ ist somit nicht nur eine Geschichte über persönliche und zwischenmenschliche Konflikte, sondern auch eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Themen Sprache, Identität und dem Streben nach Authentizität in einer komplexen Welt. Julia Pustets Debütroman fordert die Leserinnen heraus, die Mehrdeutigkeit des Erzählens zu akzeptieren und die Verantwortung von Autorinnen in der Konstruktion von Identität und Wahrheit kritisch zu reflektieren.