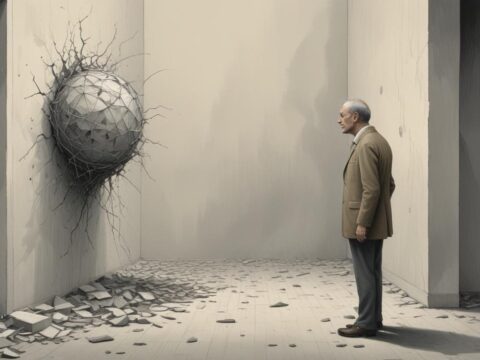Rebekka Endlers neues Sachbuch „Witches, Bitches, It-Girls“ ist eine ambitionierte, aber auch kontroverse Auseinandersetzung mit den patriarchalen Mythen und den gesellschaftlichen Vorstellungen über Frauen. Obwohl das Buch einige interessante Perspektiven bietet, bleibt es in vielerlei Hinsicht hinter den Erwartungen zurück und wirft Fragen auf, die über die behandelten Themen hinausgehen.
Endler, die bereits mit ihrem früheren Werk „Das Patriarchat der Dinge“ auf sich aufmerksam machte, versucht in diesem Band, eine breite Palette an Themen zu beleuchten, die von der Antike bis zur modernen Gesellschaft reichen. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Bild von Frauen und den patriarchalen Vorstellungen, die von Männern über sie geschaffen wurden. Der Titel des Buches deutet bereits auf die Vielfalt der Themen hin, die sich mit verschiedenen Aspekten der Frauenbilder und der damit verbundenen Mythen befassen.
Positiv hervorzuheben ist, dass Endler einige historische Figuren ins Rampenlicht rückt, die in der Geschichtsschreibung oft übersehen werden. Sie erwähnt beispielsweise Erin Pizzey, die Gründerin des ersten Frauenhauses in Europa, sowie andere Frauen wie Sarah Ashkenazi und Marlene Moeschke-Poelzig. Indem sie diese Frauen in den Fokus rückt, trägt Endler dazu bei, das vergessene Erbe von Frauen in der Geschichte zu würdigen. Auch ihre kritische Haltung gegenüber esoterischen Heilmethoden und dem damit verbundenen sogenannten „esoterischen Feminismus“ ist lobenswert, da sie versucht, schädliche Narrative zu entlarven.
Allerdings offenbart das Buch auch erhebliche Schwächen. Endler vernachlässigt oft eine fundierte Quellenarbeit und verlässt sich stattdessen auf sekundäre Literatur, was die Glaubwürdigkeit ihrer Argumente infrage stellt. Dies führt dazu, dass sie manchmal Behauptungen aufstellt, die nicht ausreichend belegt sind. Insbesondere die Interpretation antiker Mythen, wie die von Pandora, erscheint tendenziös und verzerrt. Endler beschreibt Pandora als „extrem neugierig“ und als eine Art „Schuldige“ für die Übel der Welt, während Hesiods ursprüngliche Darstellung deutlich differenzierter ist. In ihrer Analyse wird die Komplexität des Mythos nicht ausreichend gewürdigt, wodurch eine vereinfachte Sichtweise entsteht.
Ein weiterer kritischer Punkt ist Endlers Umgang mit dem Thema Gewalt in Beziehungen. Ihre Umschreibung von „häuslicher Gewalt“ zu „partnerschaftlicher Gewalt“ wird von vielen als problematisch angesehen, da sie die Realität dieser Gewalt nicht korrekt widerspiegelt. Endler ignoriert zudem die Tatsache, dass Gewalt auch nach einer Trennung auftreten kann, und verfehlt somit die nötige Sensibilität für dieses wichtige Thema.
Darüber hinaus werden auch Endlers Ansichten zur Sexualität und Gender kritisch betrachtet. Ihre Behauptung, dass patriarchale Strukturen tief in unserer Wahrnehmung verankert seien, könnte als pessimistisch und hinderlich für den Fortschritt interpretiert werden. Es wird nicht ausreichend darauf eingegangen, wie diese Strukturen überwunden werden können, was zu einer fatalistischen Sichtweise führt. Diese Ansätze erscheinen nicht nur als unzureichend, sondern auch als potenziell schädlich für die Diskussion über Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit.
Endlers Stil ist oft provokant und schnoddrig, was zwar ansprechend sein kann, aber auch dazu führt, dass ihre Argumente an Präzision verlieren. Anstatt differenzierte Diskussionen zu führen, neigt sie dazu, pauschale Urteile zu fällen, was die Komplexität der behandelten Themen nicht gerecht wird. Ihre Verwendung des Begriffs „weiblich gelesene Personen“ anstelle von „Frauen“ kann als Versuch gewertet werden, gendergerechte Sprache zu nutzen, wirkt in vielen Kontexten jedoch unklar und unnötig kompliziert.
Insgesamt ist „Witches, Bitches, It-Girls“ ein Buch, das in seiner Zielsetzung wichtig ist, jedoch in der Umsetzung viele Fragen aufwirft. Während Endler einige wertvolle Perspektiven bietet, enttäuscht das Buch durch mangelnde Quellenarbeit, tendenziöse Interpretationen und eine oft ungenaue Argumentation. Es bleibt abzuwarten, ob die Lektüre des Buches zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit den patriarchalen Mythen führt oder ob sie eher zu Verwirrung und Missverständnissen beiträgt. In Anbetracht der Komplexität des Themas wäre eine präzisere und differenziertere Diskussion wünschenswert gewesen, um dem Thema gerecht zu werden.