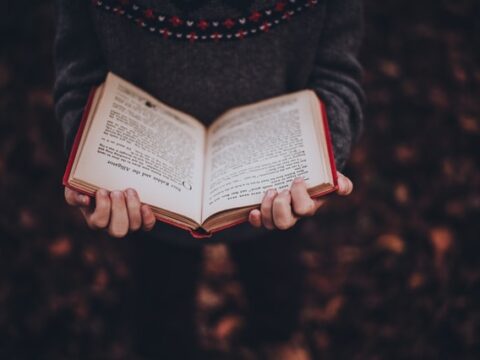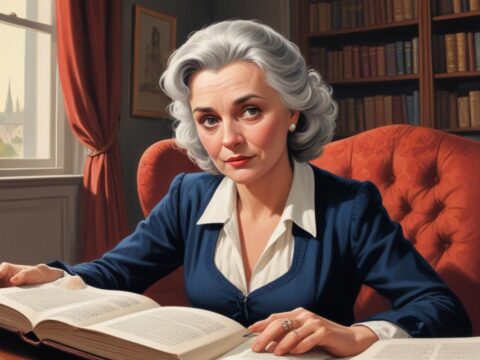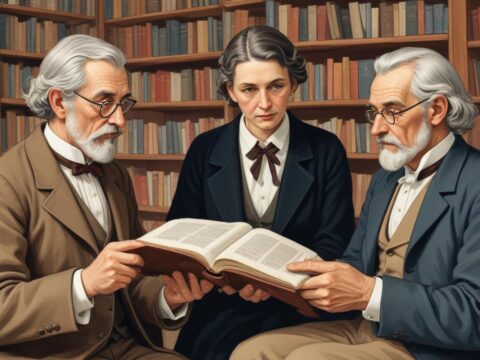Die Sammlung der Briefe zwischen Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben, die Gedanken und die literarischen Bestrebungen zweier bedeutender Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Diese Korrespondenz, die aus 122 erhaltenen Briefen und Postkarten besteht, ist nicht nur ein Zeugnis ihrer Freundschaft, sondern auch ein Dokument ihrer künstlerischen Entwicklung. Die Edition wurde von renommierten Verlagen wie Kiepenheuer und Witsch, Piper und Suhrkamp herausgebracht und finanziell vom Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek unterstützt. Diese Unterstützung zeigt, dass die Veröffentlichung solcher literarischer Korrespondenzen eine wertvolle, wenn auch riskante Unternehmung ist.
Hans Höller, der Herausgeber der Salzburger Bachmann Edition, verweist in seinem Vorwort darauf, dass die Briefe zwischen Bachmann und Böll oft darauf abzielen, persönliche Konflikte zu vermeiden. Von Beginn ihrer Korrespondenz im Dezember 1952 an drücken beide Autoren eine tiefe Wertschätzung füreinander aus, die sich allmählich zu einer warmen Freundschaft entwickelt. Während Höller anmerkt, dass es möglicherweise während eines Gruppentreffens der „Gruppe 47“ im Mai 1954 zu einer kurzen Liebesaffäre zwischen den beiden gekommen sein könnte, bleibt dies dem Leser überlassen zu interpretieren. Ungeachtet dessen bleibt die gegenseitige Unterstützung, die sich unter anderem in Bölls Bemühungen um die Veröffentlichung von Bachmanns Texten zeigt, ein zentrales Element ihrer Beziehung.
Bereits im ersten Brief erwähnt Bachmann die Notwendigkeit, sich „an etwas festhalten zu können“, was auf die Unsicherheiten und Herausforderungen hinweist, denen beide Autoren gegenüberstehen. Böll antwortet mit Freude auf Bachmanns Reisepläne für Februar 1953 und betont, wie wichtig es ist, sich regelmäßig zu sehen und auszutauschen. Im Laufe der Jahre treffen sich die beiden nicht nur während der Gruppentagungen, sondern auch in Köln und Italien, wo sie ihre Gedanken und Erfahrungen teilen.
Diese Korrespondenz bietet nicht nur Einblicke in ihre persönlichen Beziehungen, sondern auch in ihre literarischen Karrieren. Die Briefe zeigen, wie Böll und Bachmann in der noch jungen Bundesrepublik literarisch Fuß fassen. Sie diskutieren die Entstehung ihrer Werke, darunter Bölls Romane und Bachmanns lyrische Schriften. Die Korrespondenz offenbart auch ihre inneren Kämpfe, Zweifel und existenziellen Ängste. So gesteht Böll, der dreifache Familienvater, in einem Brief an Bachmann seine finanziellen Sorgen, beschreibt aber auch Momente des Glücks, wenn er das Gefühl hat, etwas Vollendetes geschaffen zu haben.
Ein besonders bemerkenswerter Aspekt dieser Briefe ist die poetologische Diskussion, die zwischen den beiden Schriftstellern stattfindet. Böll beschreibt seinen Wandel vom Realisten zu einem Schriftsteller, der mit seinem Werk „Billard um halbzehn“ die gesamte „Zeit“ abbilden will. Bachmann hingegen kämpft mit den Fragen ihrer eigenen künstlerischen Identität und sieht sich mit der Angst konfrontiert, dass ihre Werke entweder Kitsch oder das Gegenteil sein könnten. Diese Reflexionen über das Schreiben selbst zeigen, wie sehr die beiden Autoren in ihrer Kunst verwurzelt sind und wie stark sie die jeweilige Meinung des anderen schätzen.
Renate Langer, die Herausgeberin des Bandes, hebt in ihrem ausführlichen Nachwort hervor, dass die Korrespondenz zu einem „Zwiegespräch“ geworden ist, in dem beide Schriftsteller die Worte des anderen aufgreifen und variieren. Diese Interaktion ist besonders wertvoll, da sie nicht nur die individuellen Perspektiven der beiden zeigt, sondern auch die literarische Landschaft der 1950er und 1960er Jahre in der Bundesrepublik widerspiegelt. Diese Zeit war geprägt von Aufbruch und Erneuerung, aber auch von Stagnation und Rückschritten.
In einem Brief von 1962 äußert Böll seine wachsenden politischen Bedenken und beschreibt Deutschland als ein „krankes, perverses und verloren gegangenes Land“. Diese tiefen Einblicke in seine Gedanken und Empfindungen, die er mit Bachmann teilt, zeigen die enge Verbindung zwischen persönlichem und gesellschaftlichem Engagement in ihrem Schreiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Korrespondenz zwischen Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll nicht nur als Dokument ihrer Freundschaft dient, sondern auch als wertvolle Quelle für das Verständnis ihrer literarischen Entwicklung