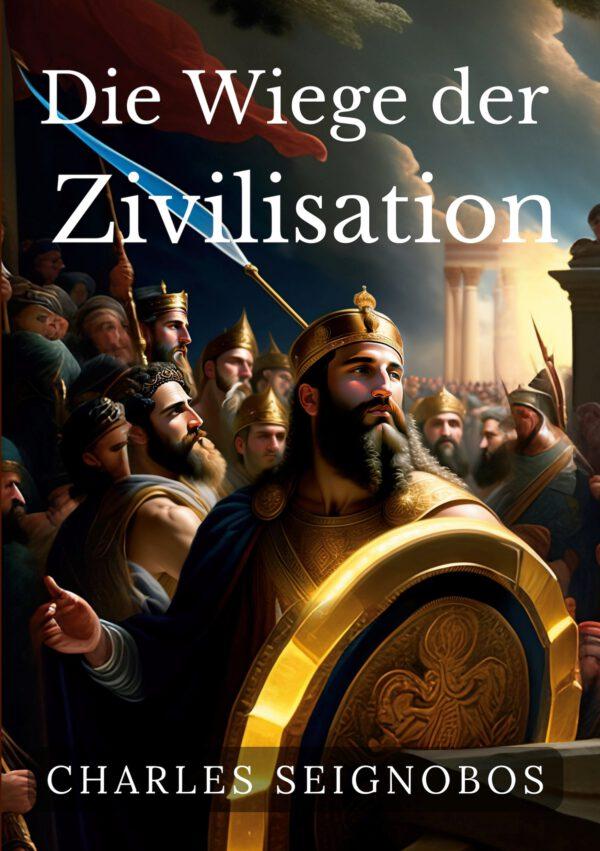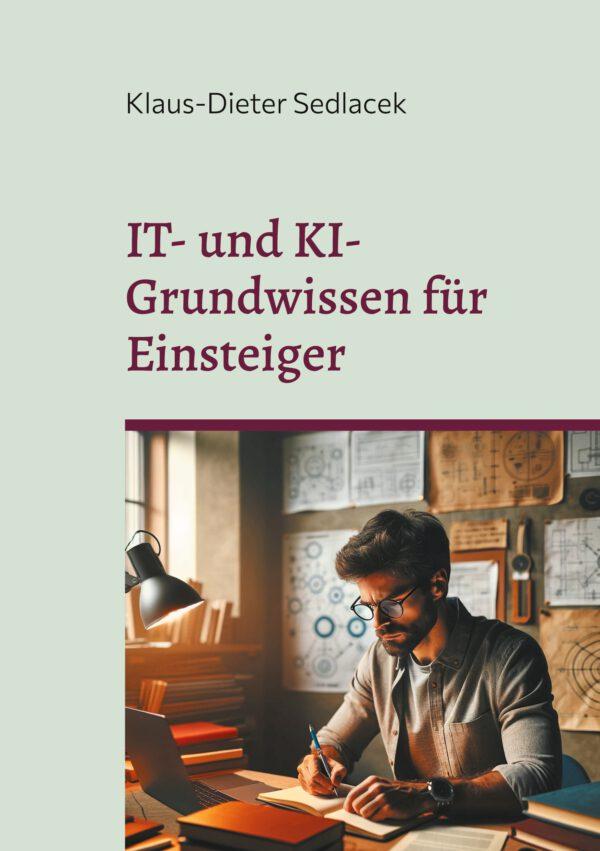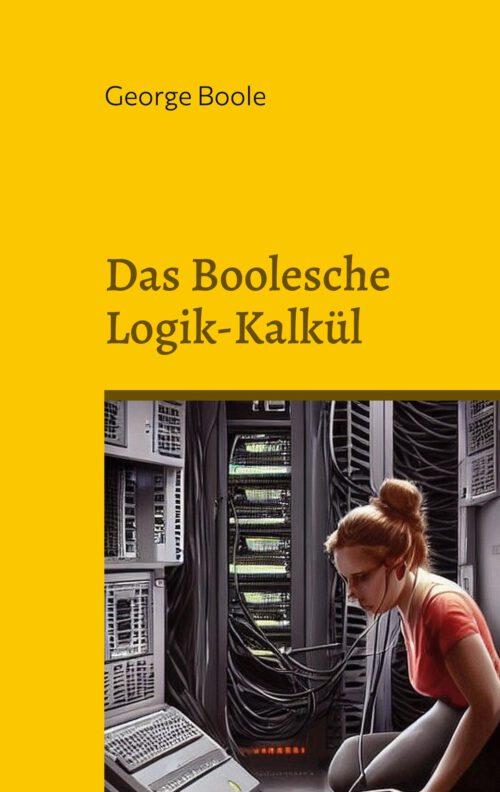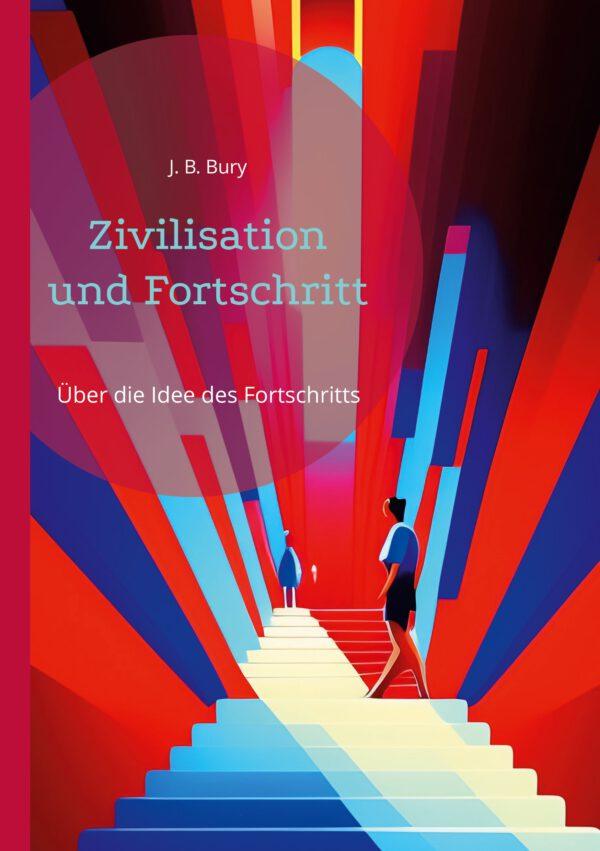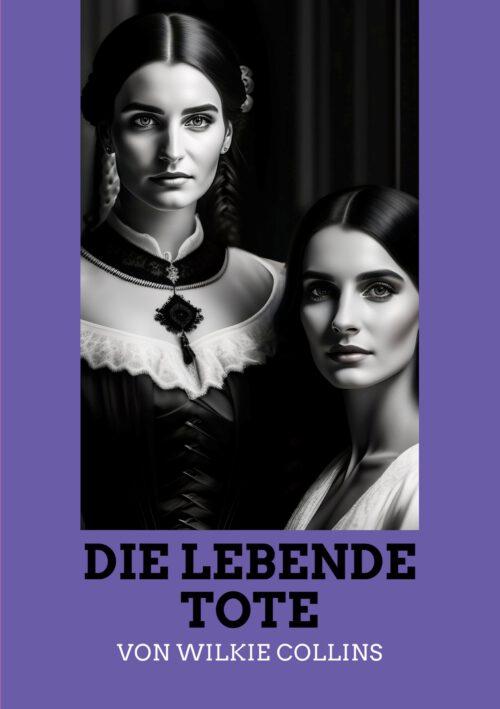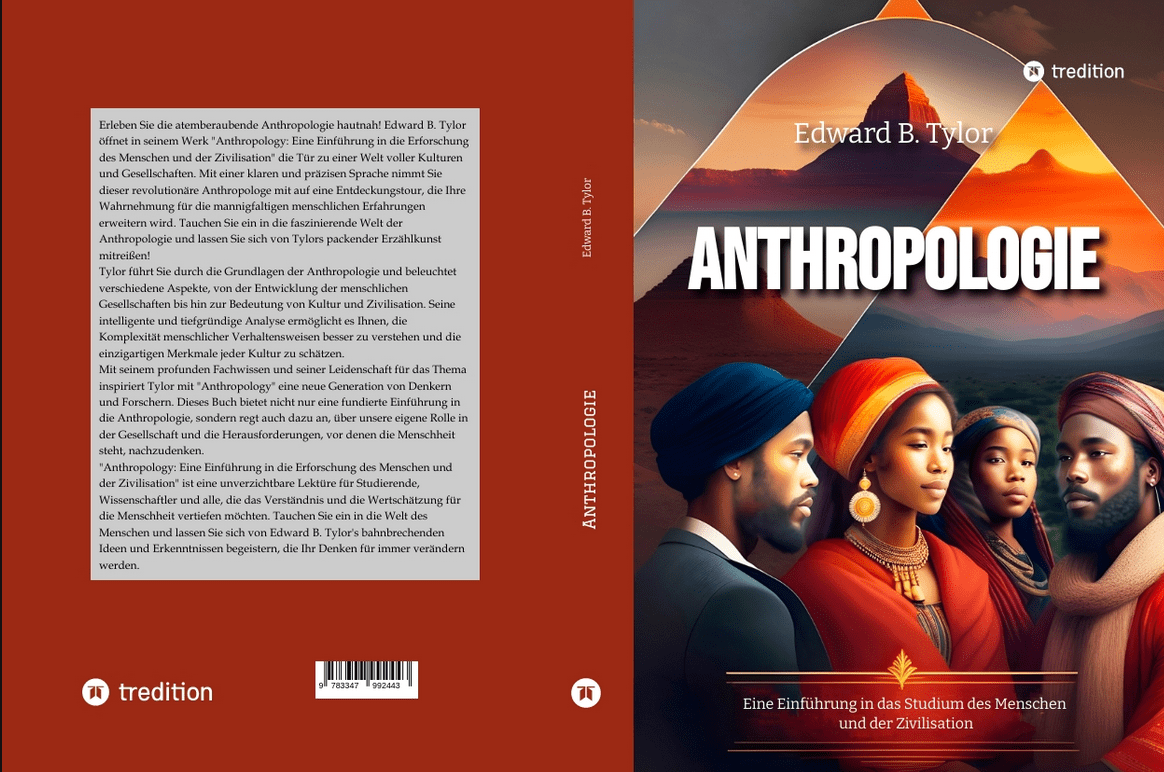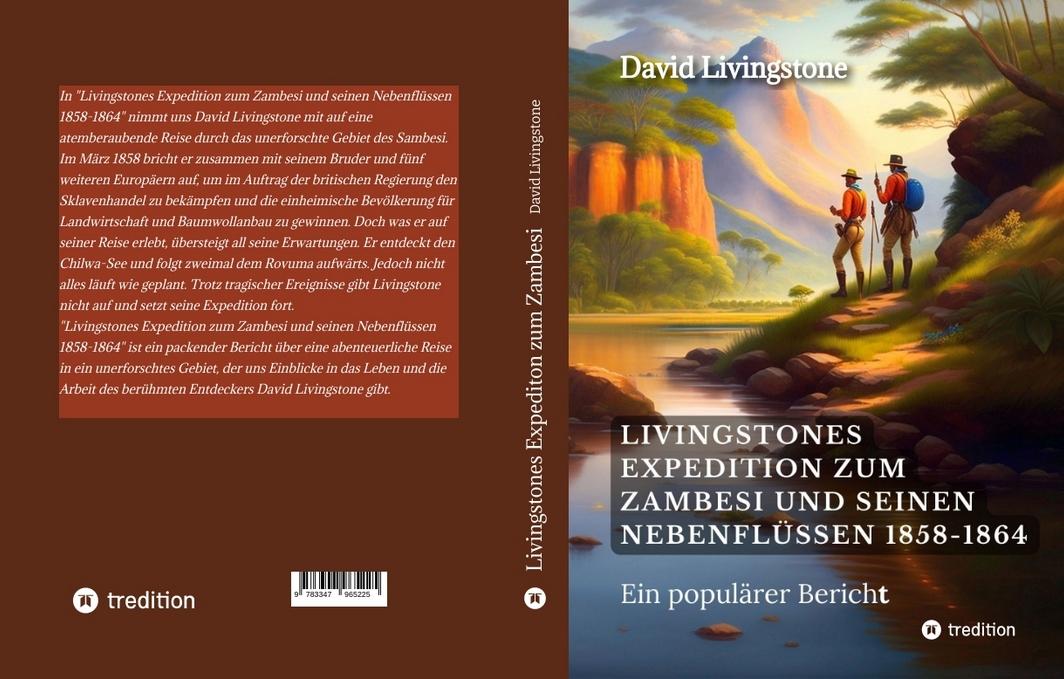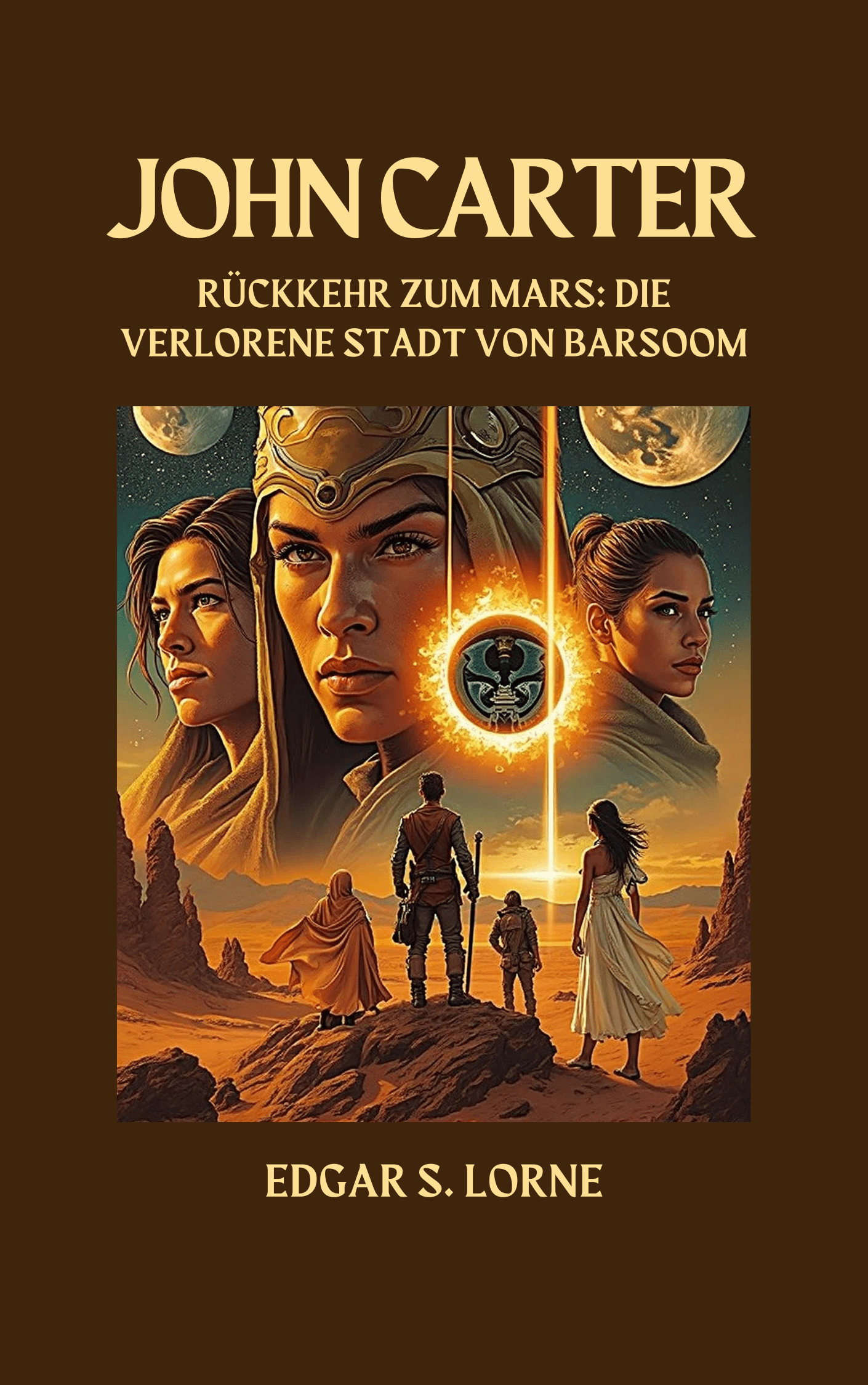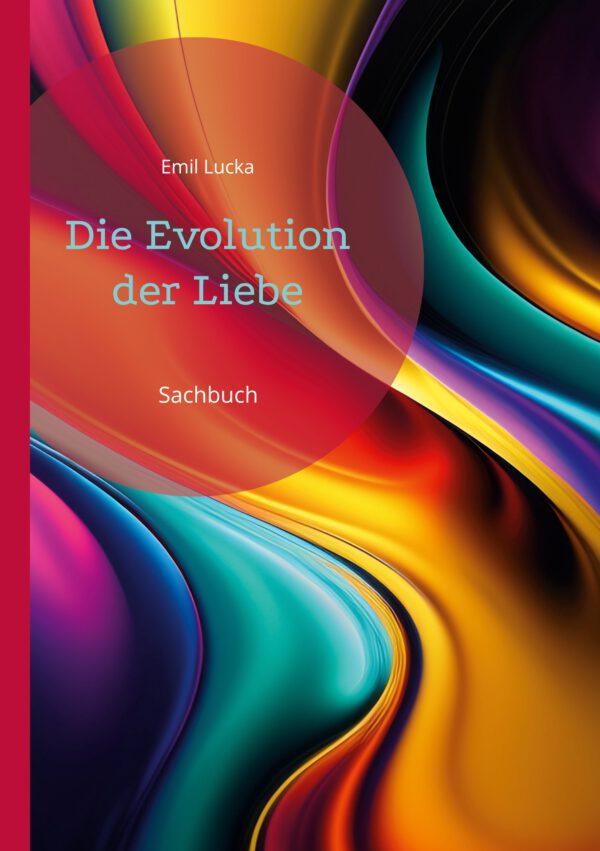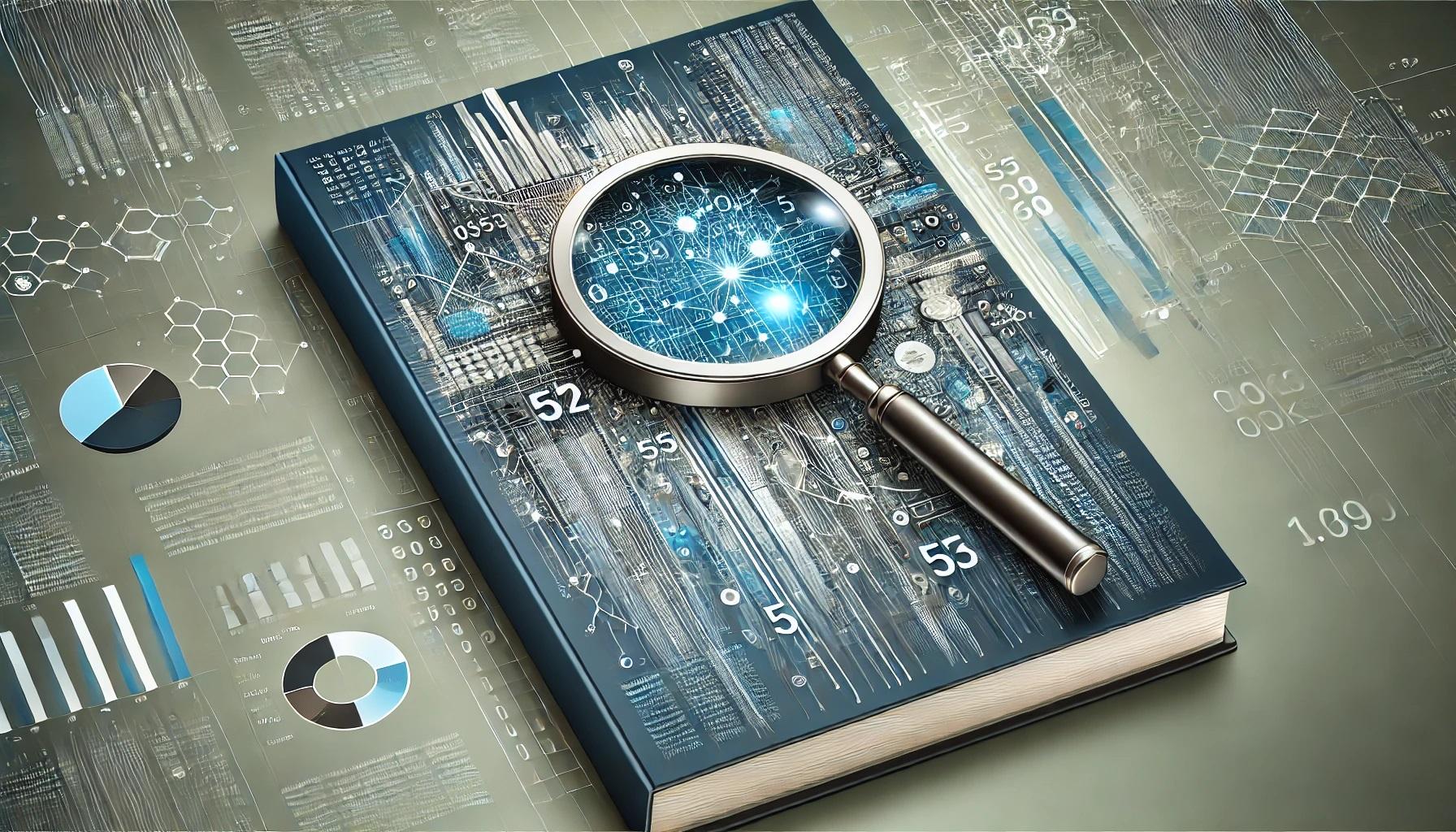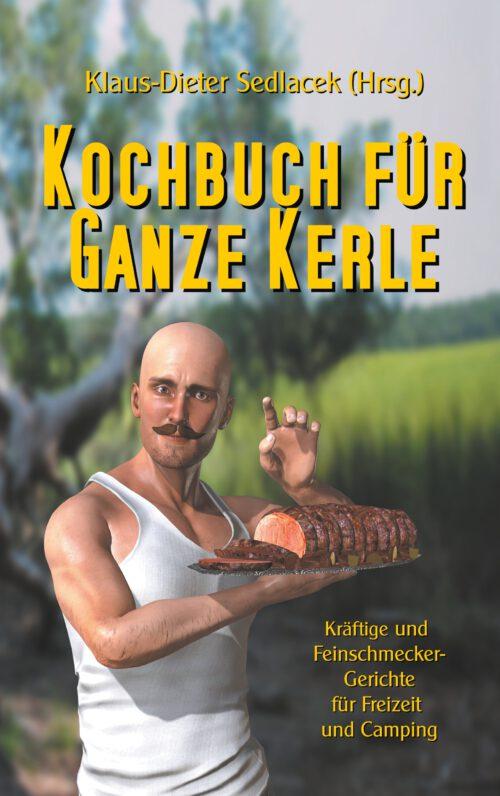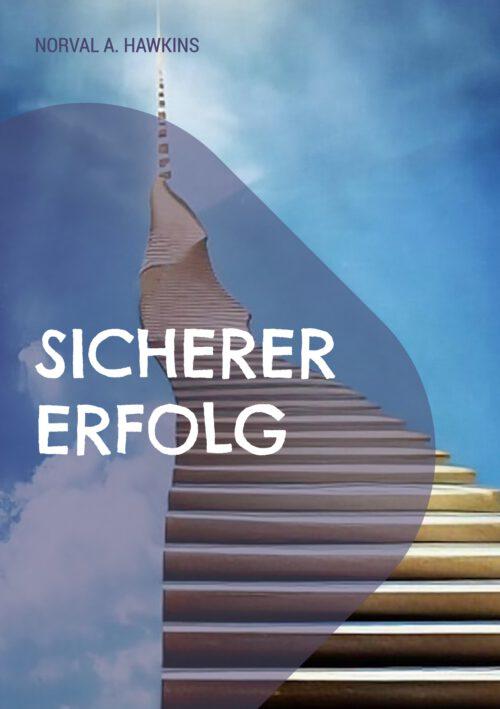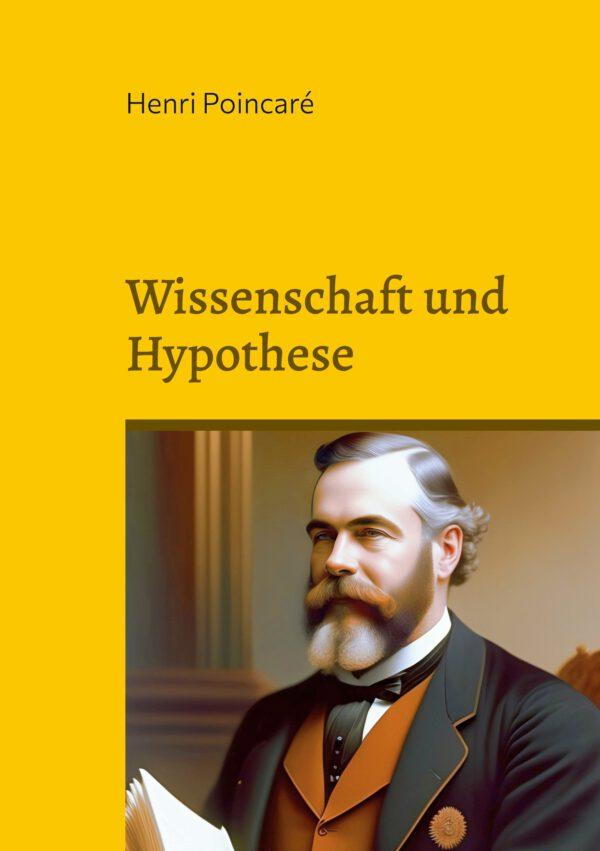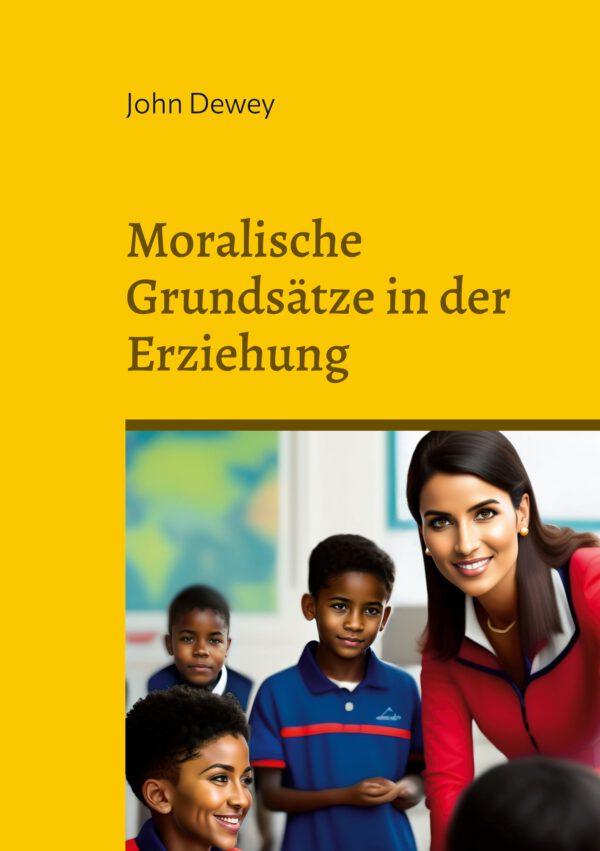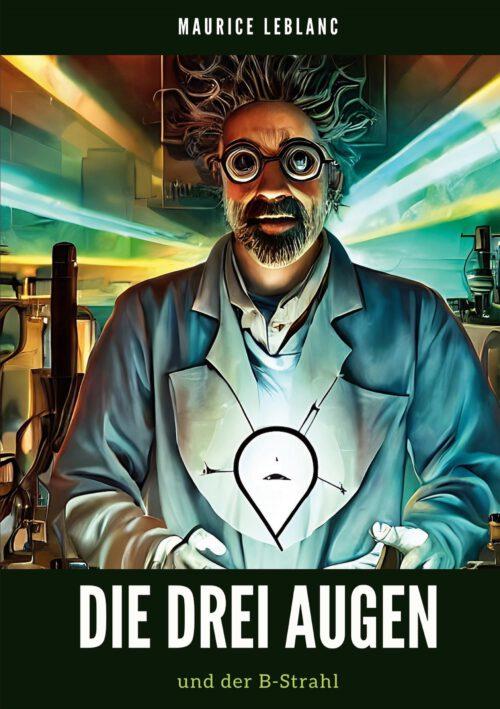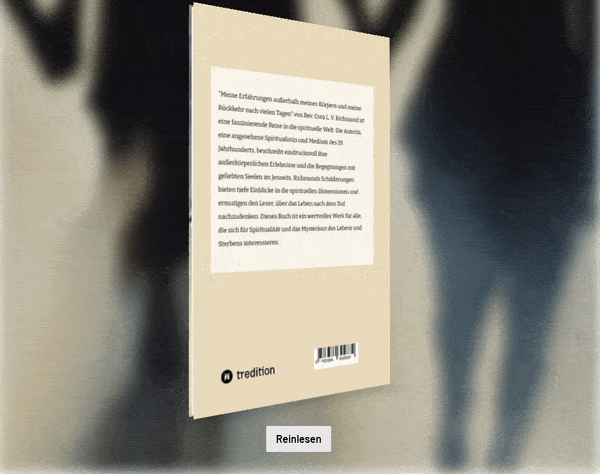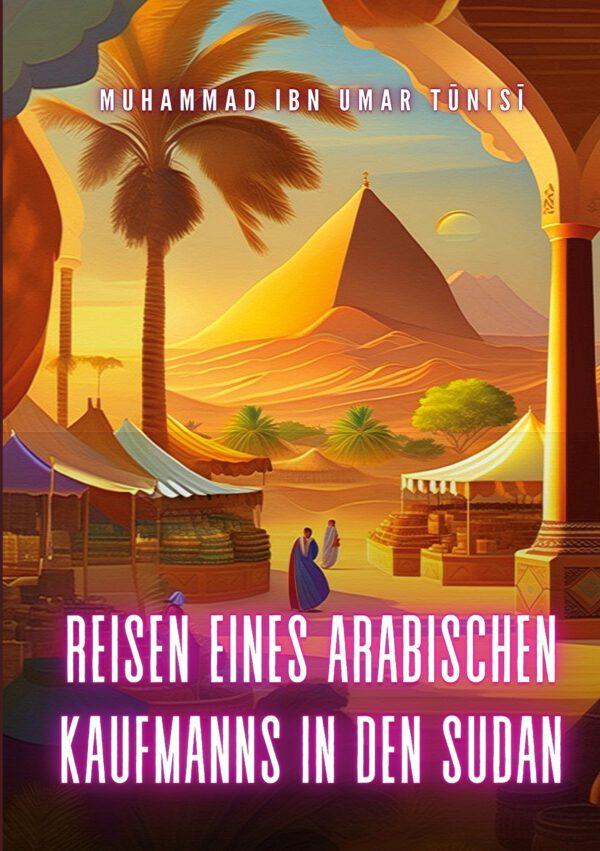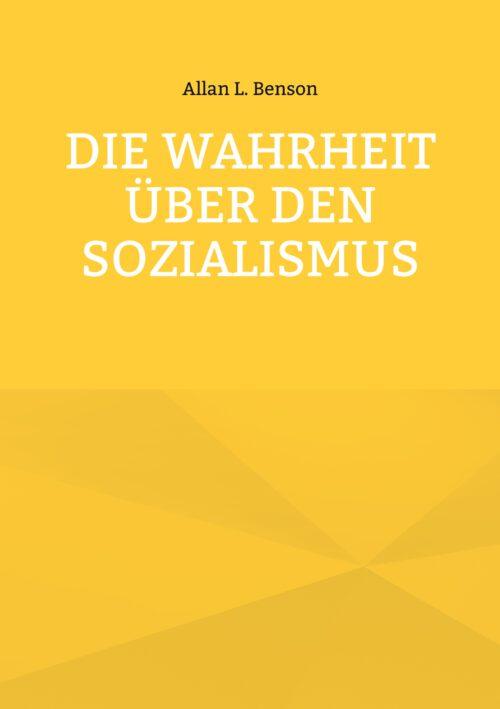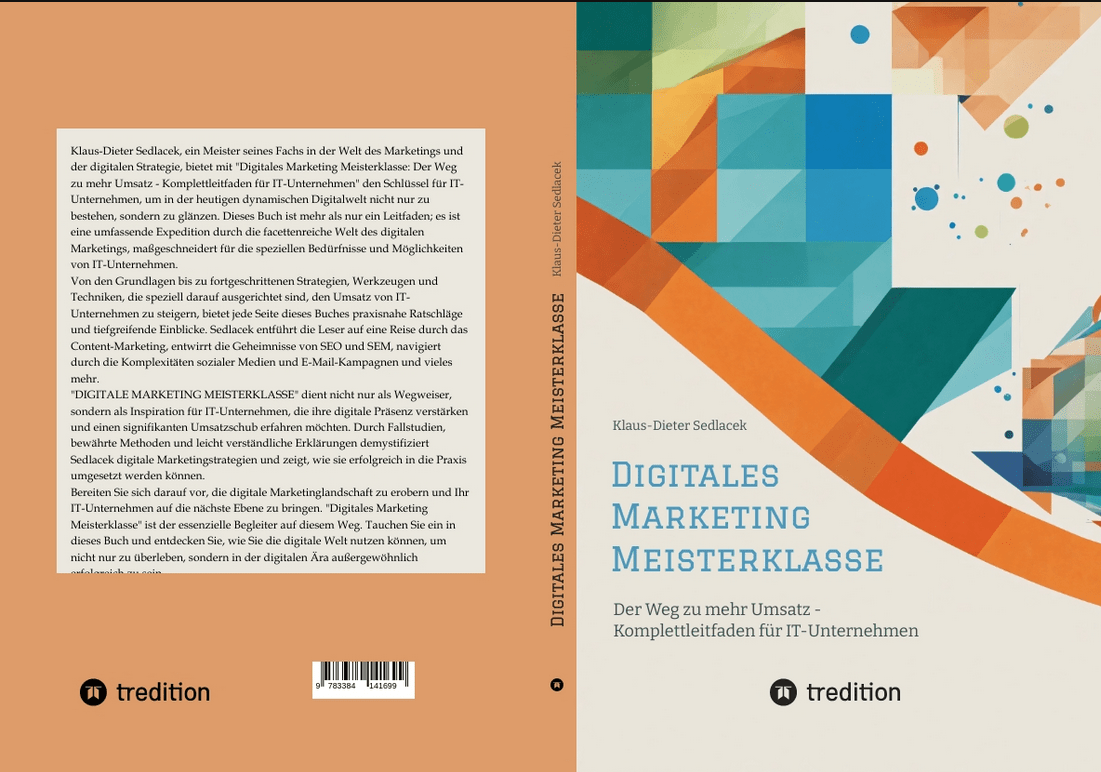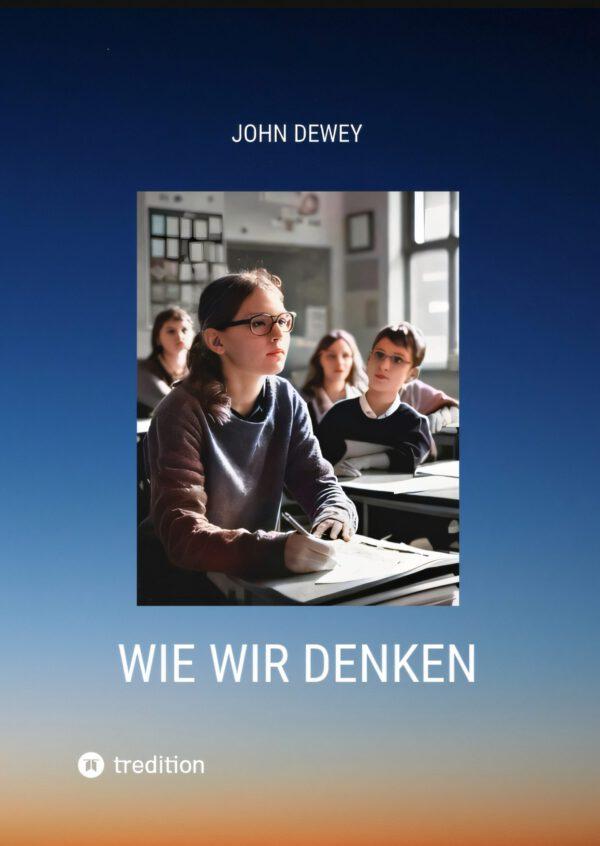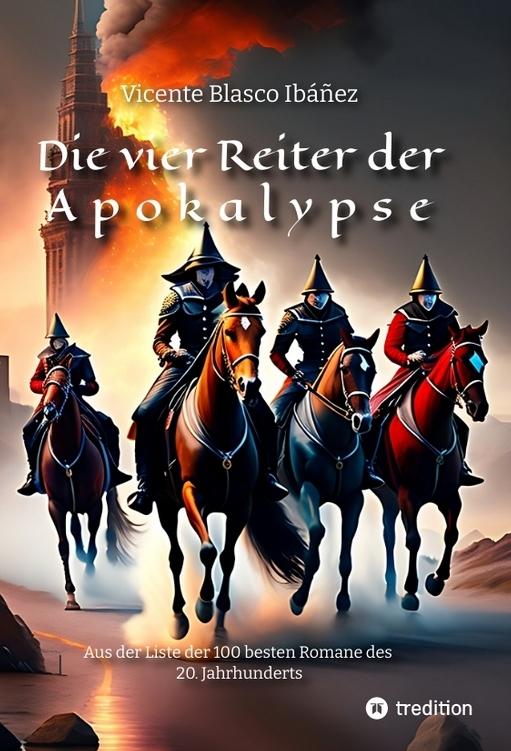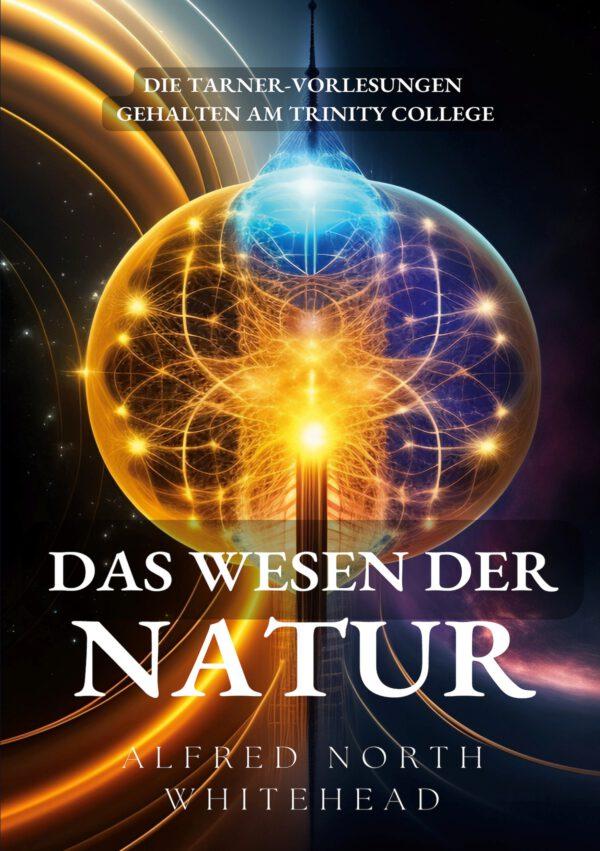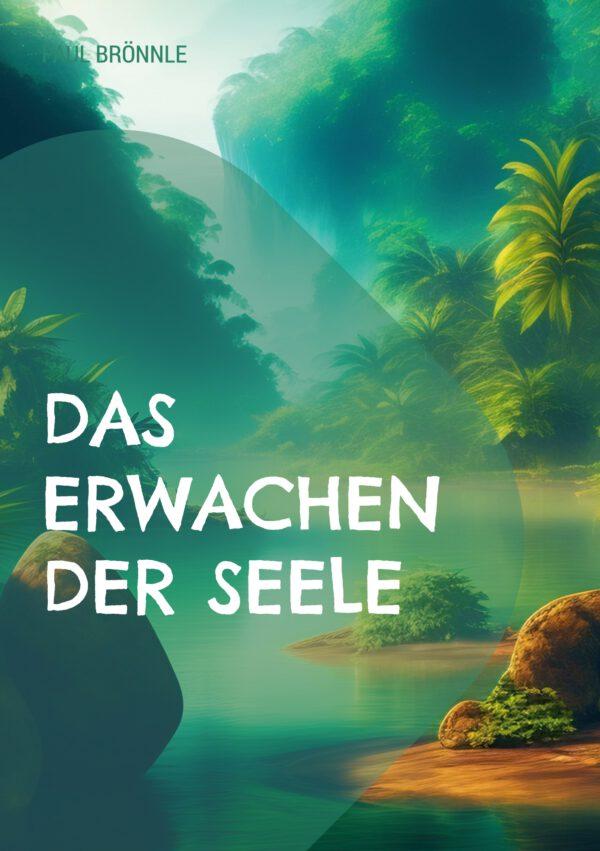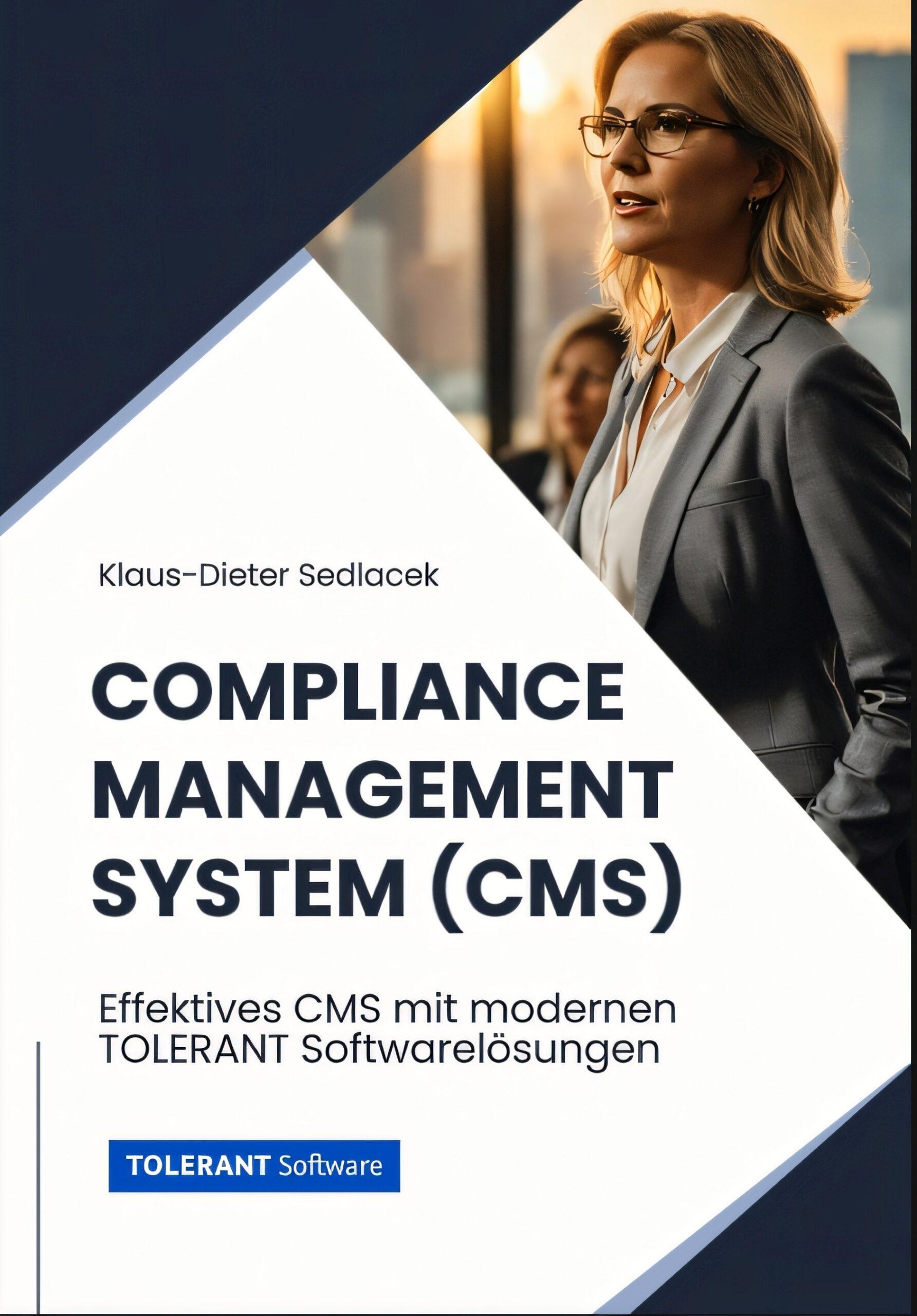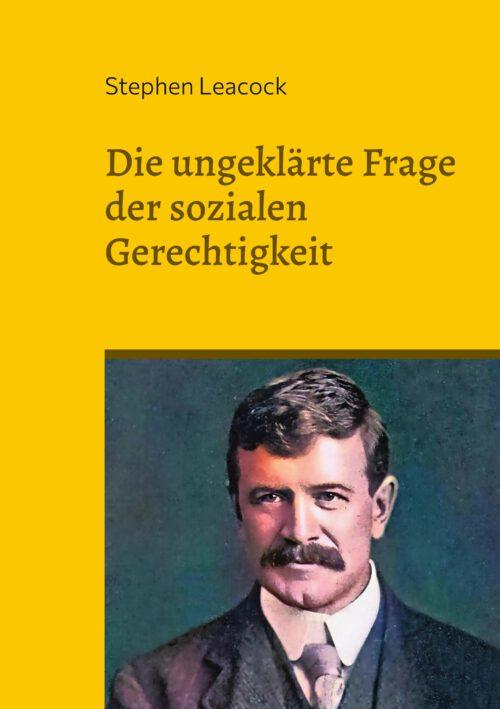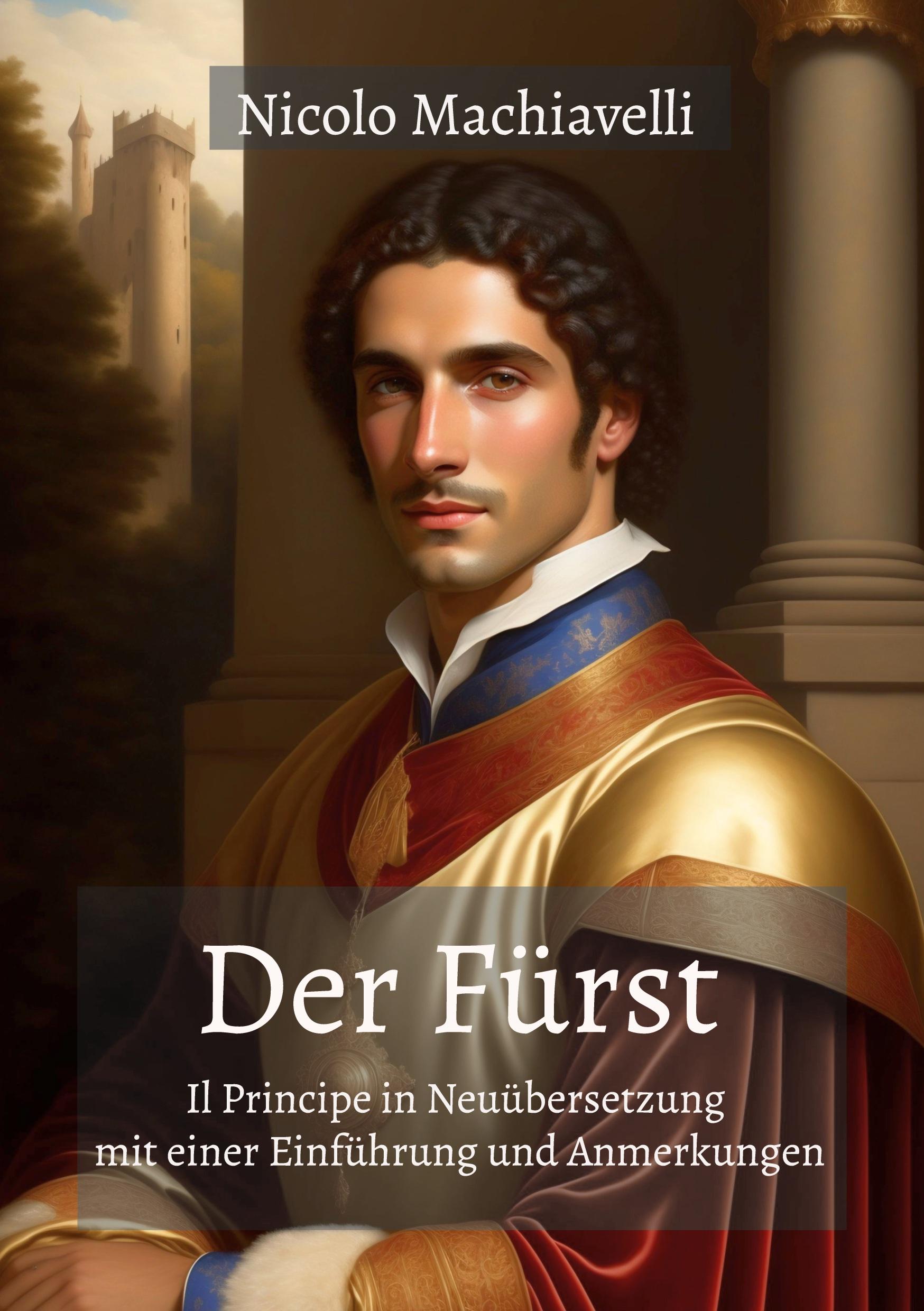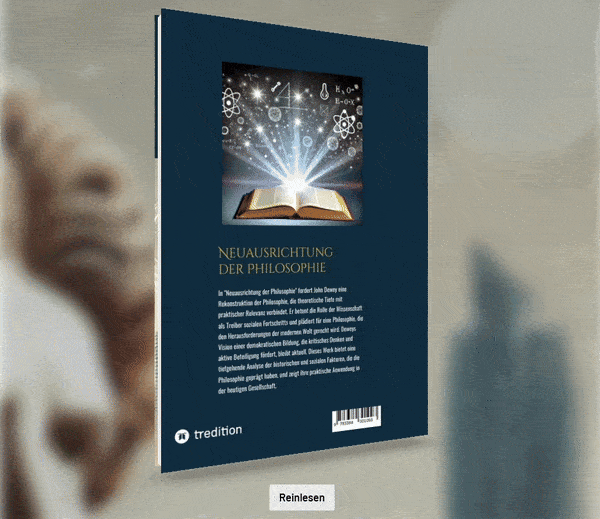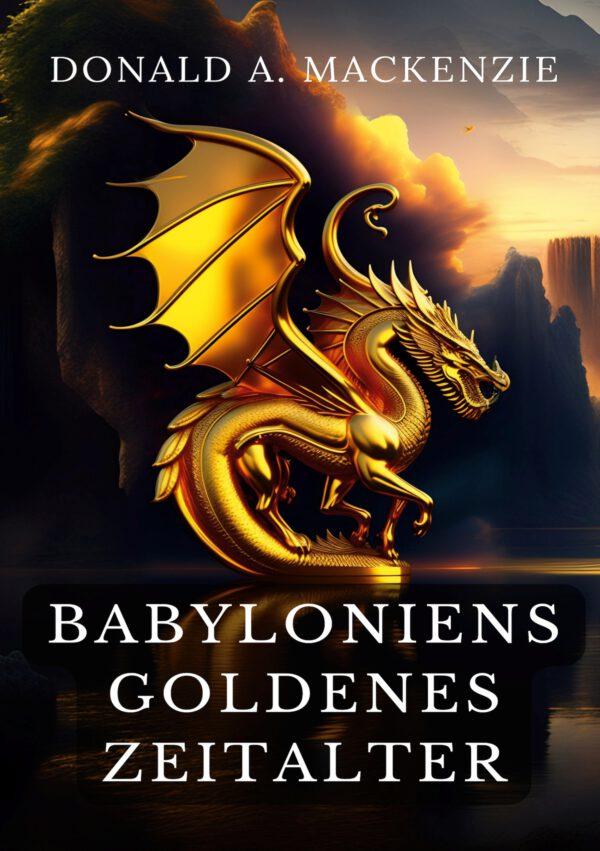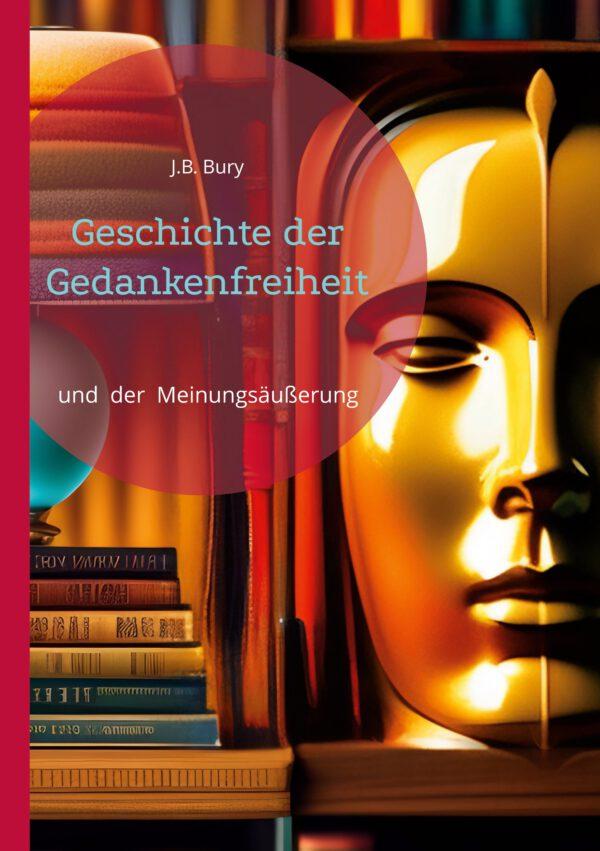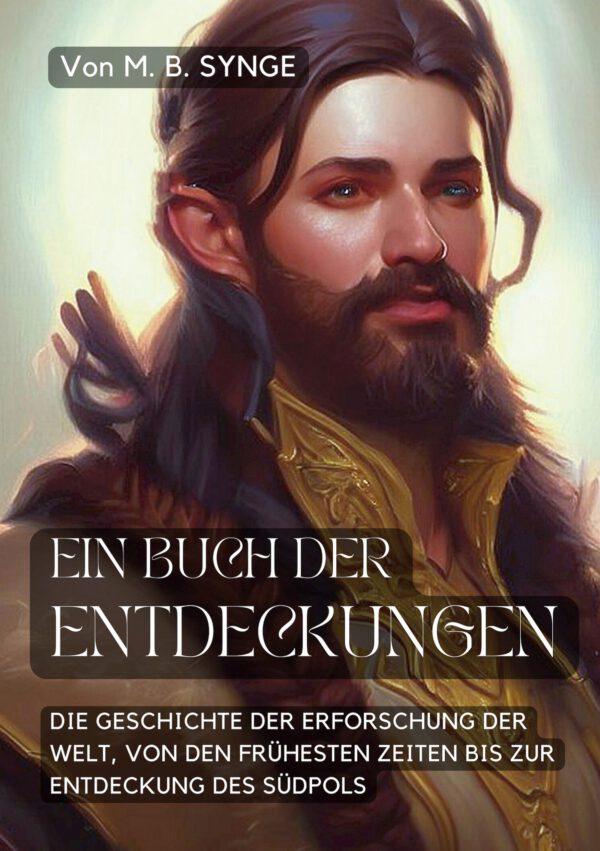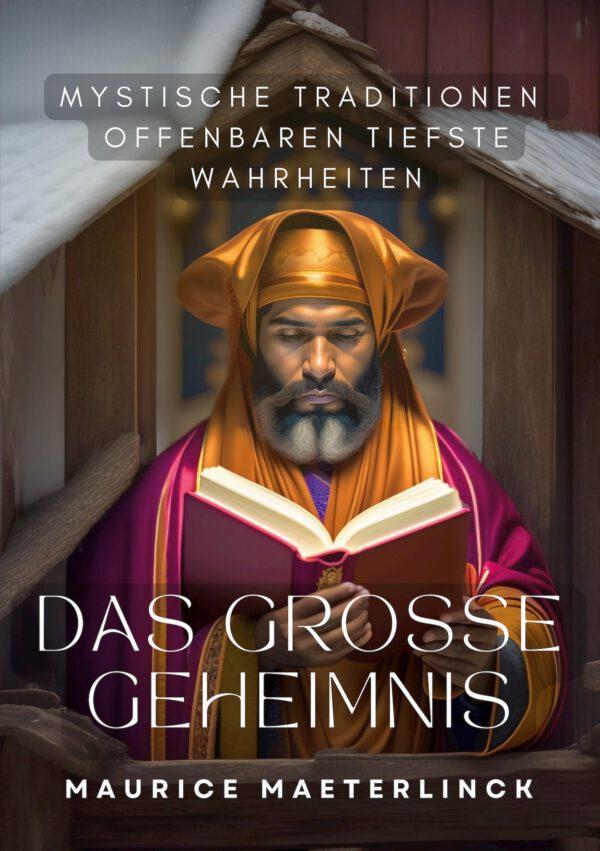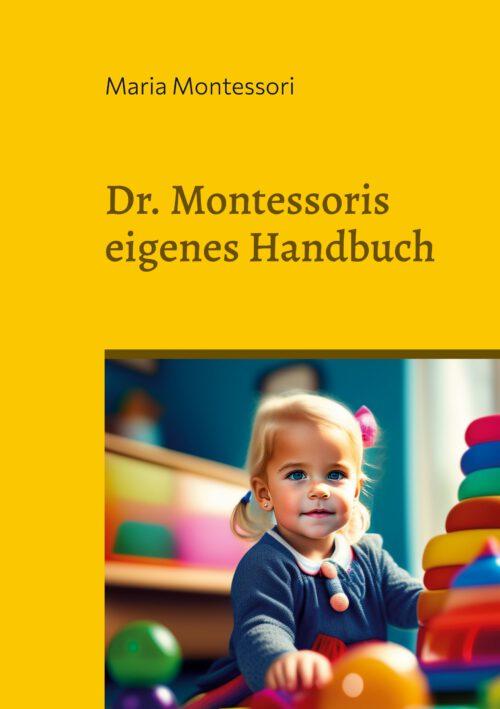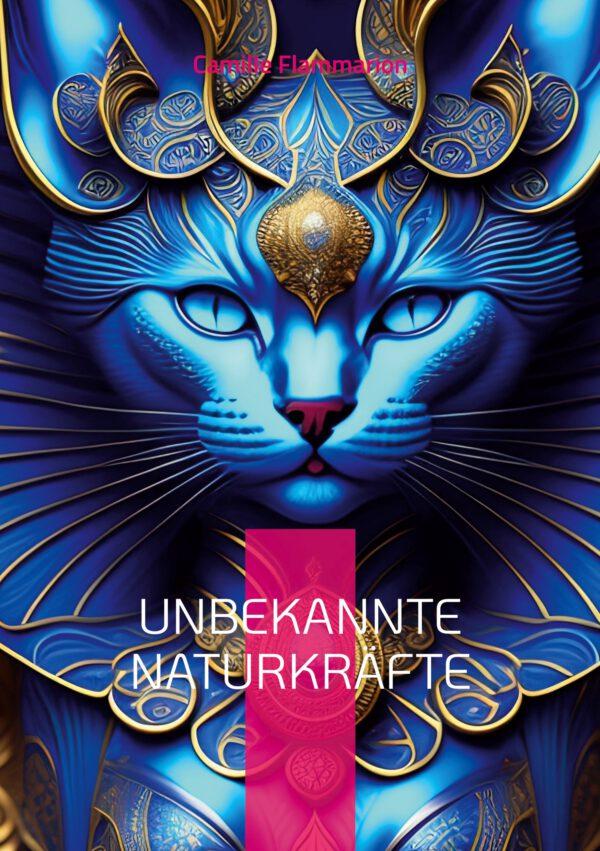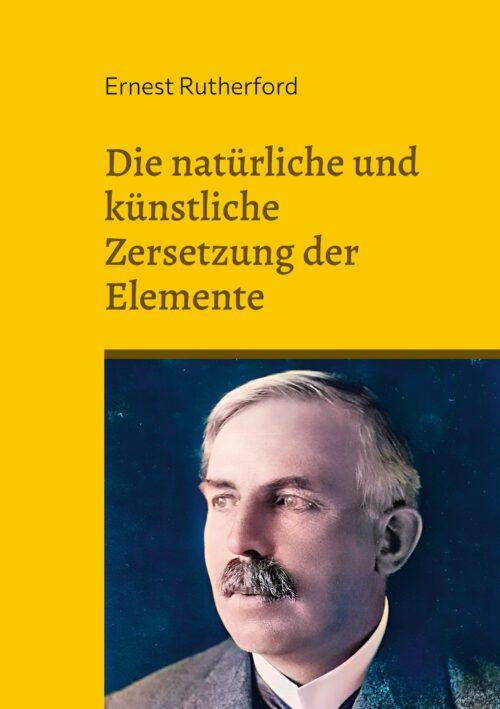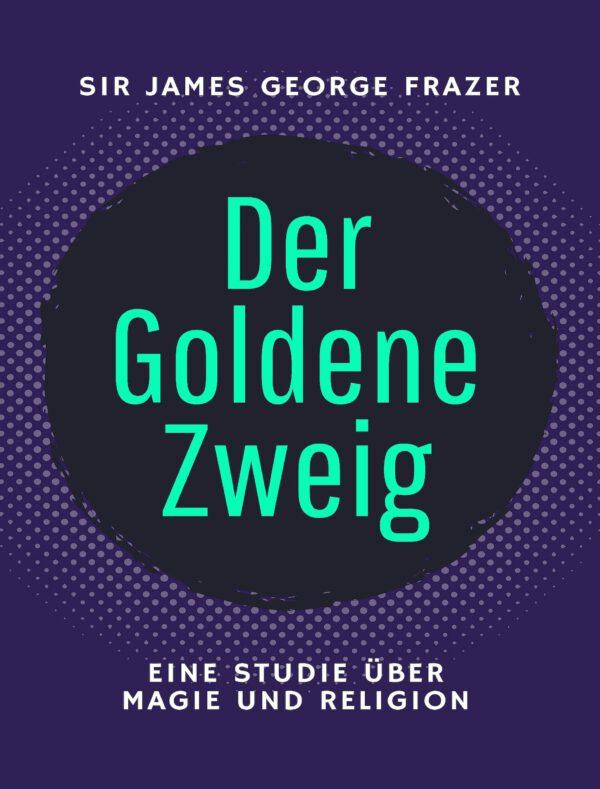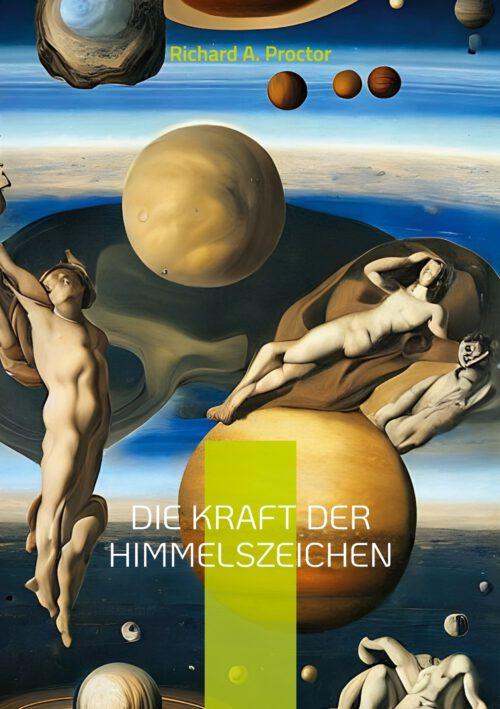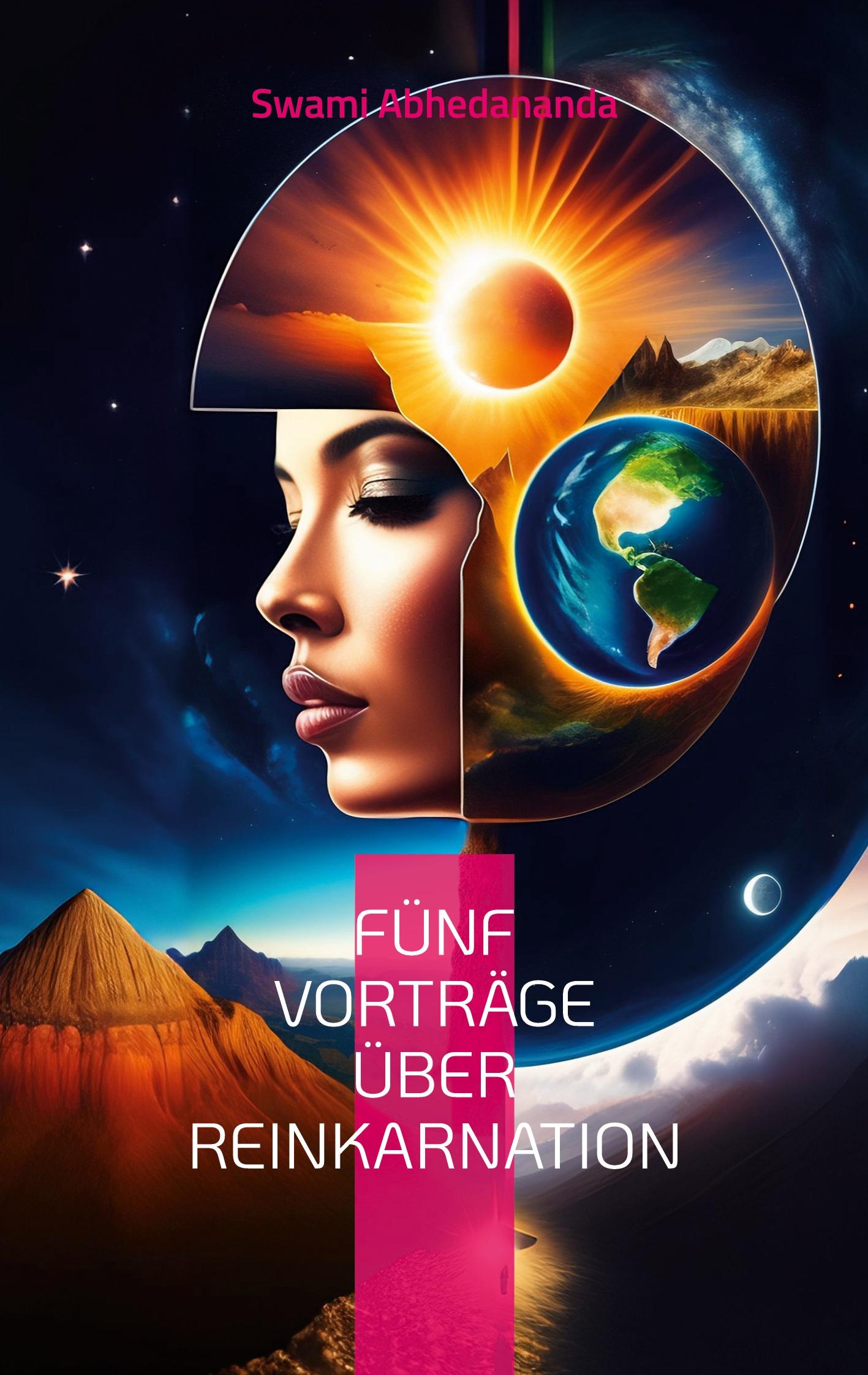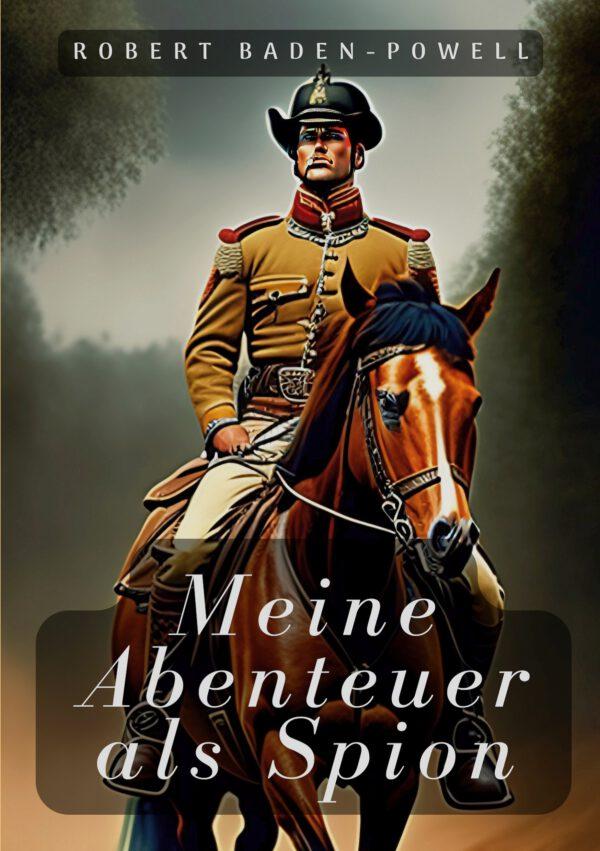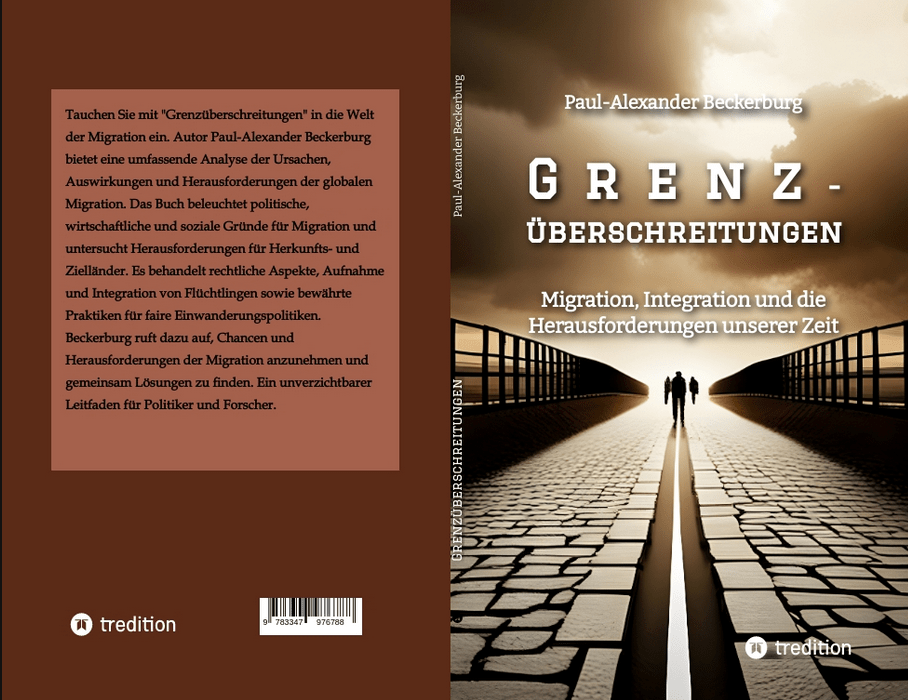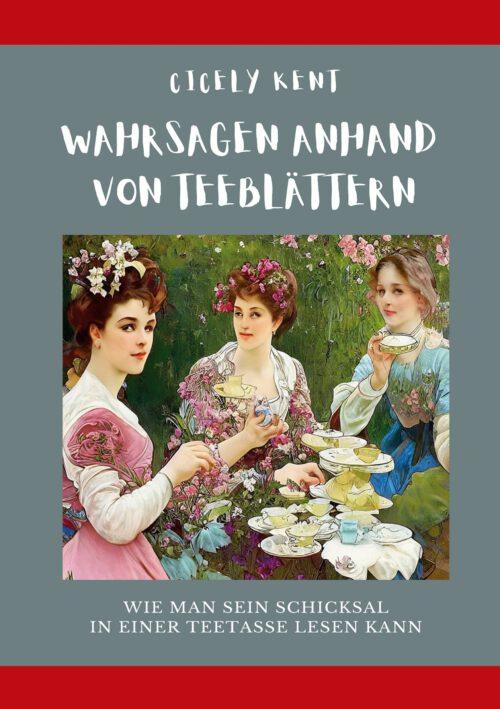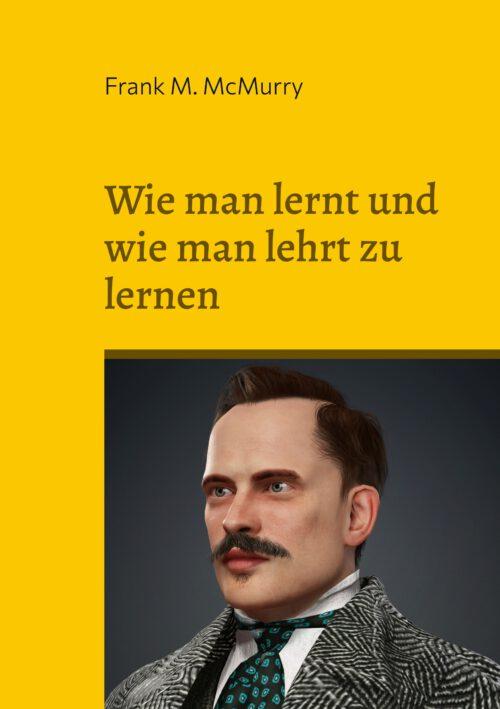Im Rahmen eines Interviews auf buchmesse.de hatte der Autor Blaise Campo Gacoscos die Gelegenheit, über seinen fesselnden philippinischen Roman „Der Junge aus Ilocos“ zu sprechen. In diesem aufschlussreichen Austausch thematisierte er nicht nur die queere Identität, sondern auch das Konzept von Heimat und die emotionalen Aspekte, die seiner Erzählung zugrunde liegen.
Gacoscos, der mit seinem Werk internationale Aufmerksamkeit erregte, beschreibt in seinem Roman die Herausforderungen und Freuden, die mit der Entdeckung der eigenen Identität in einem kulturellen Kontext verbunden sind, der häufig von traditionellen Vorstellungen geprägt ist. Er stellt die Frage, wie die Gesellschaft auf Andersartigkeit reagiert und welche Rolle die eigene Herkunft dabei spielt.
Ein zentrales Anliegen des Autors ist es, die Komplexität der queeren Identität in einem philippinischen Umfeld darzustellen. In vielen Kulturen sind queere Menschen oft mit Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert. Gacoscos nutzt seine Erzählung, um die inneren Konflikte und das Streben nach Akzeptanz zu beleuchten. Er betont, dass es wichtig ist, die Stimmen von marginalisierten Gruppen zu hören und ihre Geschichten zu erzählen, um ein besseres Verständnis für die Vielfältigkeit menschlicher Erfahrungen zu schaffen.
Das Thema Heimat spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle in Gacoscos’ Werk. Für viele Menschen ist die Heimat ein Ort der Sicherheit und der Zugehörigkeit, doch für queere Individuen kann dies eine komplexe Beziehung sein. Der Autor reflektiert, wie Heimat sowohl ein Rückzugsort als auch ein Ort der Konfrontation sein kann. In seinem Roman zeigt er, wie die Protagonisten versuchen, einen Platz in einer Gesellschaft zu finden, die oft nicht für sie geschaffen ist. Dabei wird deutlich, dass Heimat nicht nur geografisch, sondern auch emotional und sozial verstanden werden kann.
Gacoscos beschreibt seine Protagonisten als facettenreiche Charaktere, die mit ihren eigenen Unsicherheiten und Hoffnungen kämpfen. Er möchte, dass die Leserinnen nicht nur die Schwierigkeiten, sondern auch die Schönheit und die Stärke queerer Identitäten erkennen. Seine Erzählung ist ein Aufruf zur Empathie und zum Verständnis, indem sie die menschlichen Aspekte der Charaktere in den Vordergrund stellt. Der Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Brücke zwischen verschiedenen Welten zu schlagen und die Leserinnen dazu einzuladen, sich mit den Erfahrungen von Menschen auseinanderzusetzen, die anders sind als sie selbst.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Interviews ist der Einfluss seiner eigenen Biografie auf sein Schreiben. Gacoscos spricht offen über seine persönlichen Erfahrungen und die Herausforderungen, denen er als queer-identifizierte Person begegnete. Diese Authentizität verleiht seinem Werk eine besondere Tiefe und macht es für viele Leser*innen nachvollziehbar. Er sieht Literatur als ein Mittel, um Dialoge zu fördern und Vorurteile abzubauen. In seinen Werken geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um die Schaffung eines Bewusstseins für soziale Themen, die oft ignoriert werden.
Abschließend lässt sich sagen, dass Blaise Campo Gacoscos mit „Der Junge aus Ilocos“ einen bedeutenden Beitrag zur literarischen Landschaft leistet. Er bringt die Stimmen queerer Menschen ins Rampenlicht und bietet eine differenzierte Sicht auf die Themen Identität und Heimat. Durch seine Erzählkunst gelingt es ihm, das Publikum zu berühren und zum Nachdenken anzuregen. Sein Werk ist nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft, sondern auch ein Aufruf zur Akzeptanz und zum Verständnis für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen. Das Interview hebt die Relevanz dieser Themen in der heutigen Zeit hervor und ermutigt die Leser*innen, sich mit den Geschichten von Menschen auseinanderzusetzen, die für ein offenes und tolerantes Miteinander stehen.