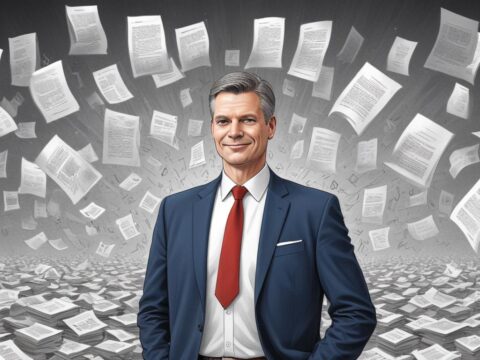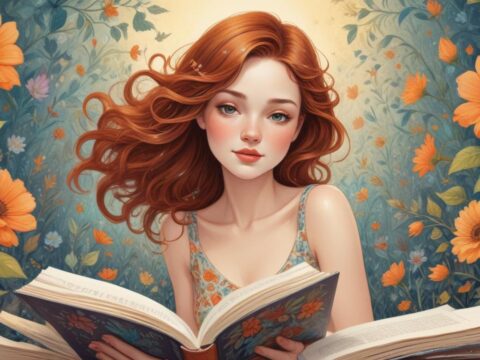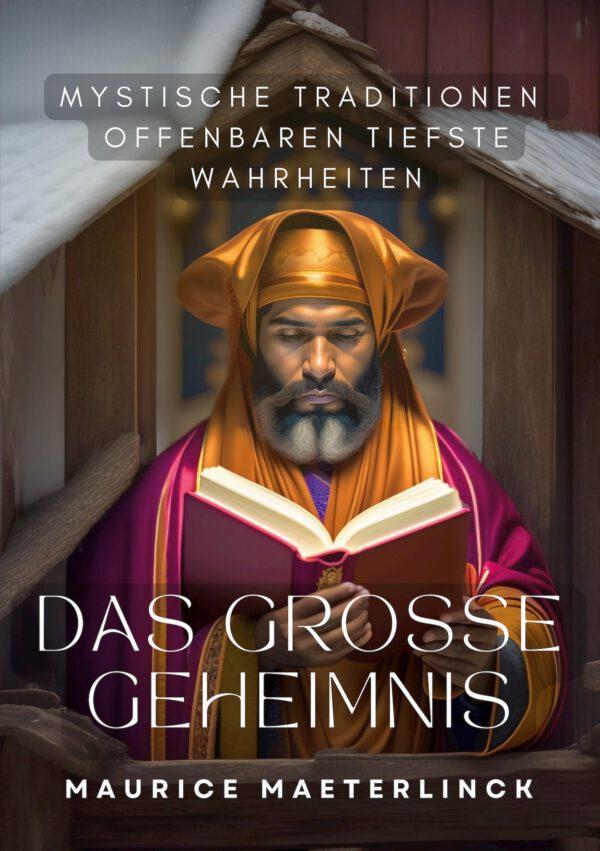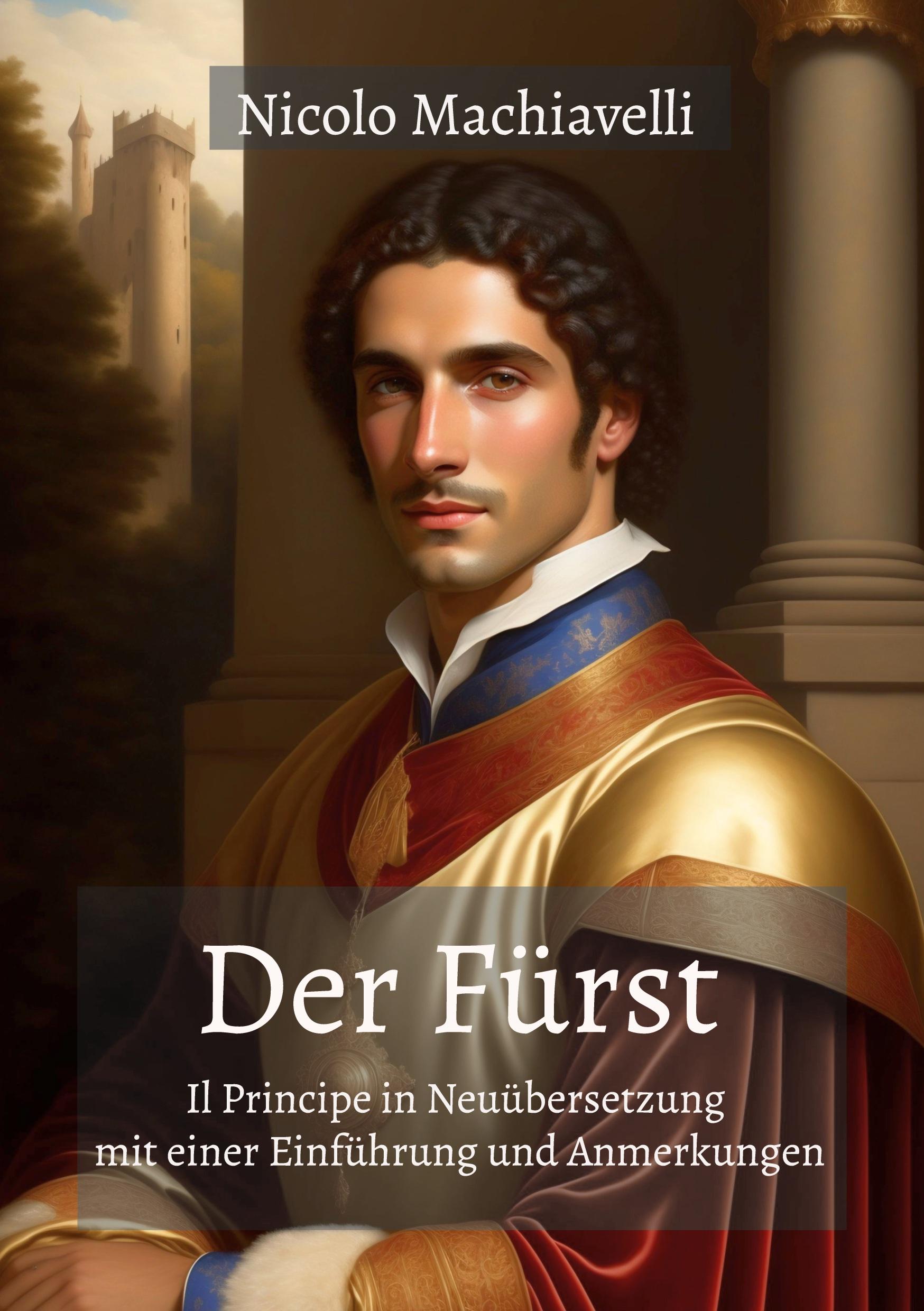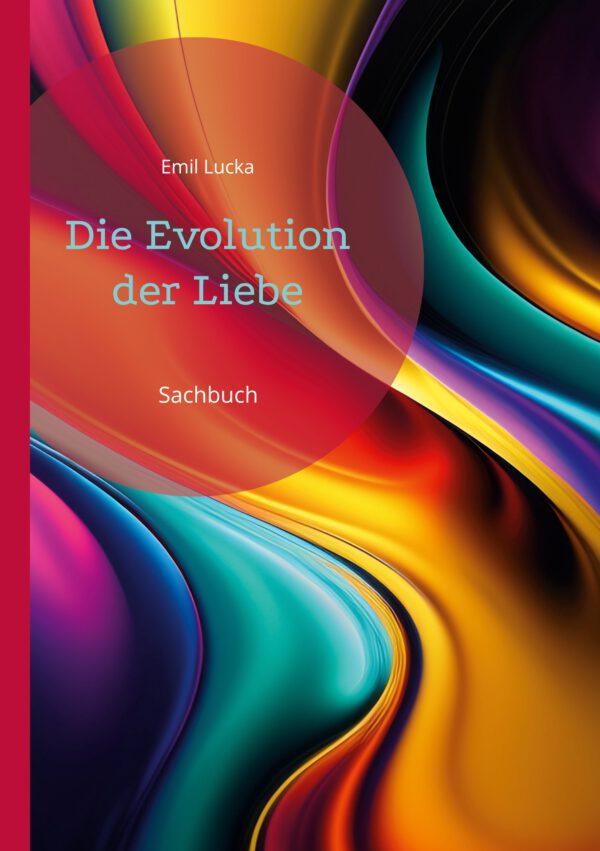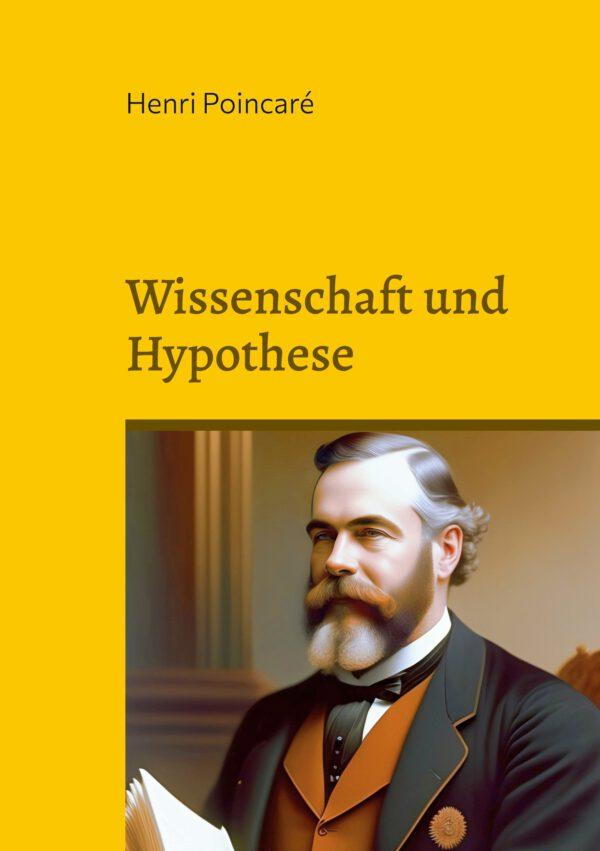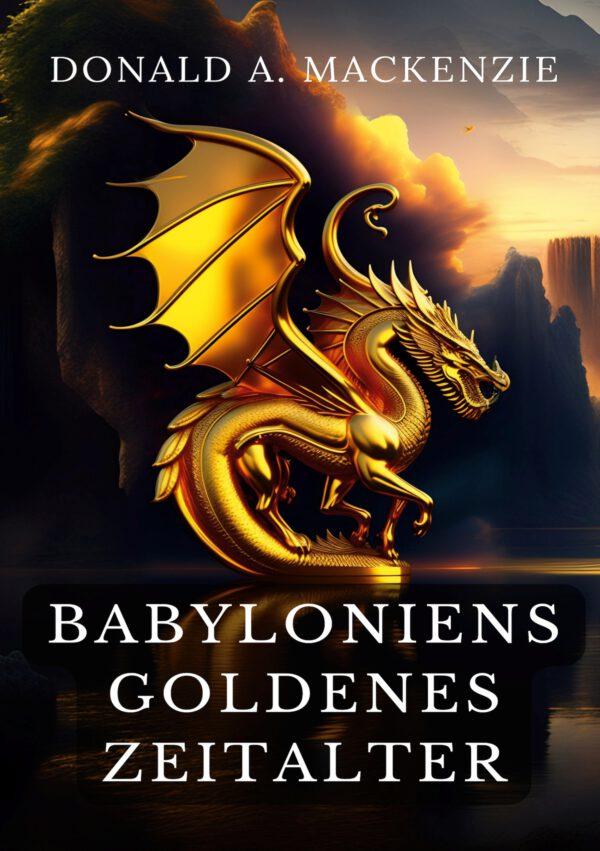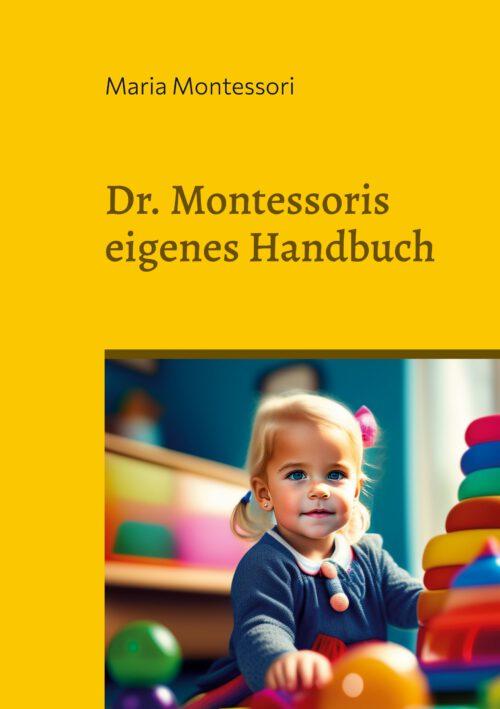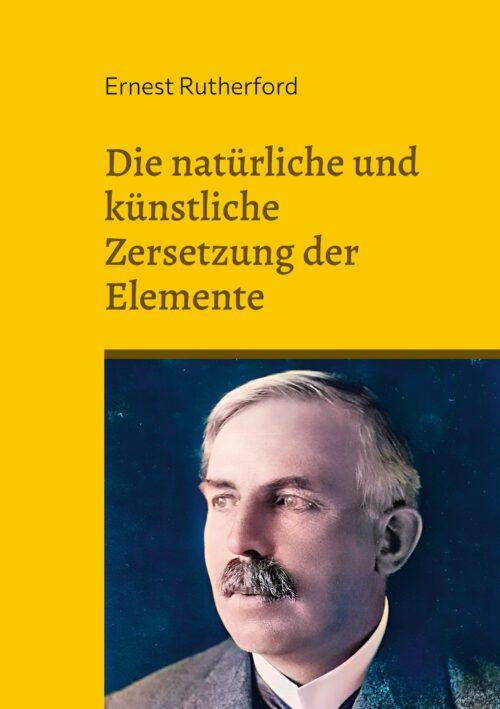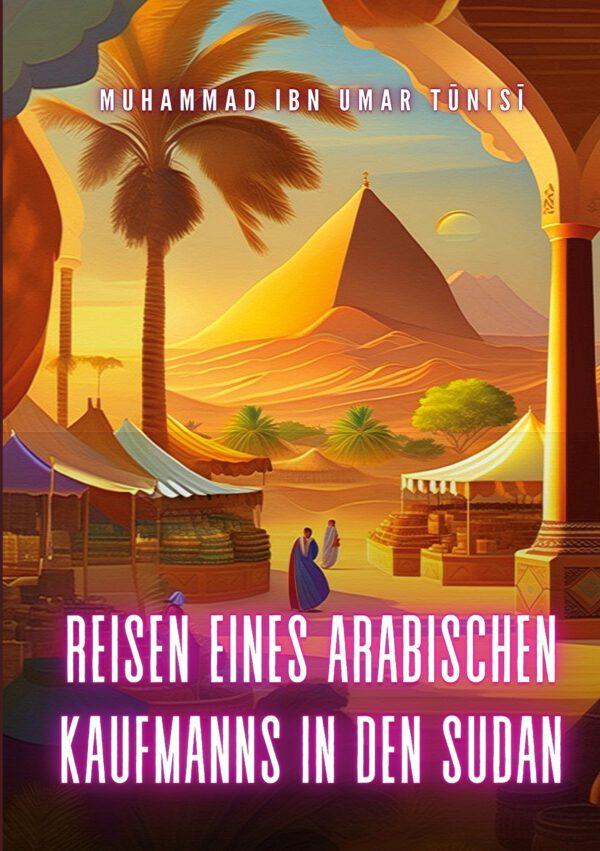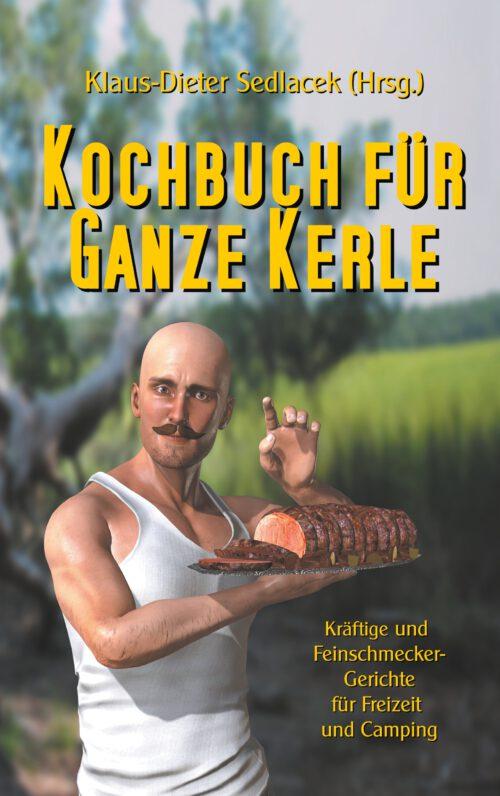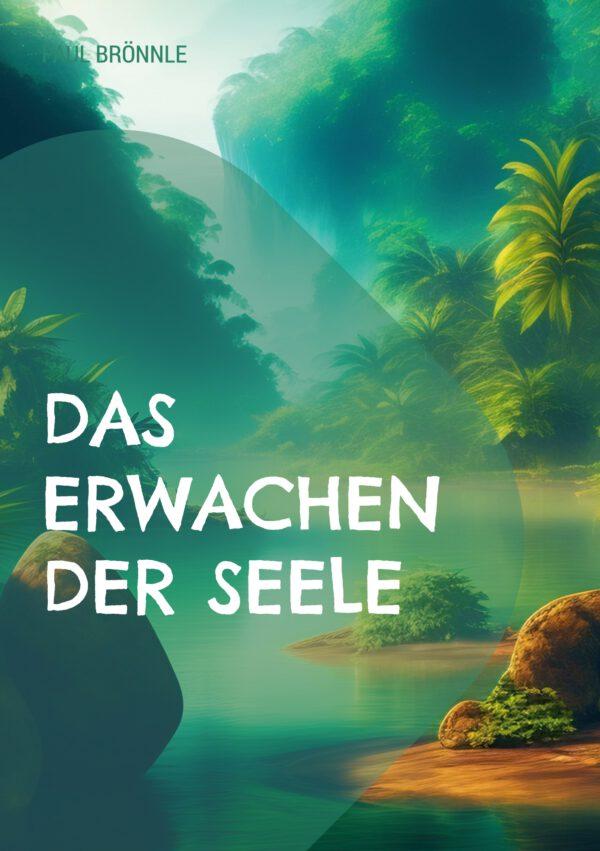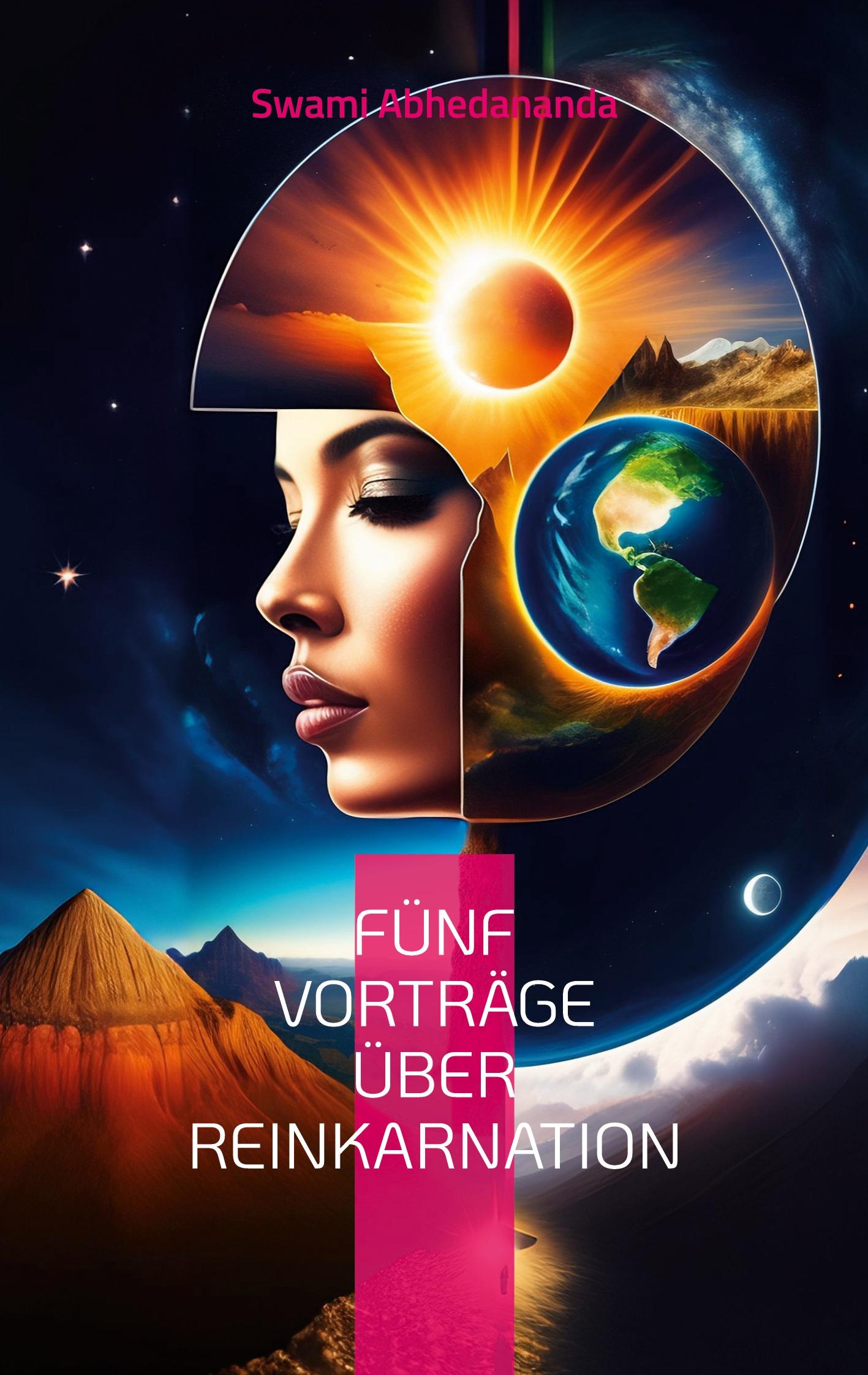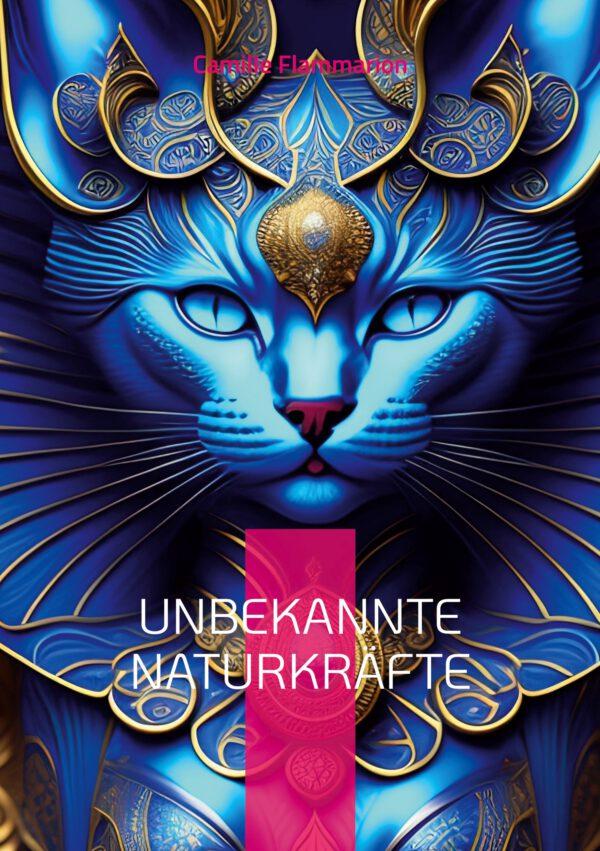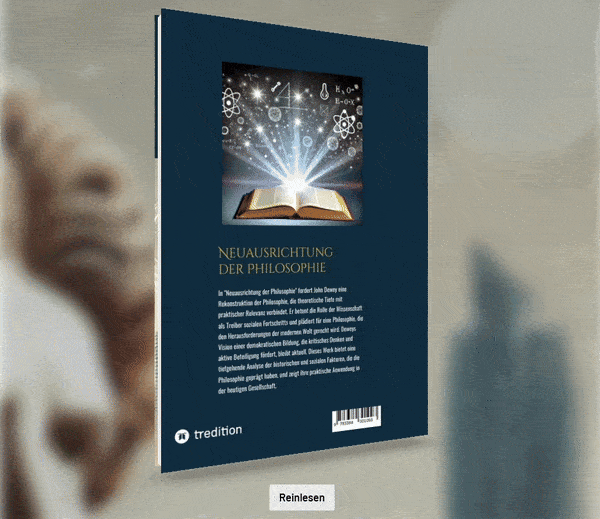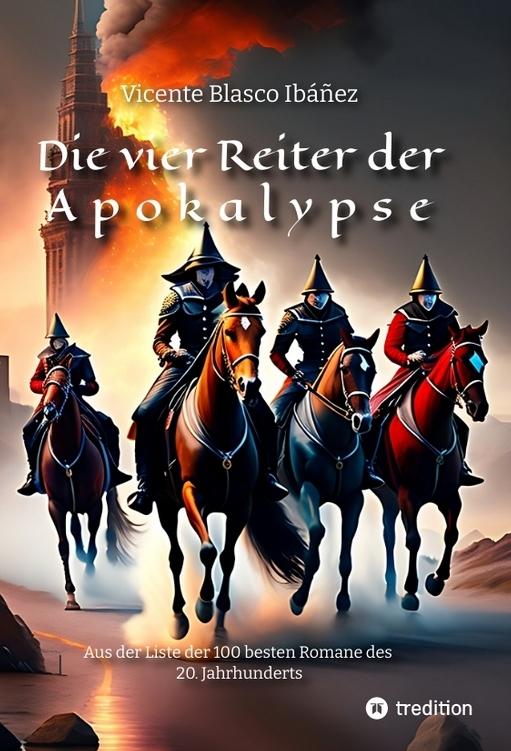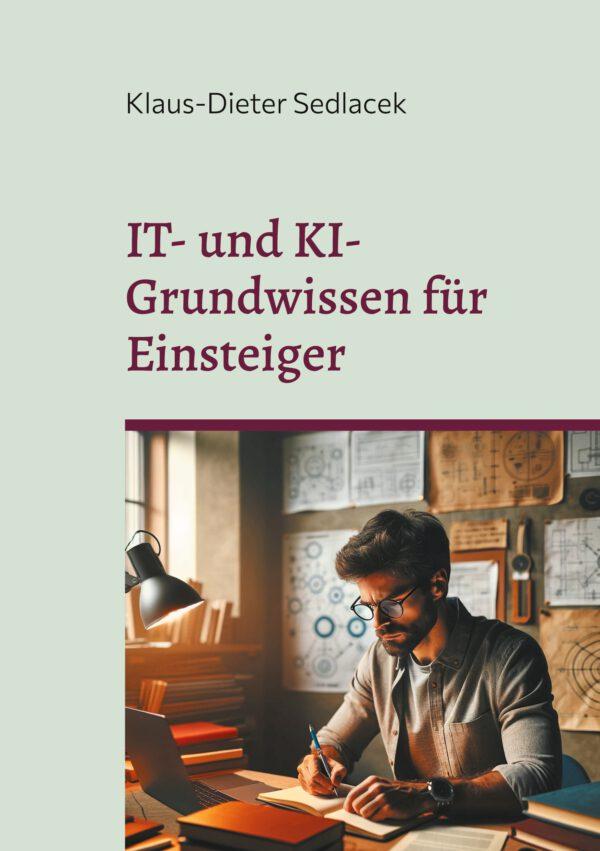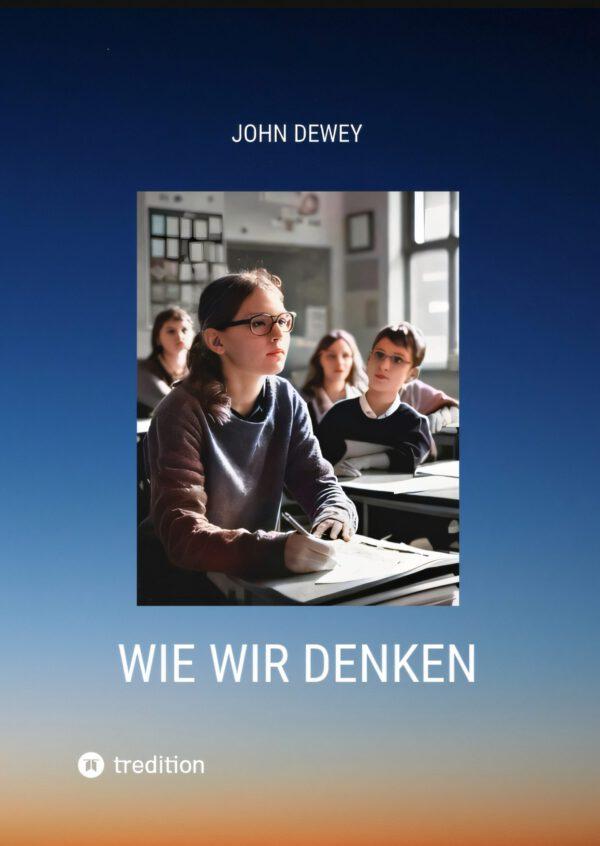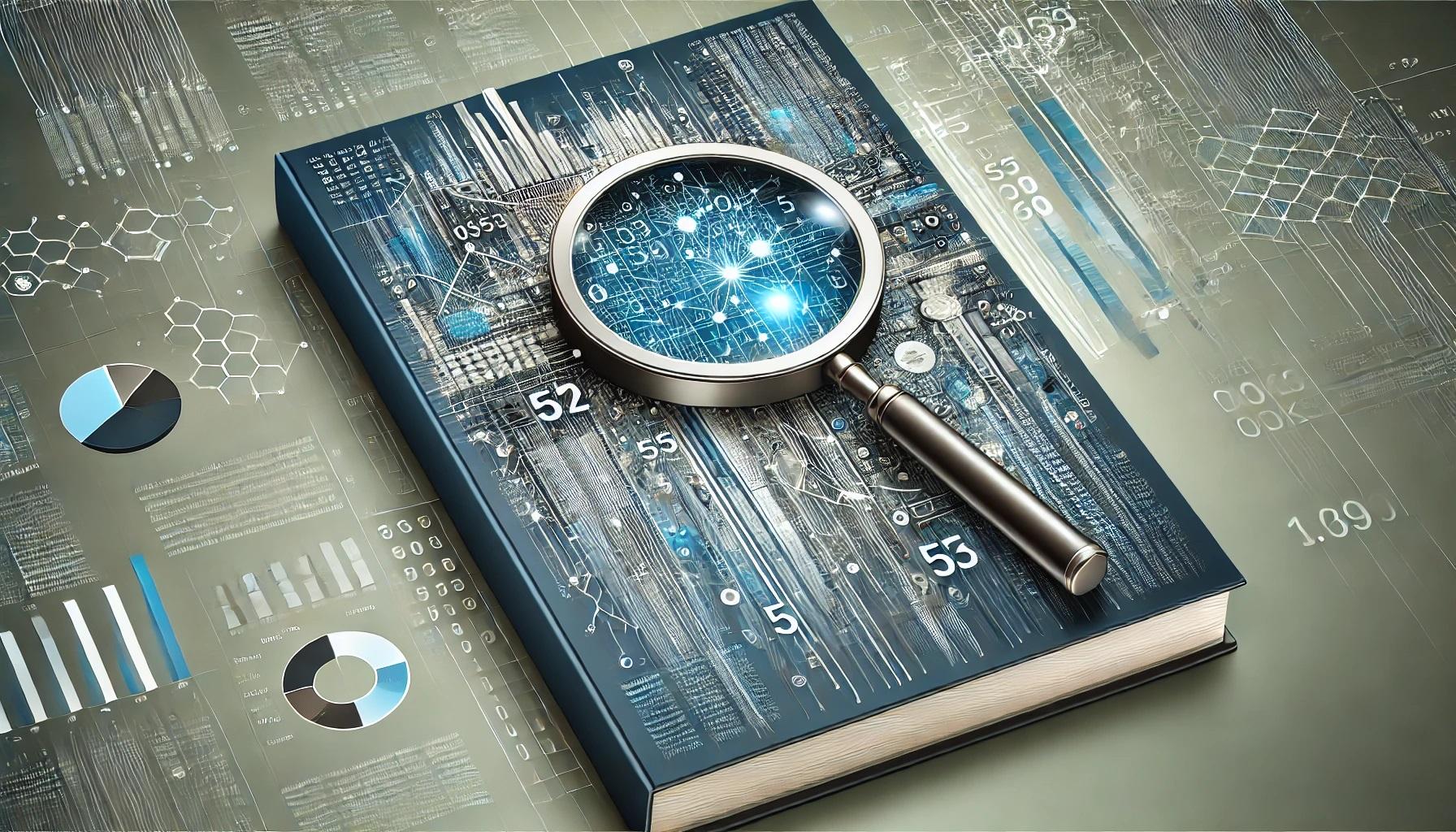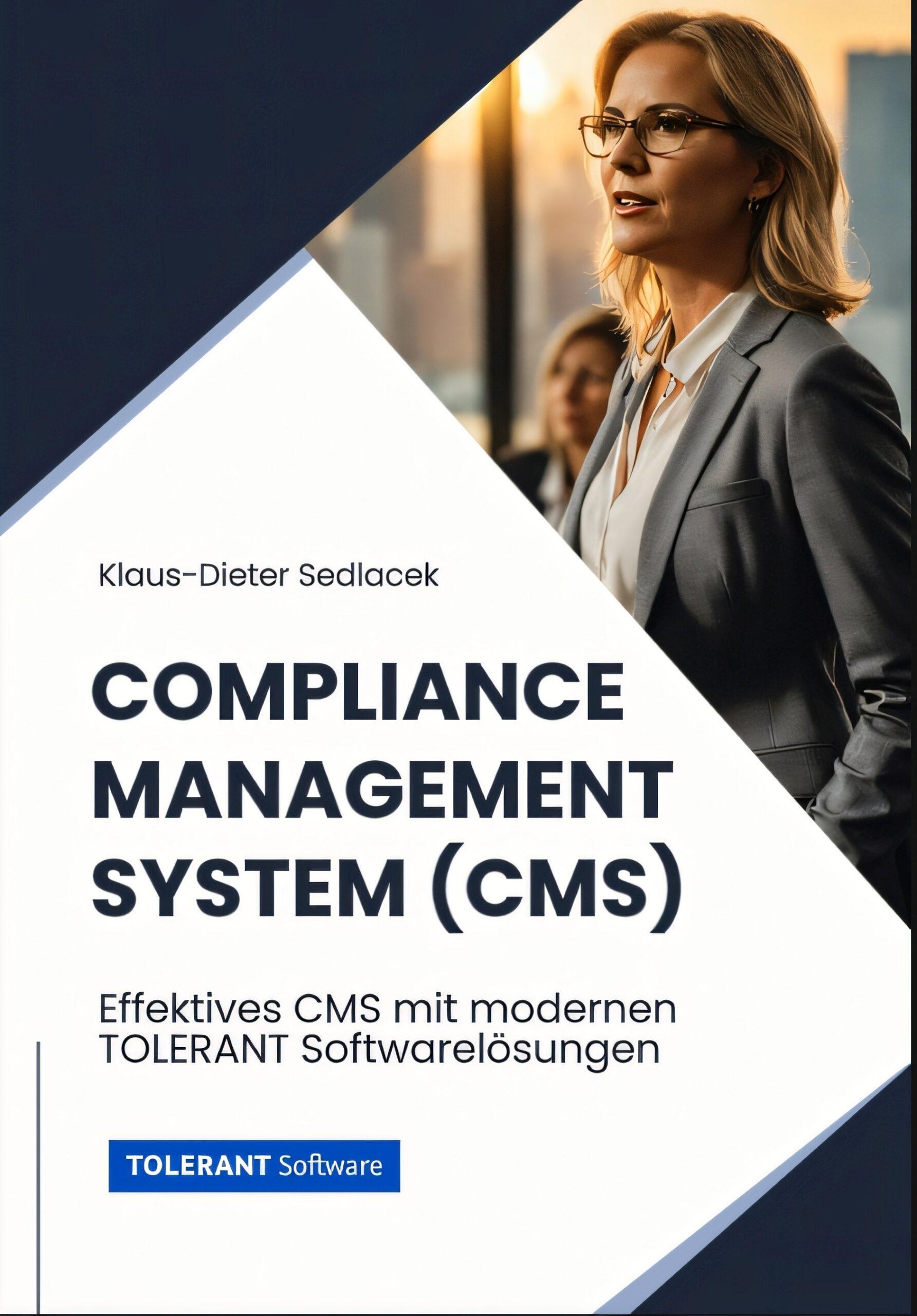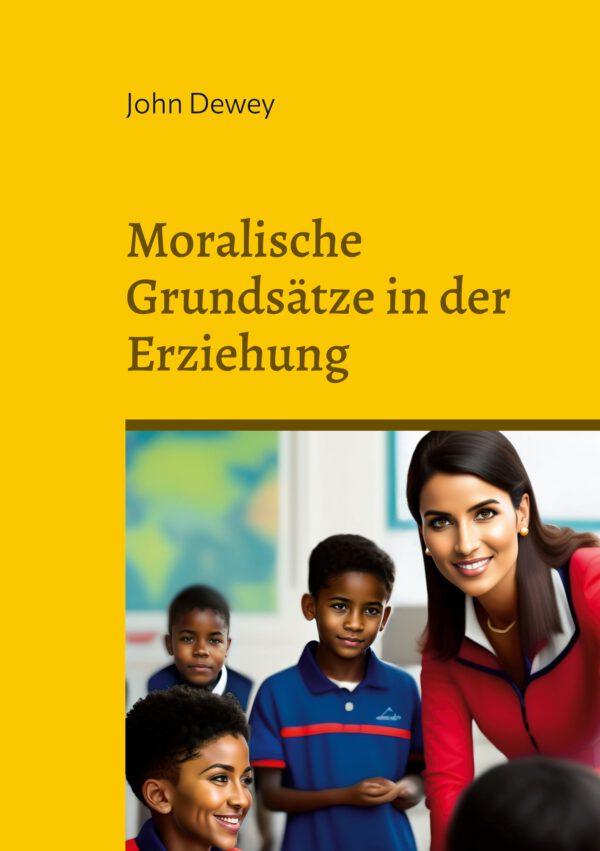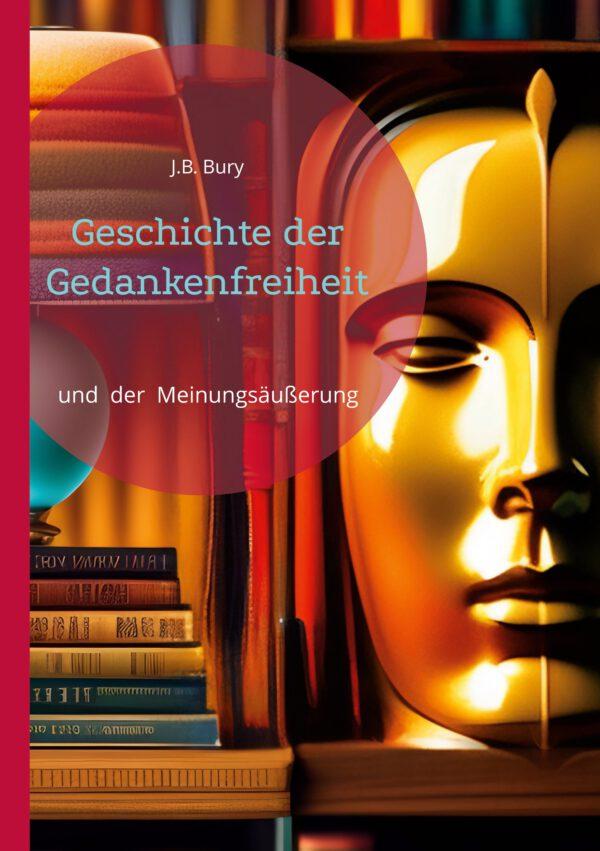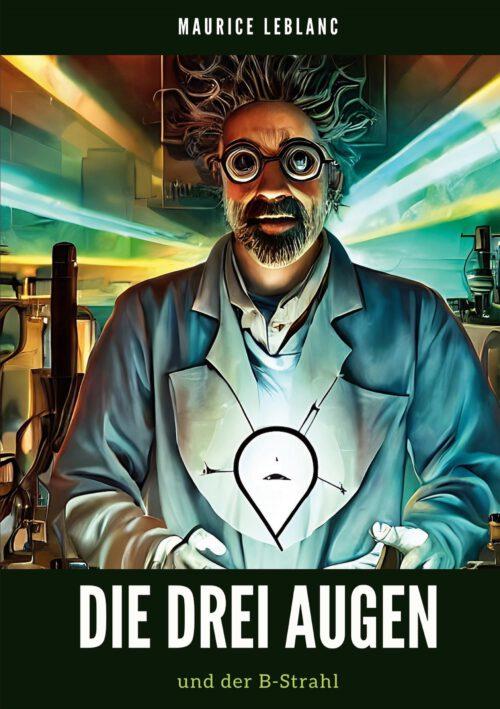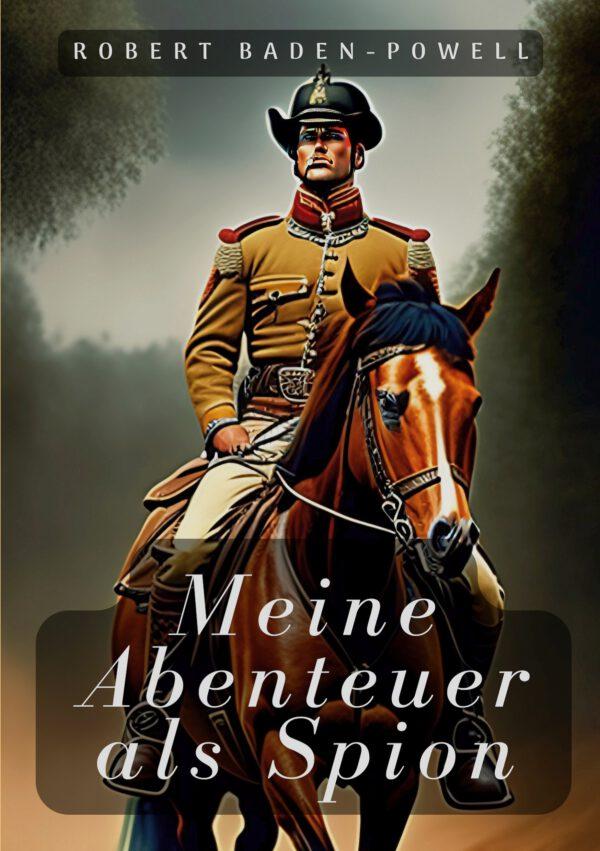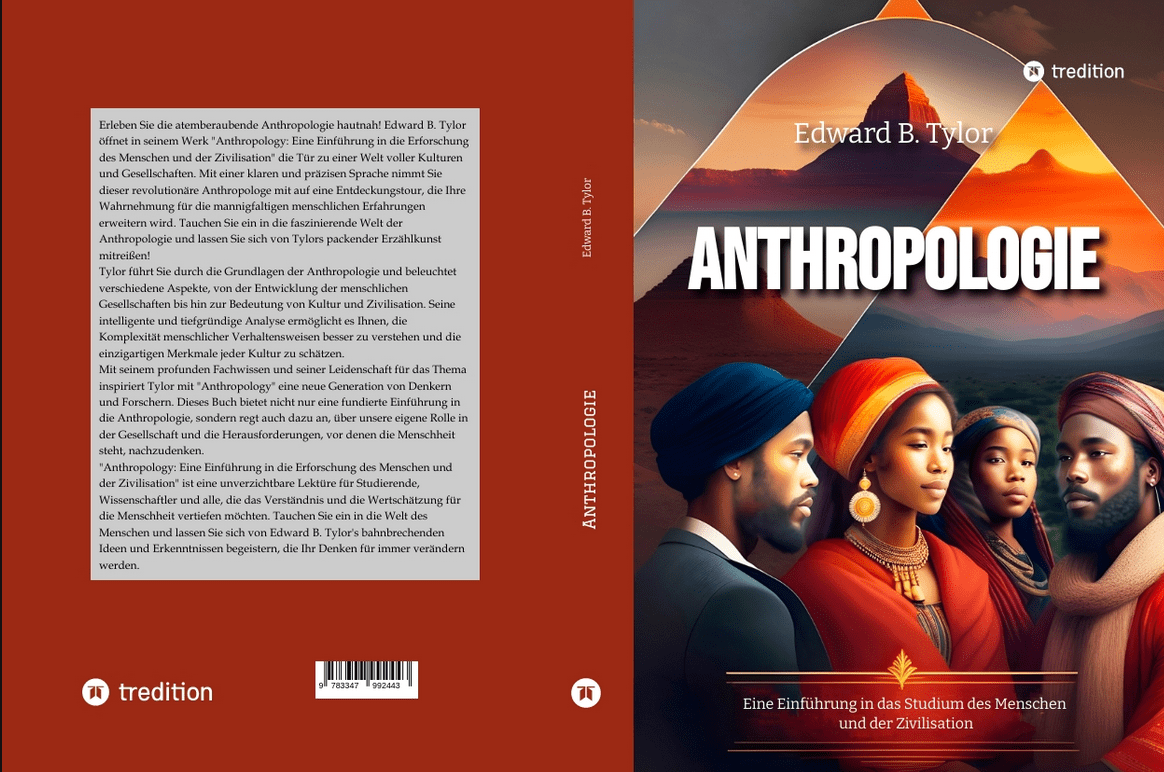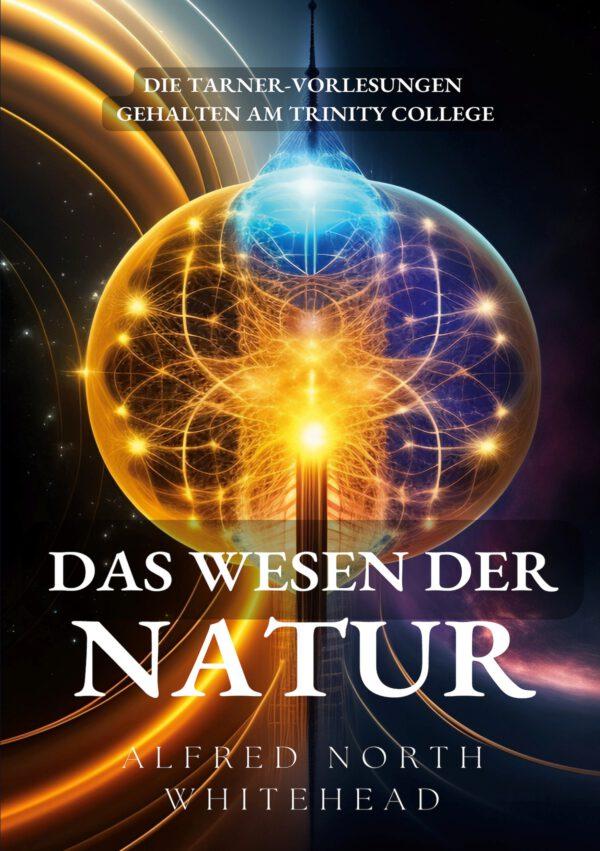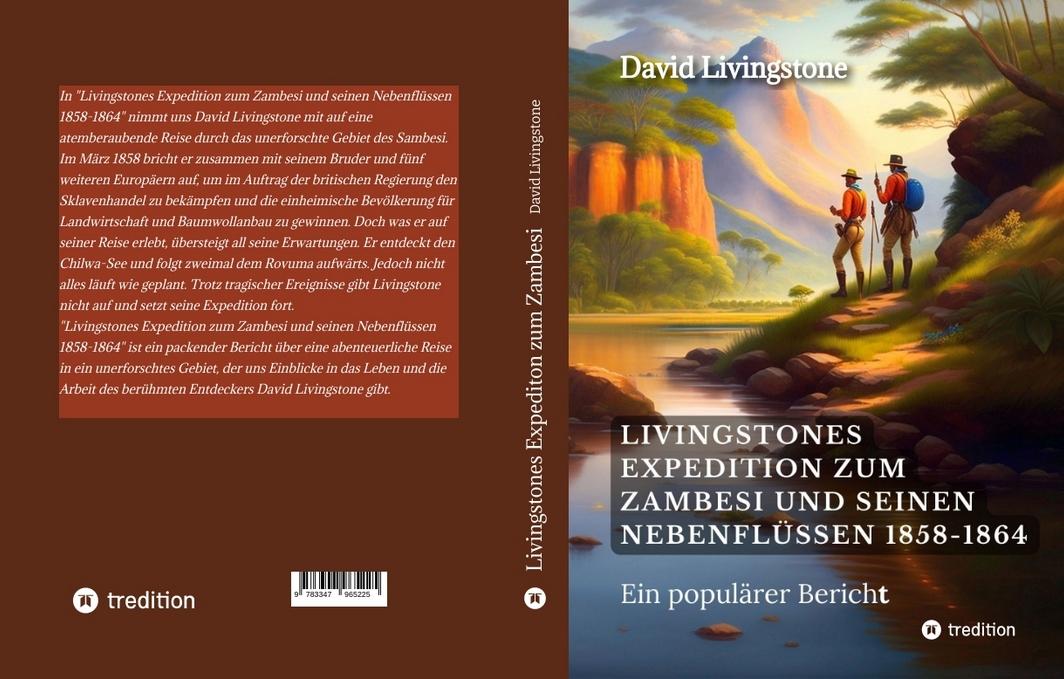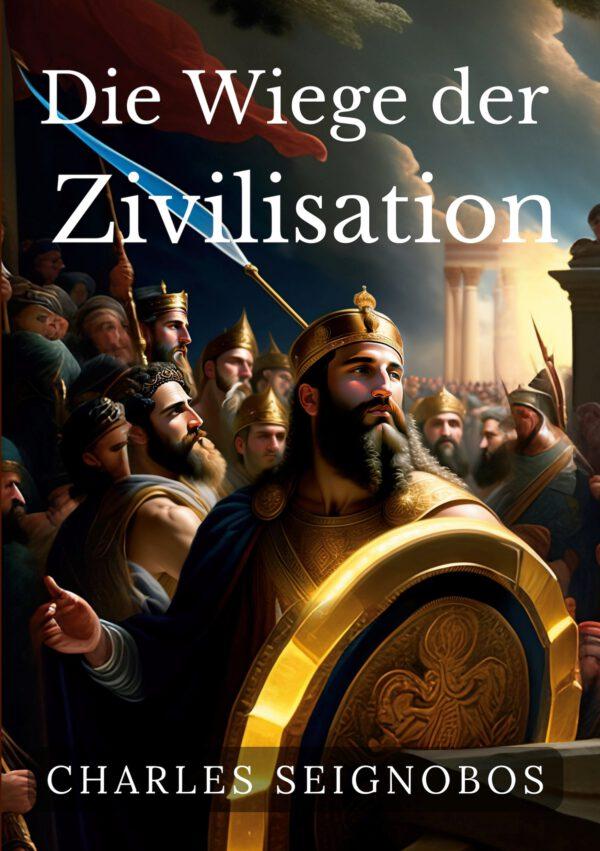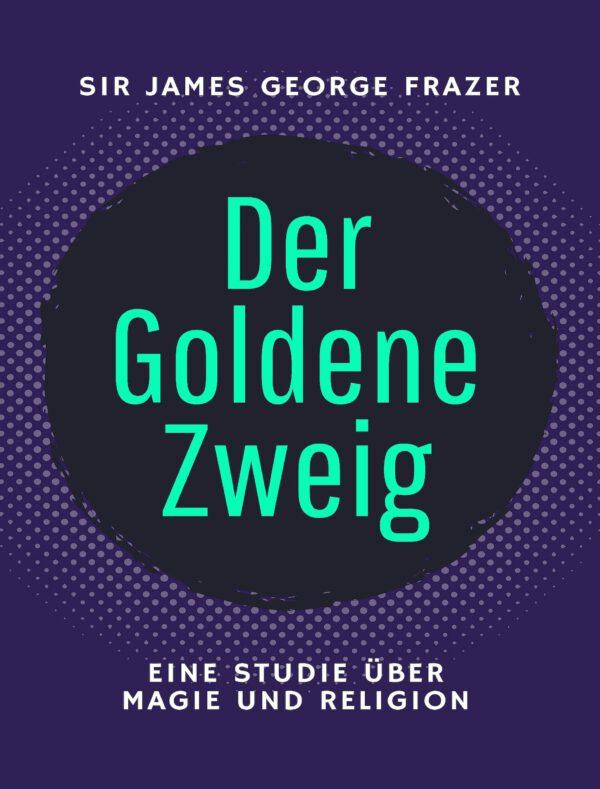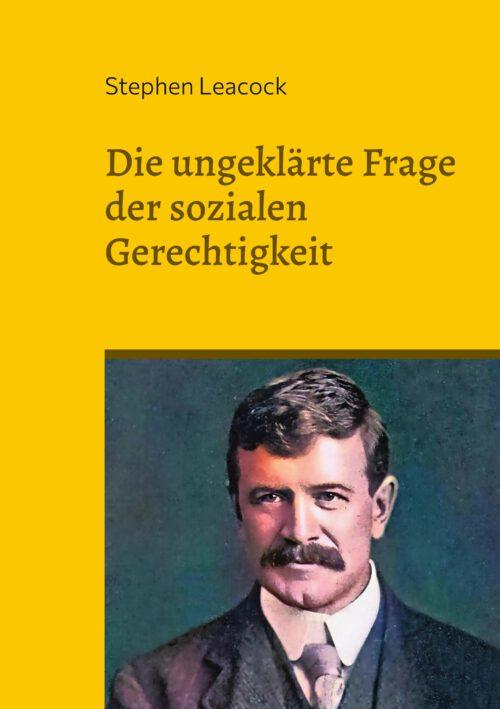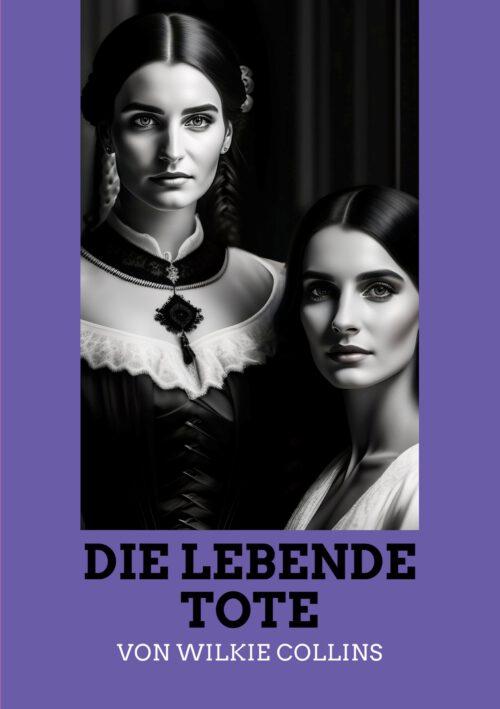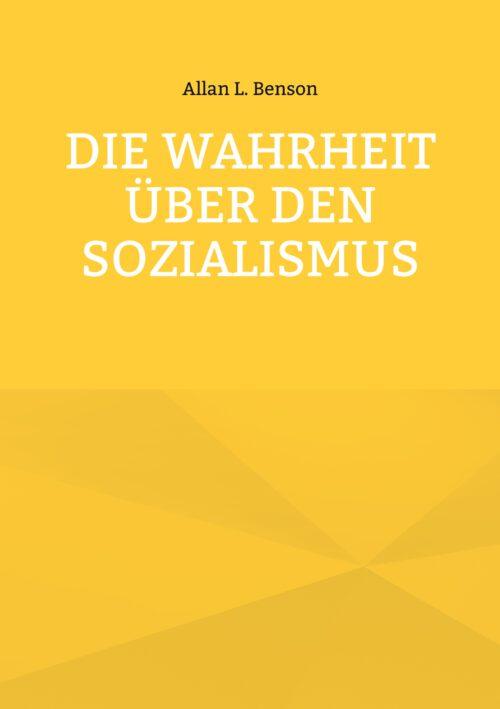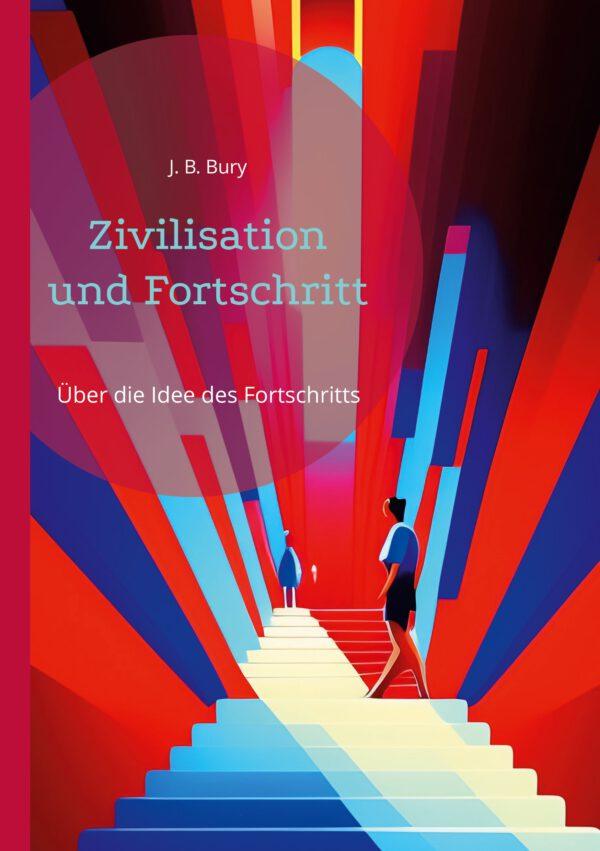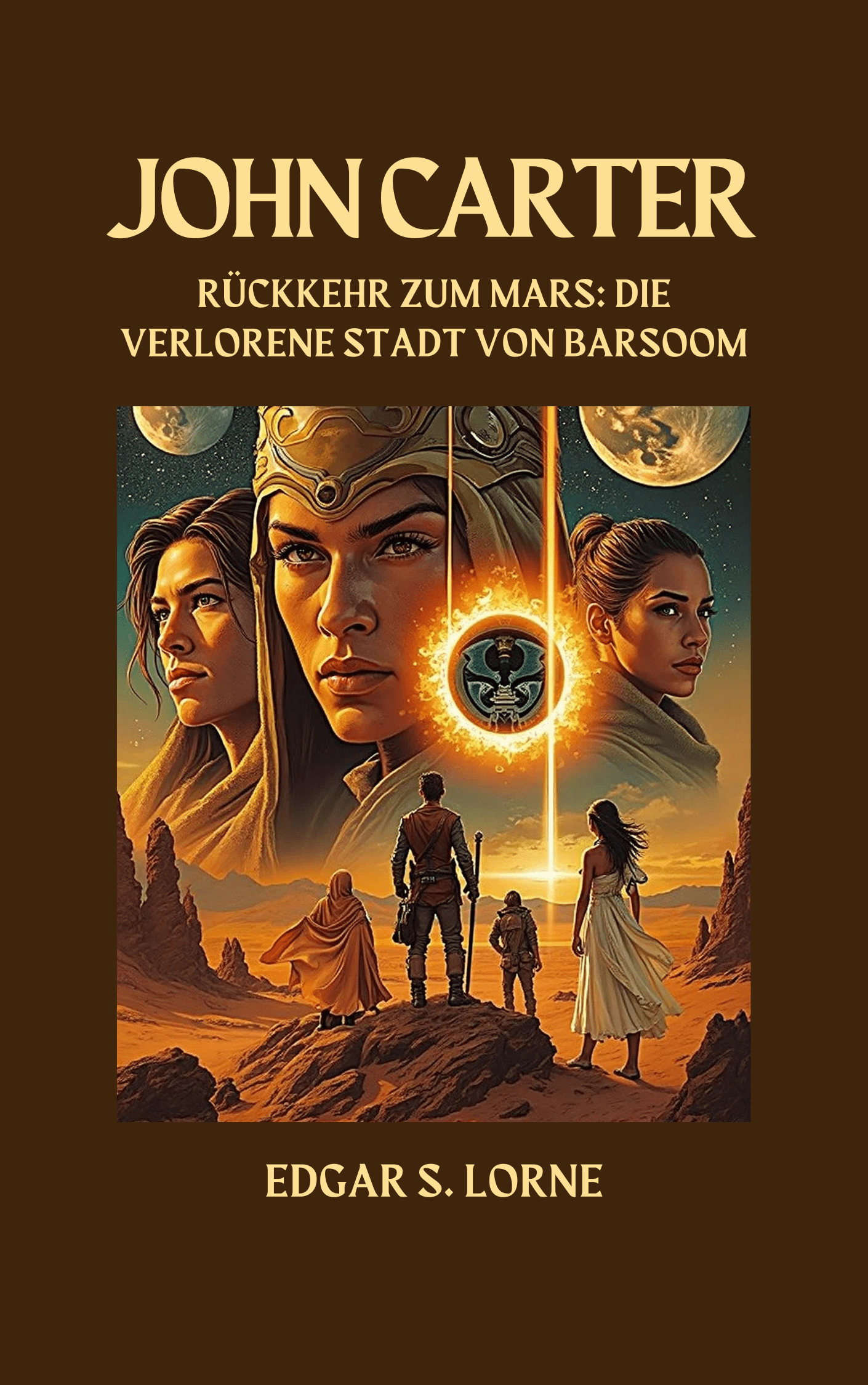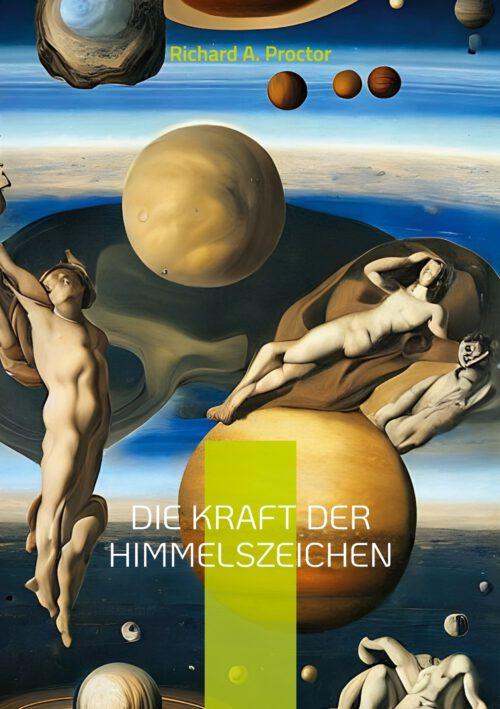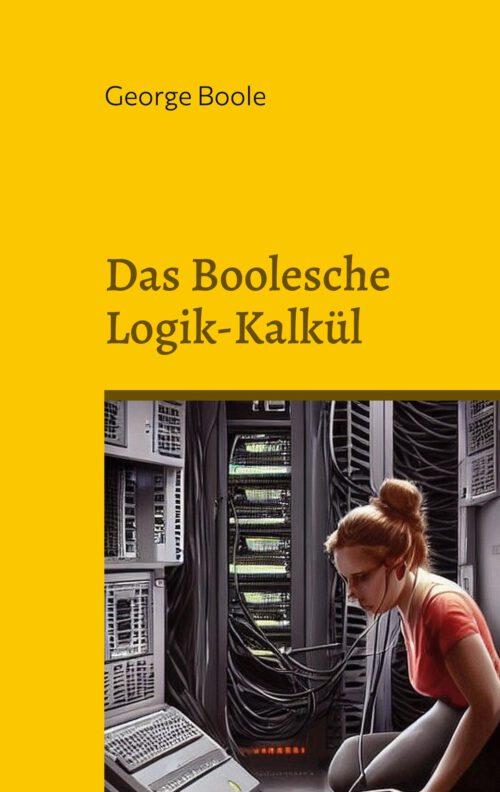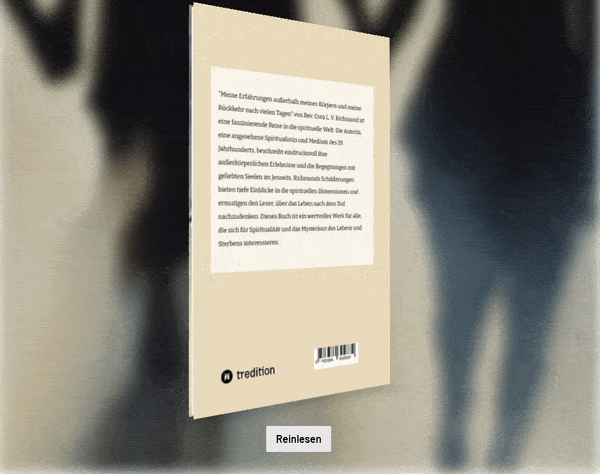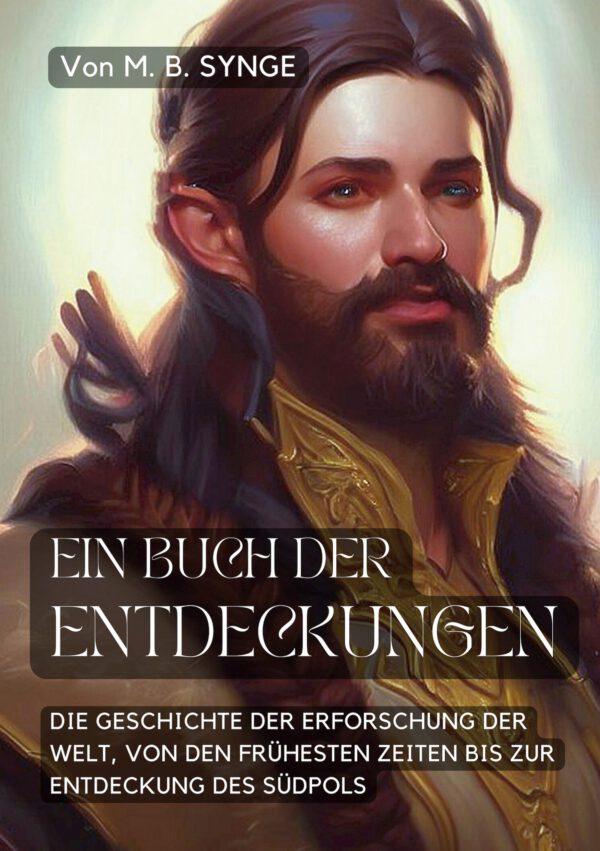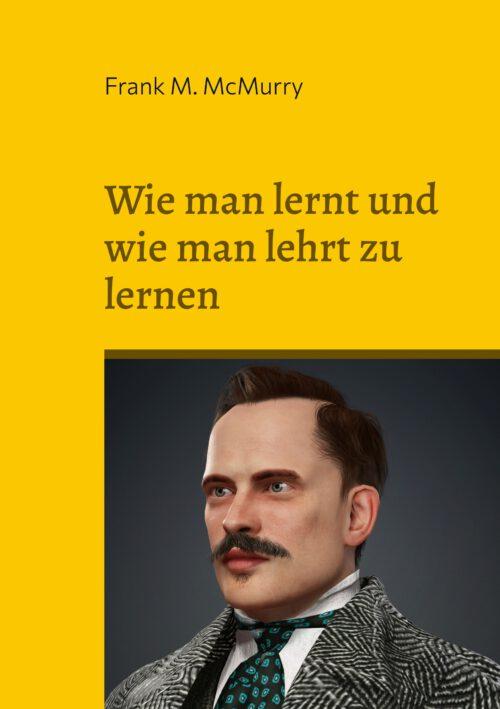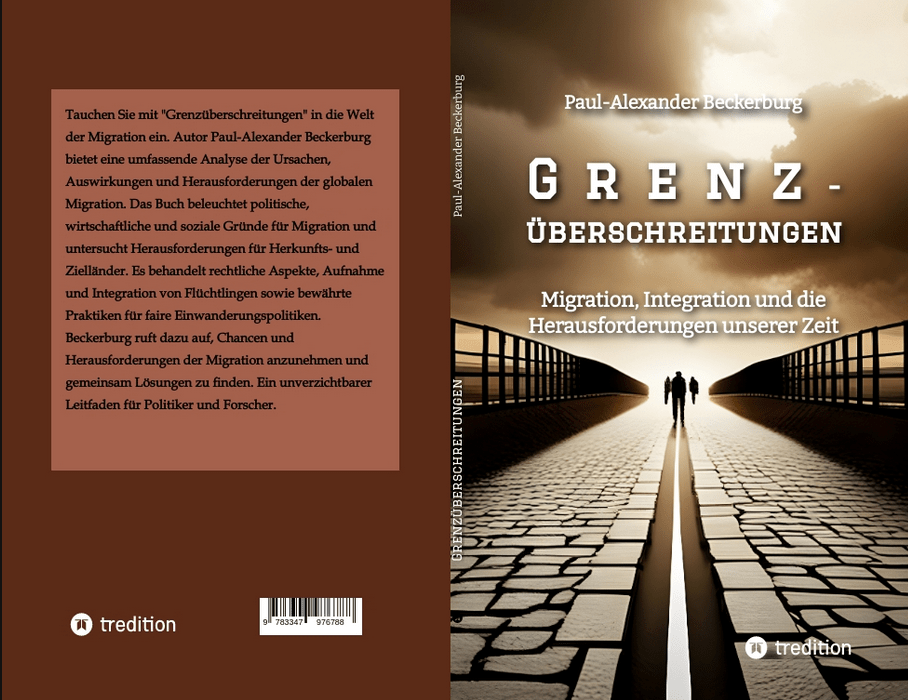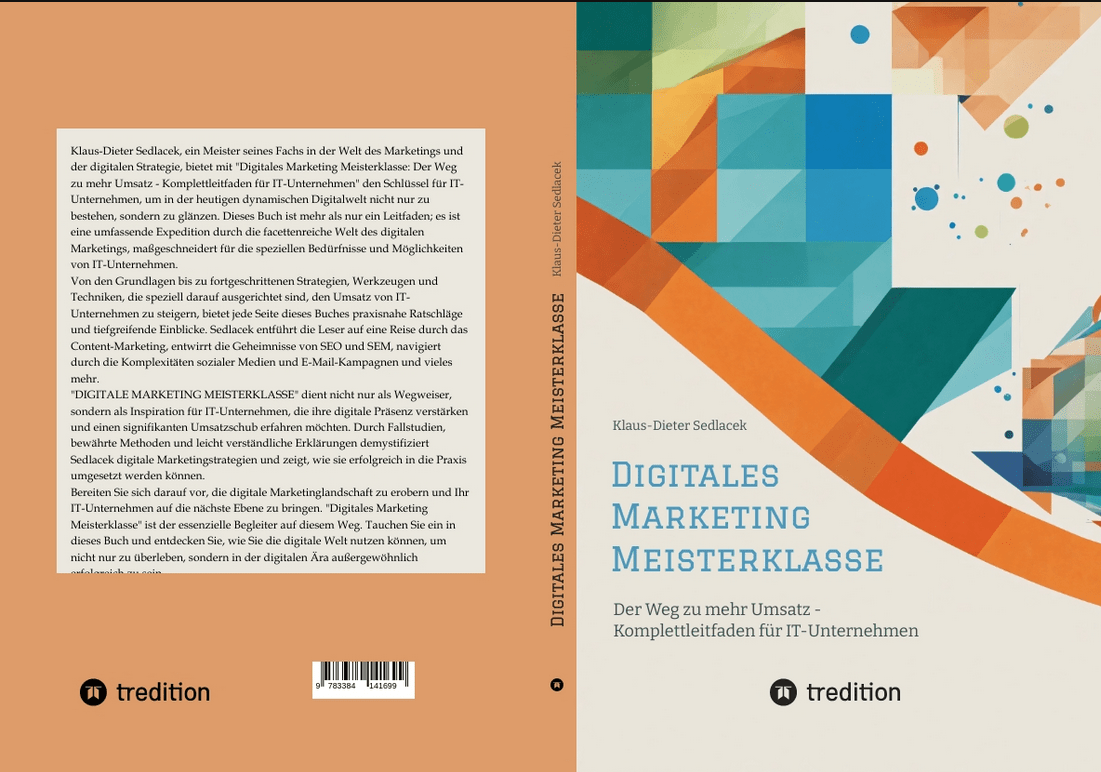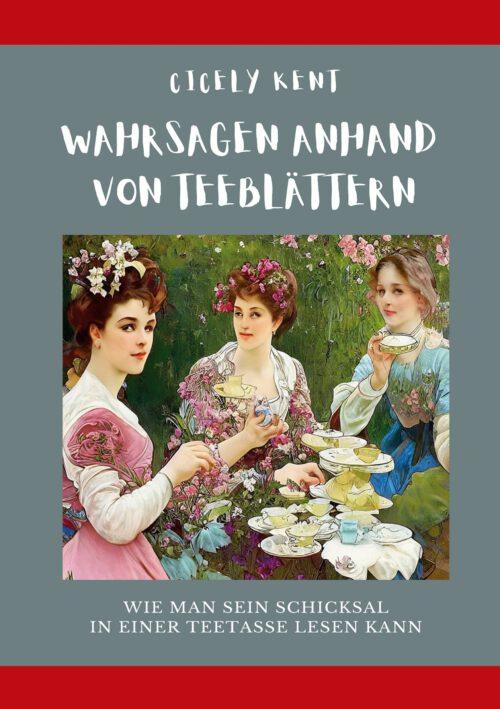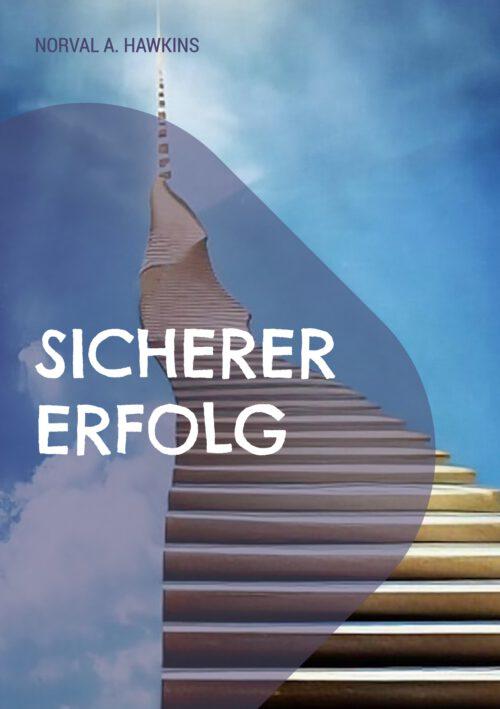In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend Einzug hält, steht die Frage im Raum, inwieweit die Rechte von Kreativen – darunter Autor:innen, Musiker:innen und Fotograf:innen – gewahrt bleiben. Die Diskussion über die Verwendung von Trainingsdaten für KI-Systeme hat in den letzten Jahren an Intensität gewonnen und zieht mittlerweile globale Aufmerksamkeit auf sich. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beleuchten die Autoren Benjamin Fischer, Marcus Jung und Tillmann Neuscheler die aktuellen Entwicklungen und deren weitreichende Implikationen, insbesondere im Hinblick auf die USA und Europa.
Künstliche Intelligenz beruht auf Daten, die aus verschiedenen Quellen gesammelt werden, um Algorithmen zu trainieren, die dann eigenständig Inhalte generieren können. Dies wirft die zentrale Frage auf, wie die urheberrechtliche Lage in Bezug auf diese Daten aussieht. In vielen Fällen werden für das Training von KI-Modellen urheberrechtlich geschützte Werke verwendet, ohne dass die Rechteinhaber:innen dafür entlohnt oder gefragt werden. Dies hat einen regelrechten Streit entfacht, der die Grenzen des Urheberrechts in der digitalen Ära herausfordert.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Fall von Künstler:innen, deren Werke ohne Zustimmung in großen Datenbanken gespeichert und genutzt werden, um KI-Modelle zu trainieren, die dann neue Kunstwerke, Texte oder Musik generieren. Diese Praktiken führen zu einem Dilemma: Während die Technologie in der Lage ist, kreative Prozesse zu revolutionieren und neue Möglichkeiten zu schaffen, bleibt unklar, wie die ursprünglichen Schöpfer:innen von diesen Entwicklungen profitieren können.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen variieren stark zwischen den USA und Europa. In den USA gibt es bereits einige wegweisende Urteile, die die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten durch KI-Systeme betreffen. Diese Entscheidungen könnten weitreichende Konsequenzen haben, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch auf internationaler Ebene. Das amerikanische Rechtssystem tendiert dazu, Innovationen und technologische Fortschritte zu fördern, was möglicherweise zu einer lockereren Handhabung von Urheberrechtsfragen führt. In der Folge könnte dies den Schutz der Rechte von Kreativen untergraben.
Auf der anderen Seite verfolgt Europa einen eher schützerischen Ansatz, wenn es um Urheberrechte geht. Die EU hat bereits Initiativen ergriffen, um die Rechte von Kreativen in der digitalen Welt zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist die Urheberrechtsrichtlinie, die darauf abzielt, die Rechte von Künstler:innen und Kreativen zu wahren und eine faire Vergütung für die Nutzung ihrer Werke sicherzustellen. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen könnten zu einem ungleichen Spielfeld für Kreativschaffende führen, je nachdem, wo ihre Werke veröffentlicht oder genutzt werden.
Die Diskussion um KI und Urheberrechte ist nicht nur technischer Natur, sondern berührt auch grundlegende ethische Fragen. Wie weit dürfen Maschinen gehen, um kreative Inhalte zu erstellen, und wo verläuft die Grenze zwischen Inspiration und Plagiat? Diese Fragen sind besonders relevant, wenn KI-Systeme lernen, indem sie auf riesige Mengen urheberrechtlich geschützter Inhalte zugreifen. Die Sorge, dass KI das kreative Schaffen der Menschen ersetzen oder entwerten könnte, ist weit verbreitet.
Es ist offensichtlich, dass wir uns an einem entscheidenden Wendepunkt befinden. Der Umgang mit KI und den damit verbundenen Urheberrechtsfragen wird die Zukunft der Kreativindustrie maßgeblich beeinflussen. Es bleibt abzuwarten, wie Gesetzgeber und die Gesellschaft insgesamt auf diese Herausforderungen reagieren werden. Eine ausgewogene Lösung, die sowohl die Innovationskraft von Künstlicher Intelligenz fördert als auch die Rechte der Kreativen schützt, ist von entscheidender Bedeutung.
Um den Dialog über diese wichtigen Themen zu fördern, ist es essenziell, dass Autor:innen, Musiker:innen, Fotograf:innen und andere Kreativschaffende in die Diskussion einbezogen werden. Nur durch Zusammenarbeit und das Teilen von Perspektiven kann ein fairer und nachhaltiger Rahmen geschaffen werden, der den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um zu klären, wie Künstliche Intelligenz und Urheberrechte in Einklang gebracht werden können, um die kreative Vielfalt und den Schutz der Kreativen zu gewährleisten.