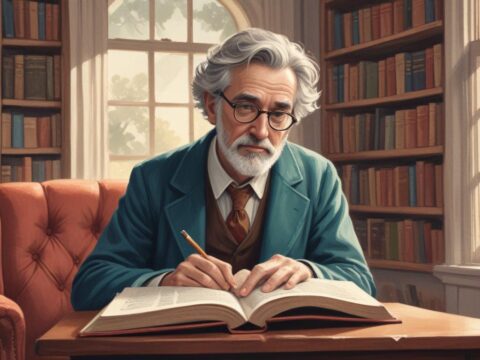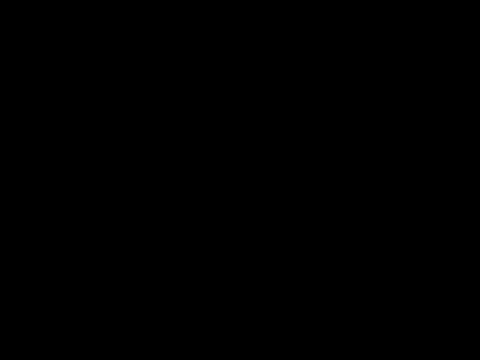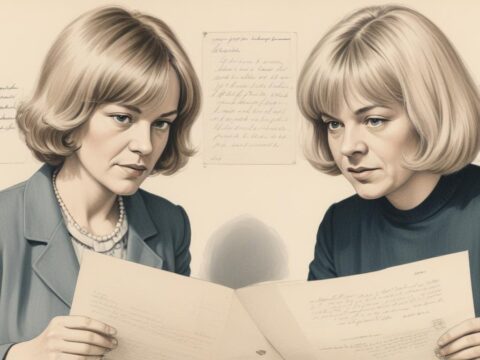Natasha Browns zweiter Roman „Von allgemeiner Gültigkeit“ ist ein scharfsinniger Kommentar zur gegenwärtigen Medienlandschaft und den damit verbundenen Identitätsfragen. Das Buch, dessen Originaltitel „Universality“ lautet, spricht unmittelbar die Debatte über universelle Ansprüche in einer Zeit an, in der gesellschaftliche Spaltungen und kulturelle Konflikte allgegenwärtig sind. Auf einer Metaebene untersucht der Roman die Frage, ob es überhaupt noch Konzepte gibt, die als universell gelten können, oder ob der Gedanke an einen solchen Universalismus in der heutigen Welt nur noch ironisch betrachtet werden kann.
Die Protagonistin Hannah, eine Journalistin, findet sich inmitten dieser komplexen Debattenkultur wieder. Ihre zentrale Handlung dreht sich um einen Kriminalfall, den sie in ihrem Artikel stark übertrieben und verzerrt darstellt, um für ihren Artikel ein Publikum zu gewinnen und in der teuren Metropole London über die Runden zu kommen. Ihr Weg kreuzt sich mit der Kolumnistin Lenny, die sich durch provokante Thesen und einen schockierenden Stil einen Namen gemacht hat. Lennys Aussagen, die häufig auf die vermeintliche Bedrohung durch die „Woke-Kultur“ abzielen, tragen zur satirischen Schärfe des Romans bei. Diese überzeichneten Charaktere verleihen dem Werk einen unterhaltsamen, zugleich kritischen Ton und münden in einem emotionalen Höhepunkt zwischen Lenny und einem überforderten Moderator.
Ein zentraler Aspekt des Romans ist der symbolische Kriminalfall, in dem ein antikapitalistischer Hausbesetzer namens Pegasus auf einer ökologischen Farm mit einem Goldbarren von enormem Wert niedergeschlagen wird. Dieses Element dient im Grunde als „MacGuffin“, ein Begriff, den Alfred Hitchcock prägte, um ein bedeutungsloses Objekt zu beschreiben, das die Handlung vorantreibt, ohne selbst eine tiefere Bedeutung zu haben. Der Roman vermittelt, dass es in der heutigen Medienwelt weniger um die Wahrheit geht, sondern vielmehr um die Debatte und die damit verbundenen Emotionen.
Die Charaktere sind dabei nicht klar in Gut und Böse einzuordnen. Selbst die opportunistische Lenny stellt kritische Fragen zur sozialen Gerechtigkeit und zu den Interessen der Menschen in Großbritannien. Brown zeichnet ein Bild der britischen Medienlandschaft, die wie ein Dschungel wirkt, in dem Idealismus und Empathie oft auf der Strecke bleiben. Gleichzeitig thematisiert sie das Leben von Londoner Millennials der Mittelschicht, die sich in einem ständigen Wettbewerb um sozialen Status und Snobismus befinden. Eine besonders eindrucksvolle Szene findet während eines Abendessens in Hannahs Wohnung statt, wo pointierte Dialoge humorvoll aufzeigen, wie sehr die Figuren in den medialen Diskurs verstrickt sind, der sie letztlich gegeneinander aufbringt.
Ein weiteres zentrales Thema ist die Unfähigkeit der Charaktere, empathisch miteinander zu kommunizieren. Sie sind gefangen in ihren eigenen Meinungen und wiederholen oft nur die Ansichten, die sie aus Online-Artikeln oder Podcasts übernommen haben. Von John, der die „herablassenden“ linken Medien kritisiert, bis hin zu Guin, die alles abprallen lässt, und Hannah, die ständig mit Vorwürfen von Klassismus und Rassismus um sich wirft – Sympathieträger sind rar.
Besonders erwähnenswert ist die Gruppe „Die Universalisten“, zu der der geschlagene Pegasus gehört. Sie glauben an ein gemeinschaftliches Leben jenseits sozialer Unterschiede, aber die Erzählstimme macht deutlich, dass dieser Traum schon lange vorbei ist. Der Roman verdeutlicht, dass die unterschiedlichen Identitäten und Perspektiven der Figuren letztendlich überwiegen.
Brown thematisiert auch die Frage, wie Wahrheiten von individuellen Perspektiven abhängen. Während das Buch stark in der britischen Kultur verwurzelt ist, behandelt es universelle Themen, die weltweit relevant sind, insbesondere im Zusammenhang mit Identitätspolitik. Brown gelingt es, die Komplexität dieser Themen aufzugreifen und sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
Im ersten Teil des Buches, der als Artikel von Hannah präsentiert wird, wird ein zeitgenössischer journalistischer Stil verwendet, der die Form von essayistischen Reportagen aufgreift. Hierbei spielt die Autorin bewusst mit dem Eindruck, dass der Stil absichtlich schlecht ist, um die typisch elliptischen Strukturen solcher Texte zu parodieren, die oft in großen Zeitungen zu finden sind. Der Stilwechsel im zweiten Teil des Romans ist deutlich runder und bietet dem Leser eine angenehmere Lesart.
Insgesamt ist „