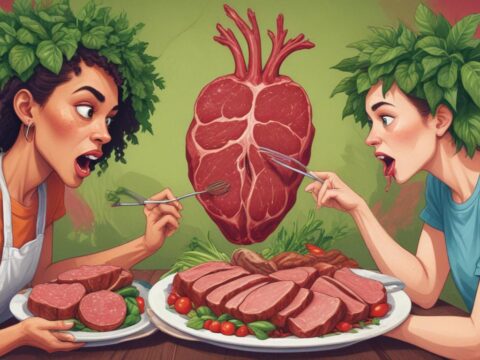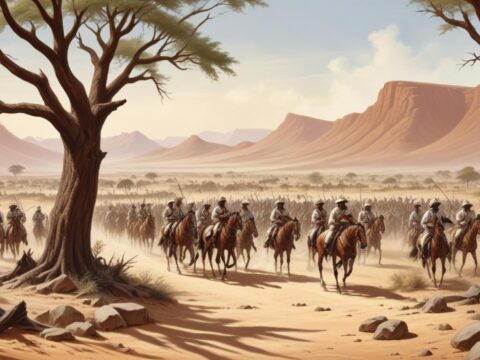In einer Zeit, in der lautes Reden und das Streben nach Aufmerksamkeit vorherrschen, ruft Bernhard Pörksen in seinem Buch „Zuhören. Die Kunst sich der Welt zu öffnen“ dazu auf, eine wertvolle Fähigkeit zurückzugewinnen: das bewusste und empathische Zuhören. In einer Welt, in der Polarisierung, Fake News und gesellschaftliche Spaltungen zunehmen, scheinen die Menschen vor allem darauf bedacht zu sein, ihre eigene Meinung zu äußern, anstatt sich aktiv auf die Perspektiven anderer einzulassen. Diese einseitige Kommunikationskultur gefährdet nicht nur die Debattenkultur, sondern auch die Grundlagen der Demokratie.
Pörksen, ein Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und Autor mehrerer Werke über die Auswirkungen der Digitalisierung und Skandalforschung, argumentiert, dass das Zuhören mit dem Reden gleichwertig ist. Wer nicht in der Lage ist zuzuhören, sollte sich auch nicht an Diskussionen beteiligen, da er sich in einem „resonanzfreien Raum“ bewegt, in dem echter Austausch nicht möglich ist.
Der Autor unterscheidet zwischen dem „Ich-Ohr“ und dem „Du-Ohr“. Während das erste Ohr vor allem auf die eigenen Bedürfnisse und Überzeugungen fokussiert ist, ermöglicht das zweite Ohr, sich auf die Perspektive des Gegenübers einzulassen. Dies mag simpel erscheinen, ist in der Praxis jedoch eine anspruchsvolle Kunst. Echtes Zuhören bedeutet, sich selbst zu begegnen und die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Es erfordert Mut und die Bereitschaft, sich auf das Unbekannte und das Andersartige einzulassen.
Die Fähigkeit zuzuhören ist eng verbunden mit der Bereitschaft, die eigene Sichtweise zu überdenken und gegebenenfalls zu revidieren. Wer zuhört, erkennt die Möglichkeit, dass er sich geirrt hat oder in seiner Wahrnehmung eingeschränkt ist. Pörksen beschreibt, dass echtes Zuhören eine aktive Praxis darstellt, die ständigen Abgleich mit dem eigenen Wissen und Empfinden erfordert. Das Zuhören wird somit zu einem dynamischen Prozess, der sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Veränderungen anstoßen kann.
Ein zentrales Anliegen des Autors ist es, die Leser dazu zu ermutigen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Er beleuchtet die Gefahren der zunehmenden Informationsflut und der digitalen Kommunikation, die oft anonym und unpersönlich ist. In diesem Kontext warnt er vor der Gefahr von „Aufmerksamkeitsoverkill“, der das Zuhören erschwert und zu einer erhöhten emotionalen Belastung führen kann. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt Pörksen regelmäßige „Zuhör-Pausen“, um sich neu zu orientieren und die eigene Fähigkeit zur Empathie zu stärken.
Ein weiterer wichtiger Punkt in Pörksens Argumentation ist die Bedeutung der persönlichen Erzählung. Er betont, dass empathisches Zuhören durch Geschichten gefördert wird, die Gefühle ansprechen und somit eine tiefere Verbindung zwischen den Gesprächspartnern schaffen. Durch das Verknüpfen von Fakten mit biografischen Aspekten können tiefere Einsichten gewonnen werden, die das Verständnis füreinander erweitern und Konflikte entschärfen.
Die Vielzahl und Schwere der aktuellen Krisen könnte dazu führen, Pörksens Plädoyer für eine verbesserte Kommunikationskultur zu unterschätzen. Doch in einer Welt, die von lautstarken Meinungen geprägt ist, könnte genau diese Rückbesinnung auf die Kunst des Zuhörens der Schlüssel zu mehr Harmonie und Verständnis sein. Pörksens Appell an die Leser, sich dieser Fähigkeit zu widmen, ist ein Aufruf zur aktiven Teilnahme an einem Dialog, der Raum für unterschiedliche Meinungen und Perspektiven schafft.
Abschließend lässt sich sagen, dass Bernhard Pörksens „Zuhören. Die Kunst sich der Welt zu öffnen“ nicht nur eine theoretische Abhandlung über Kommunikation ist, sondern ein praktischer Leitfaden für alle, die in einer komplexen Welt lebendig und empathisch miteinander umgehen möchten. Es bleibt zu hoffen, dass diesem wichtigen Anliegen Gehör geschenkt wird.