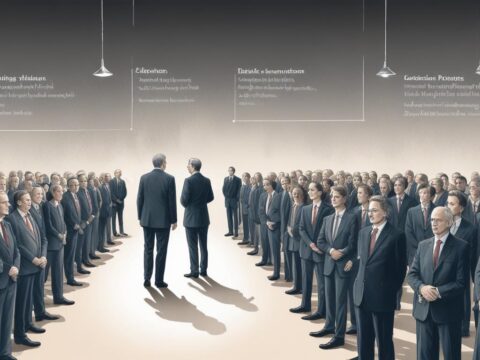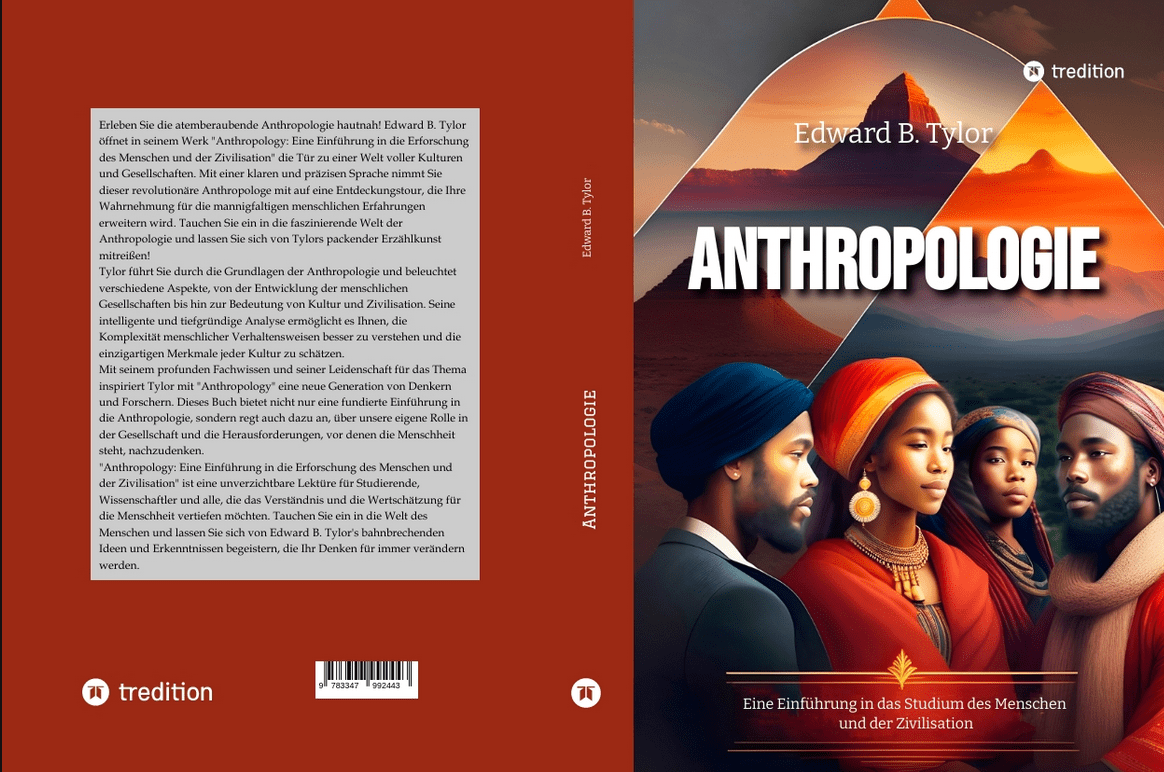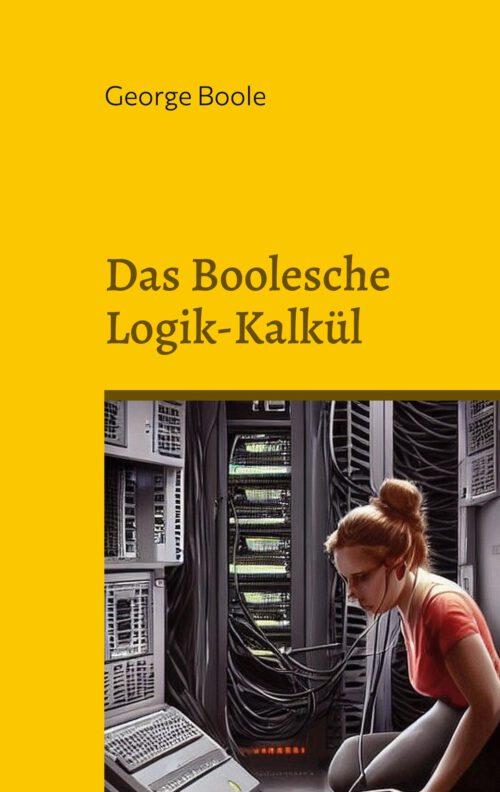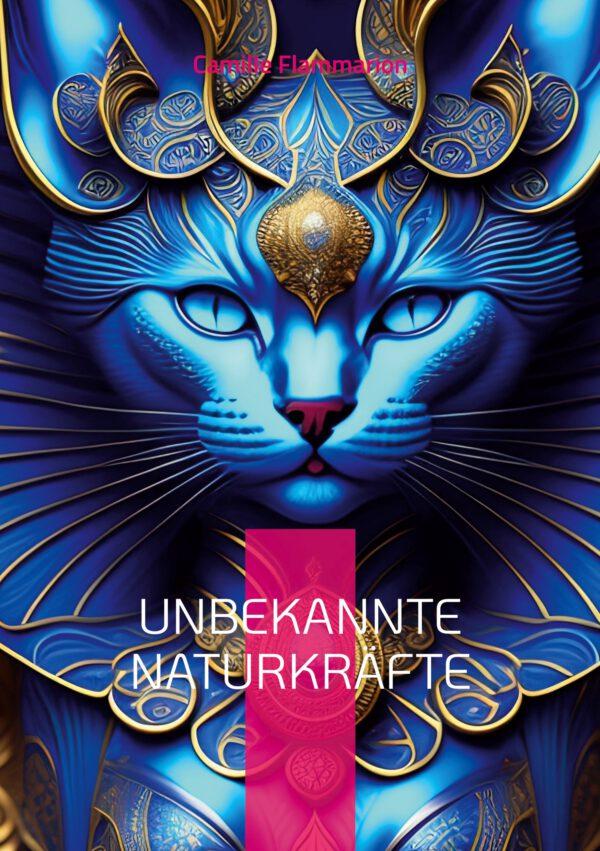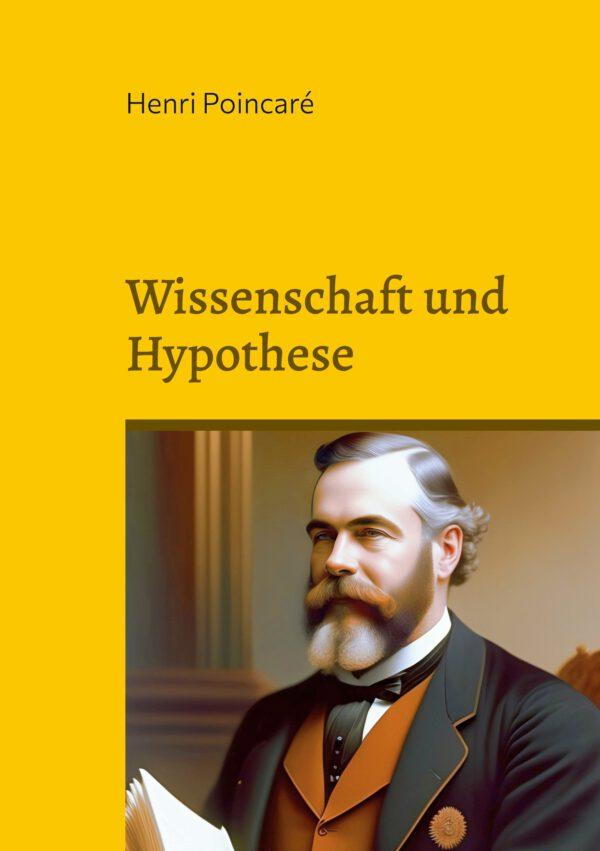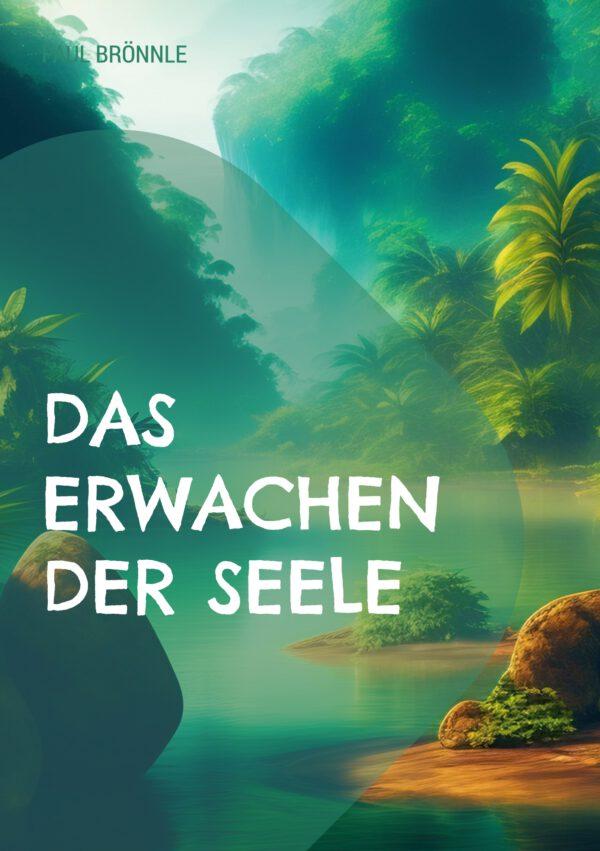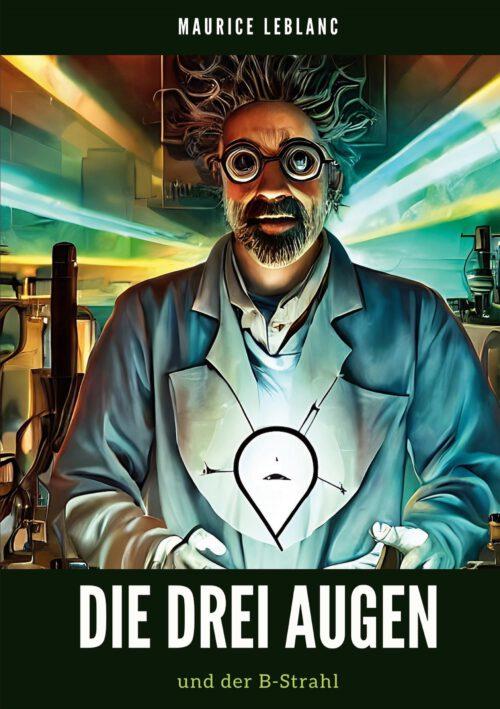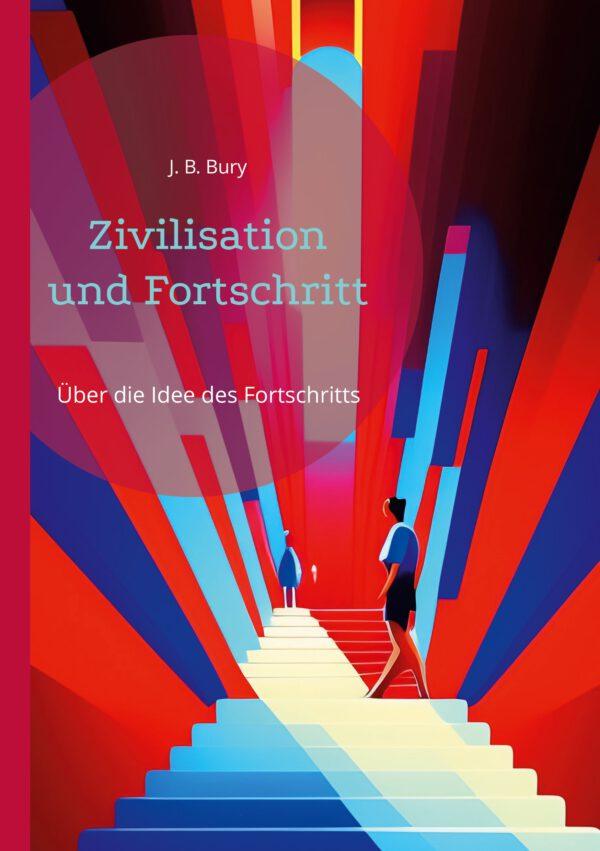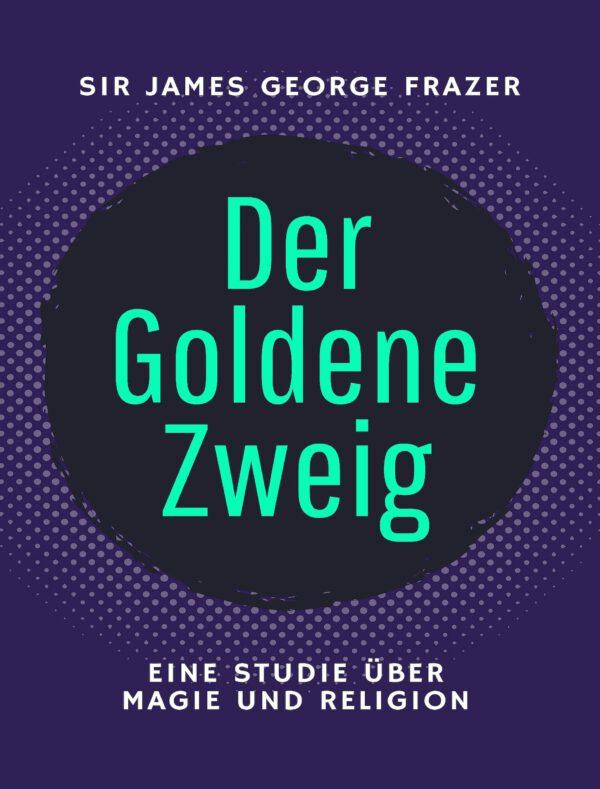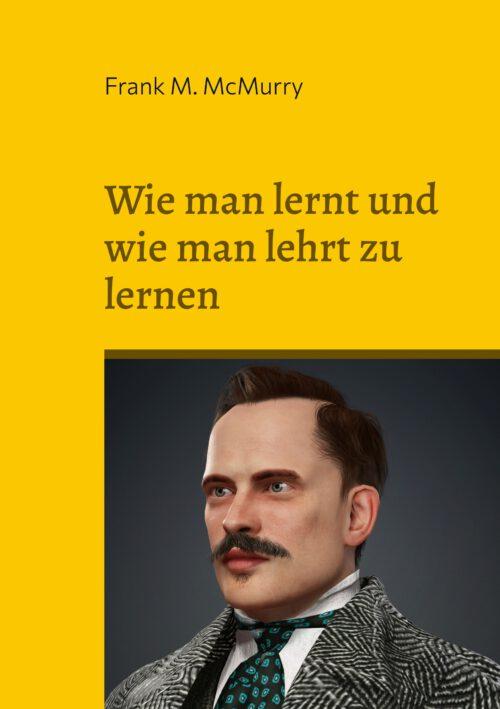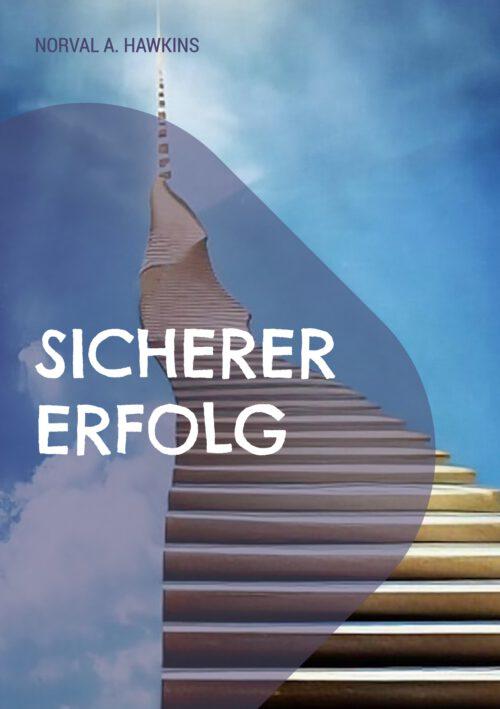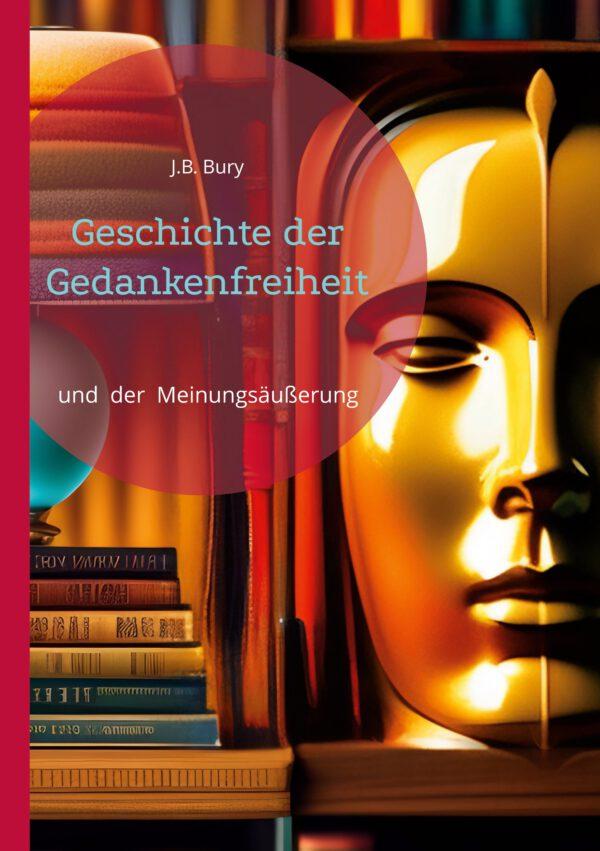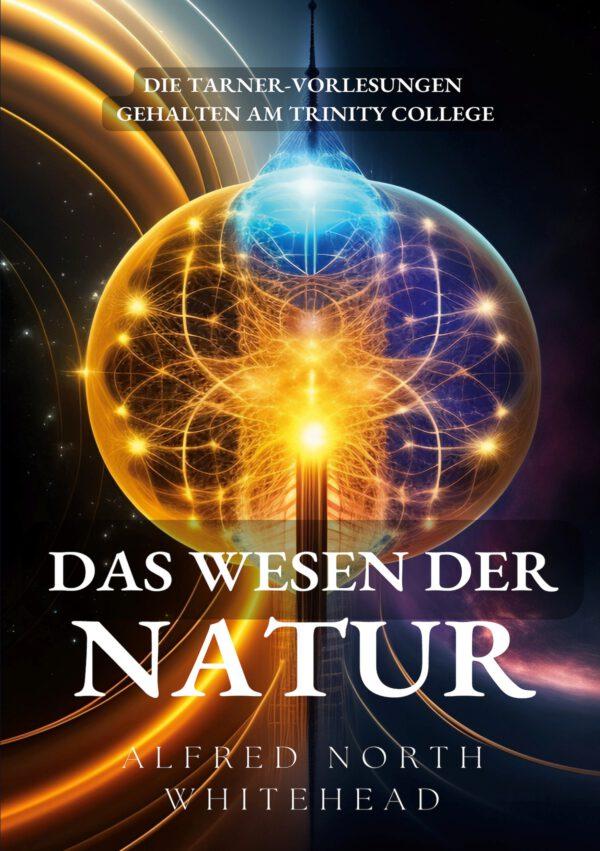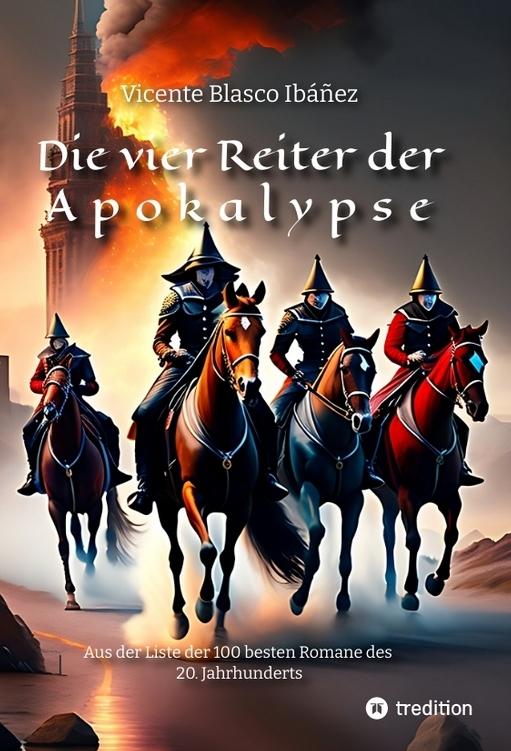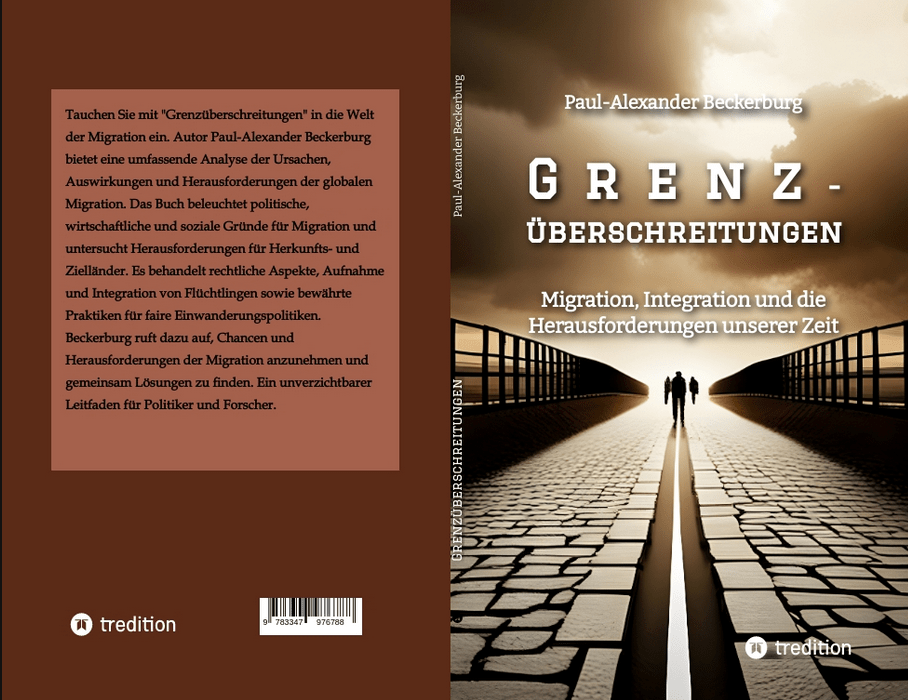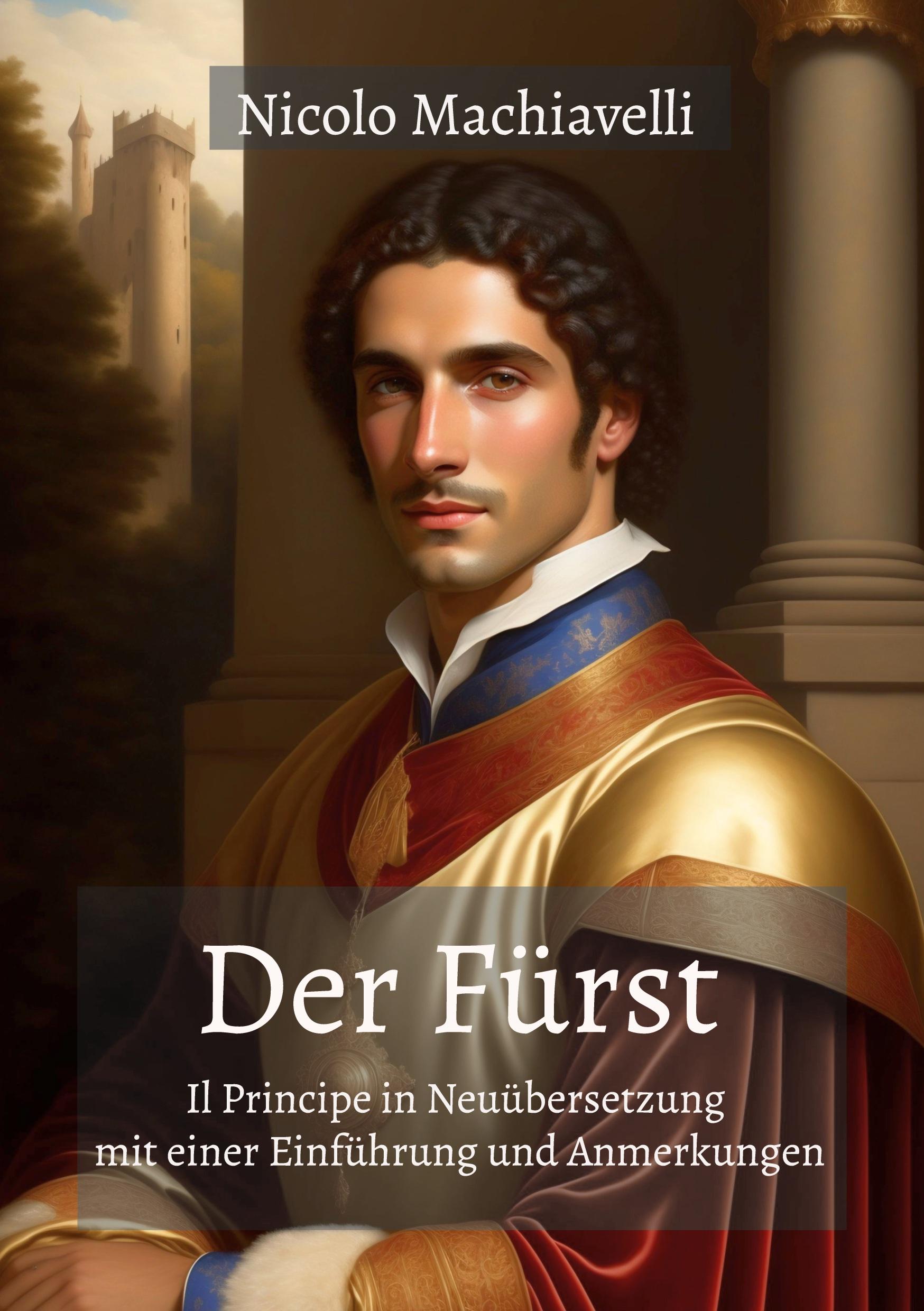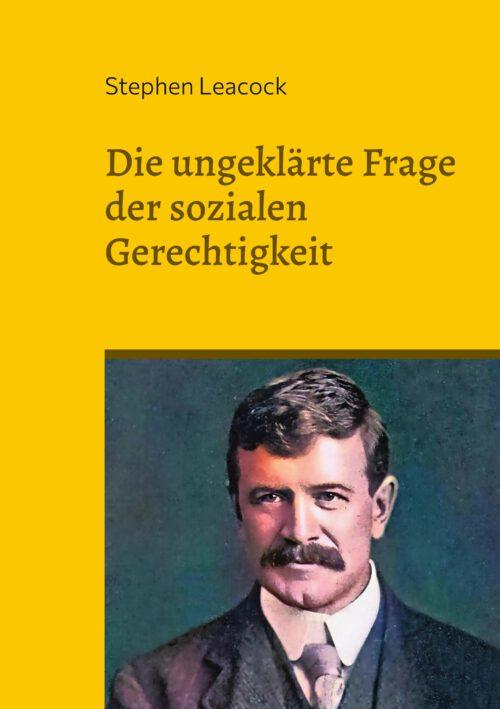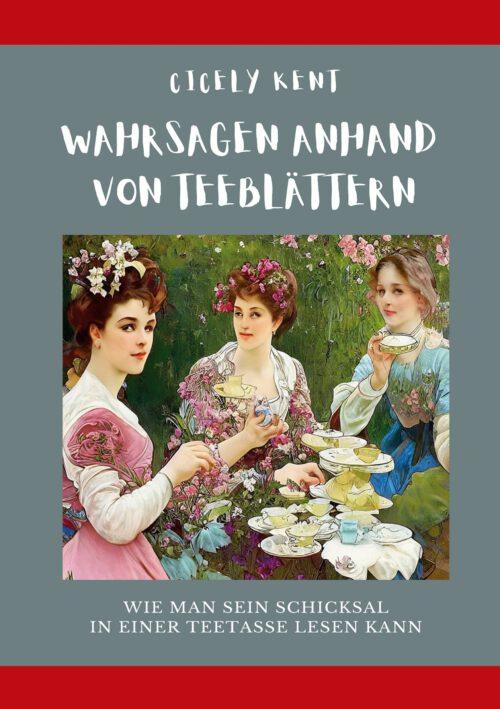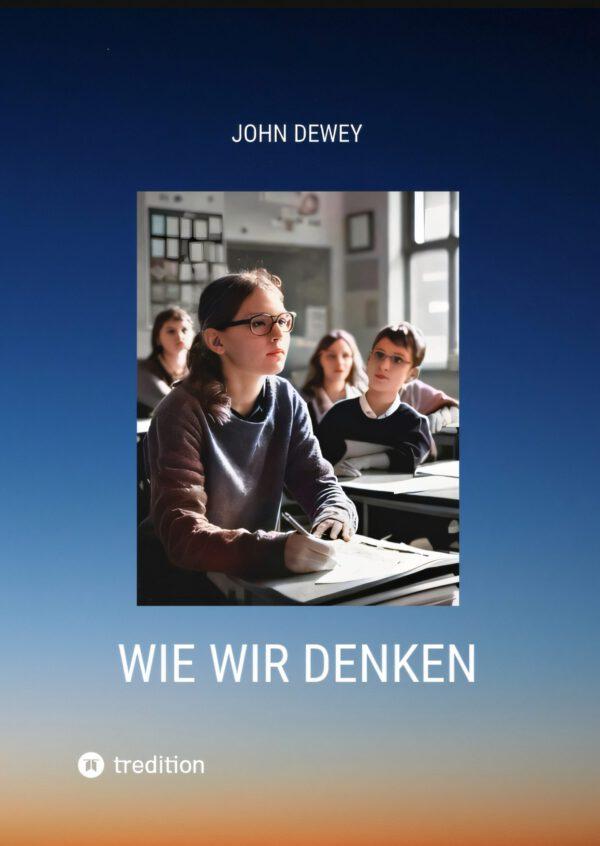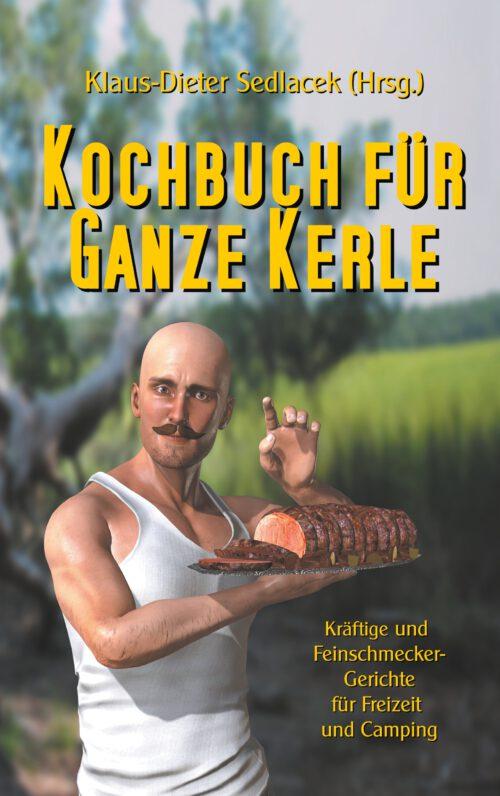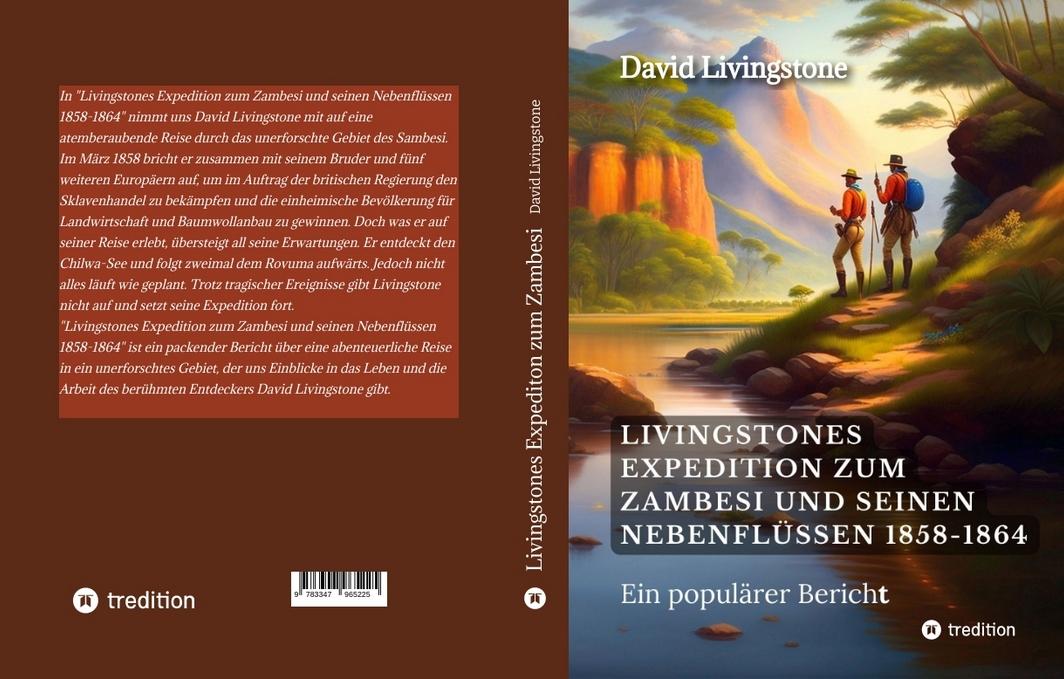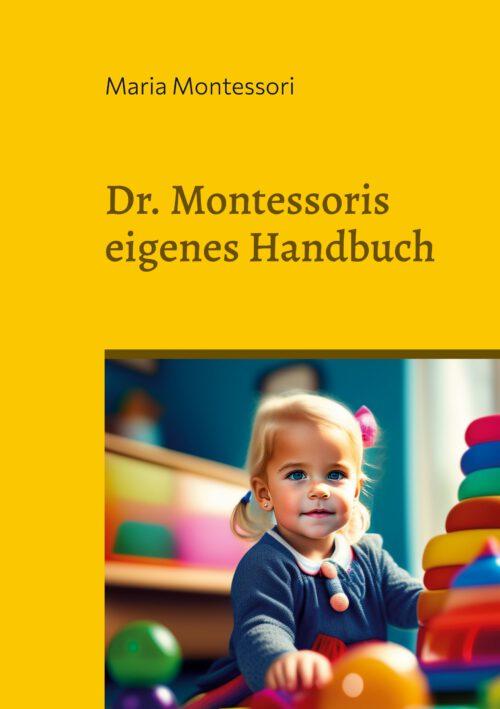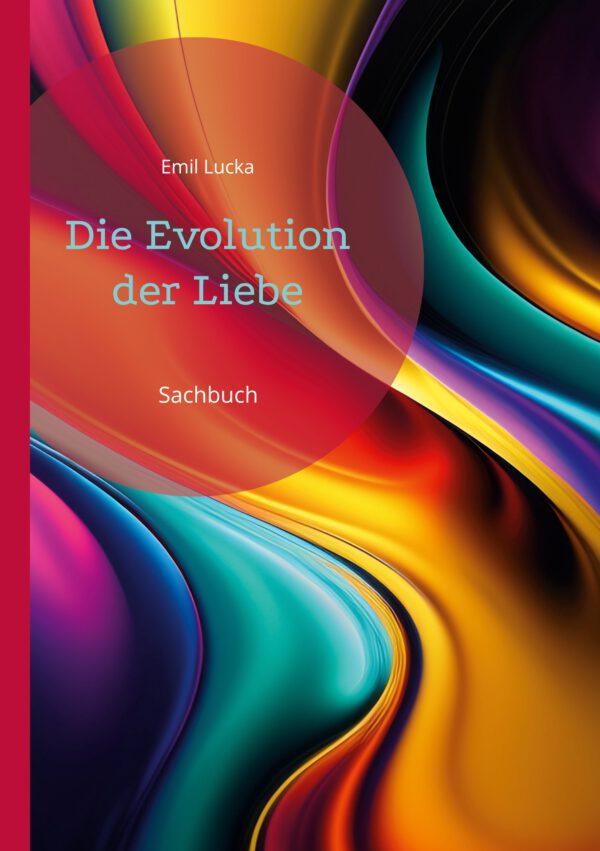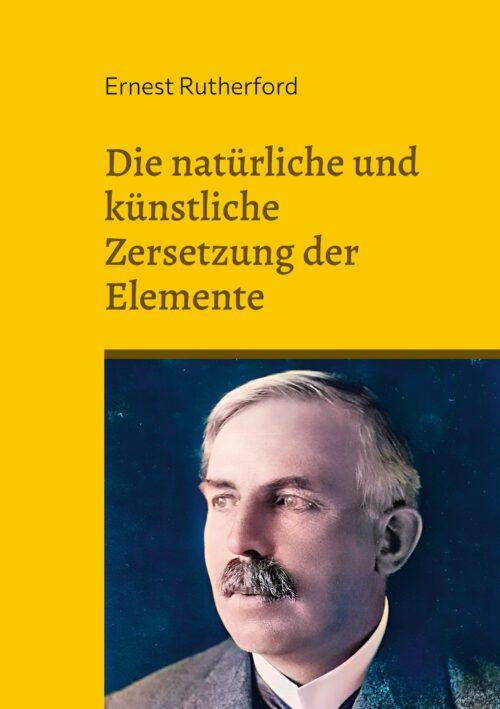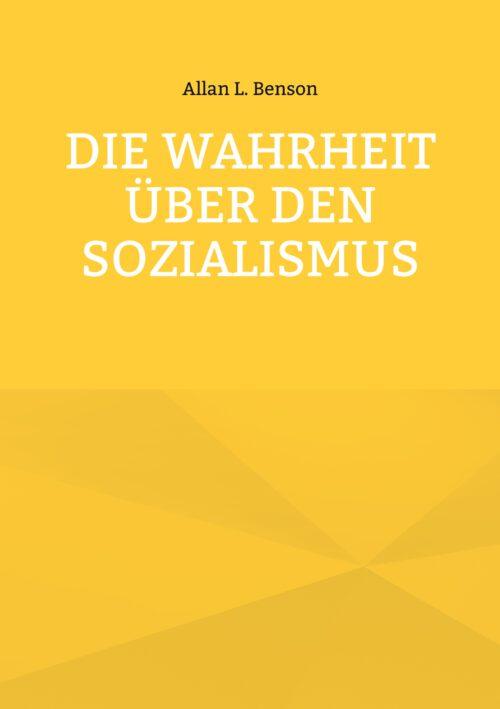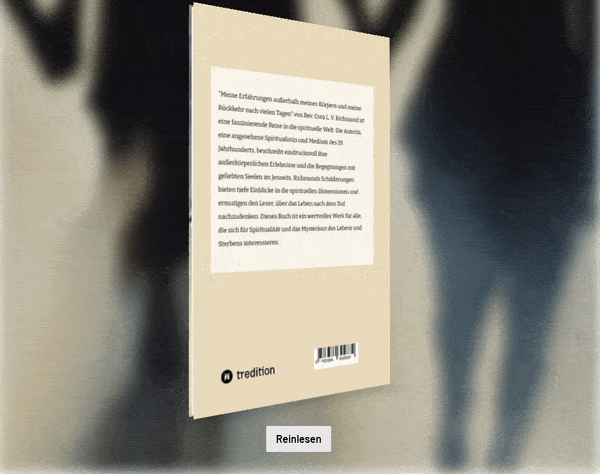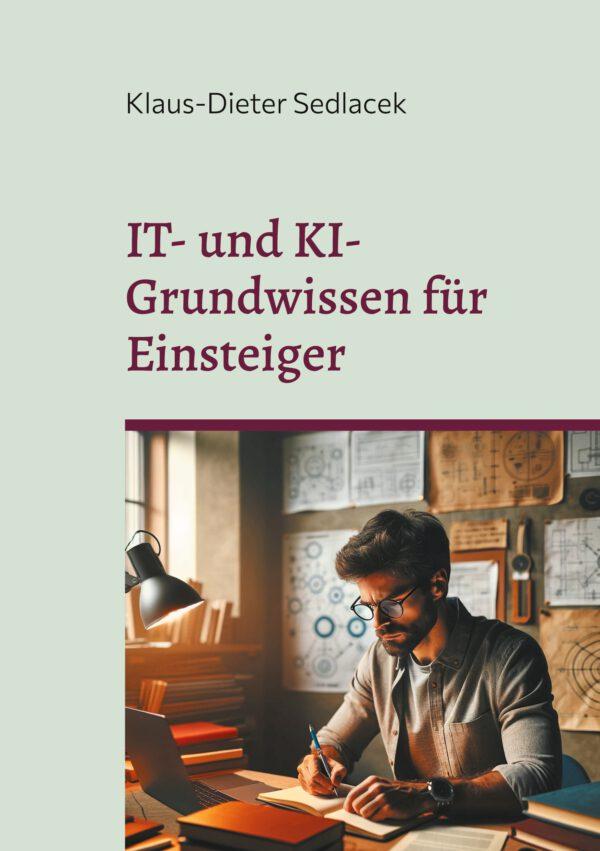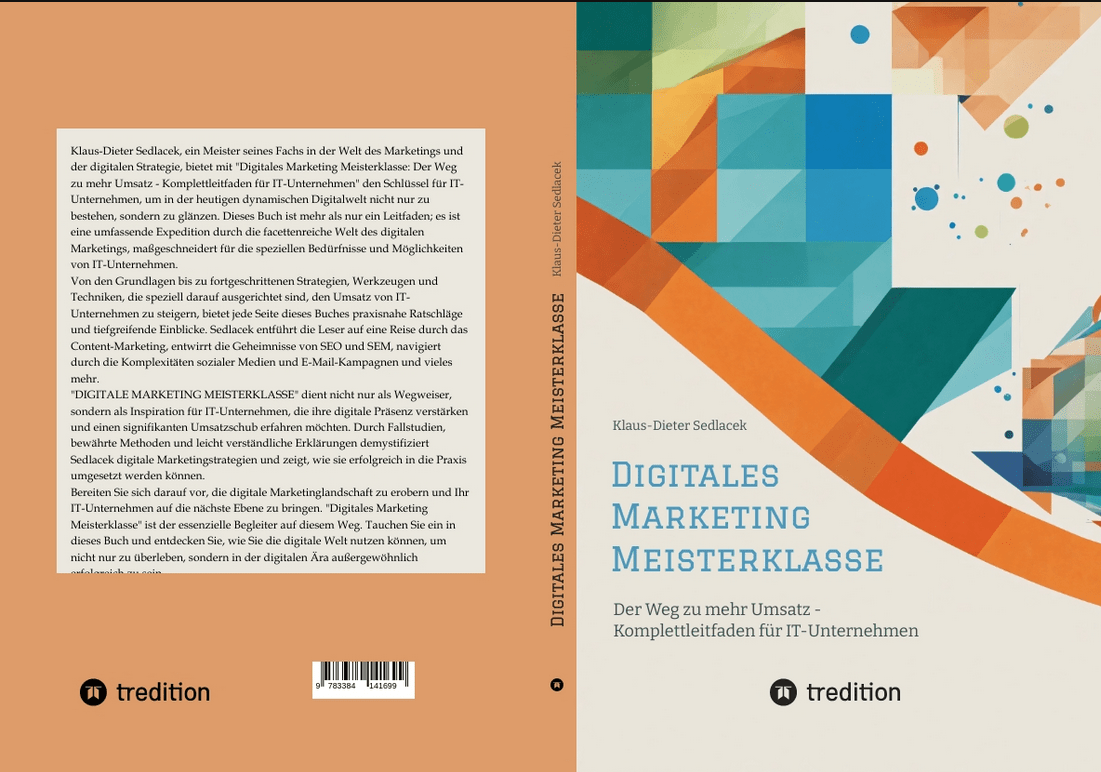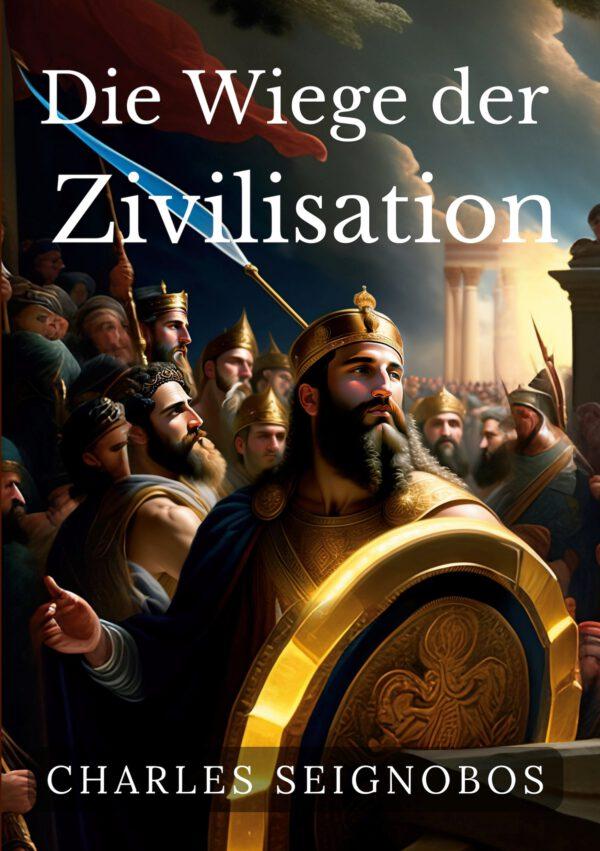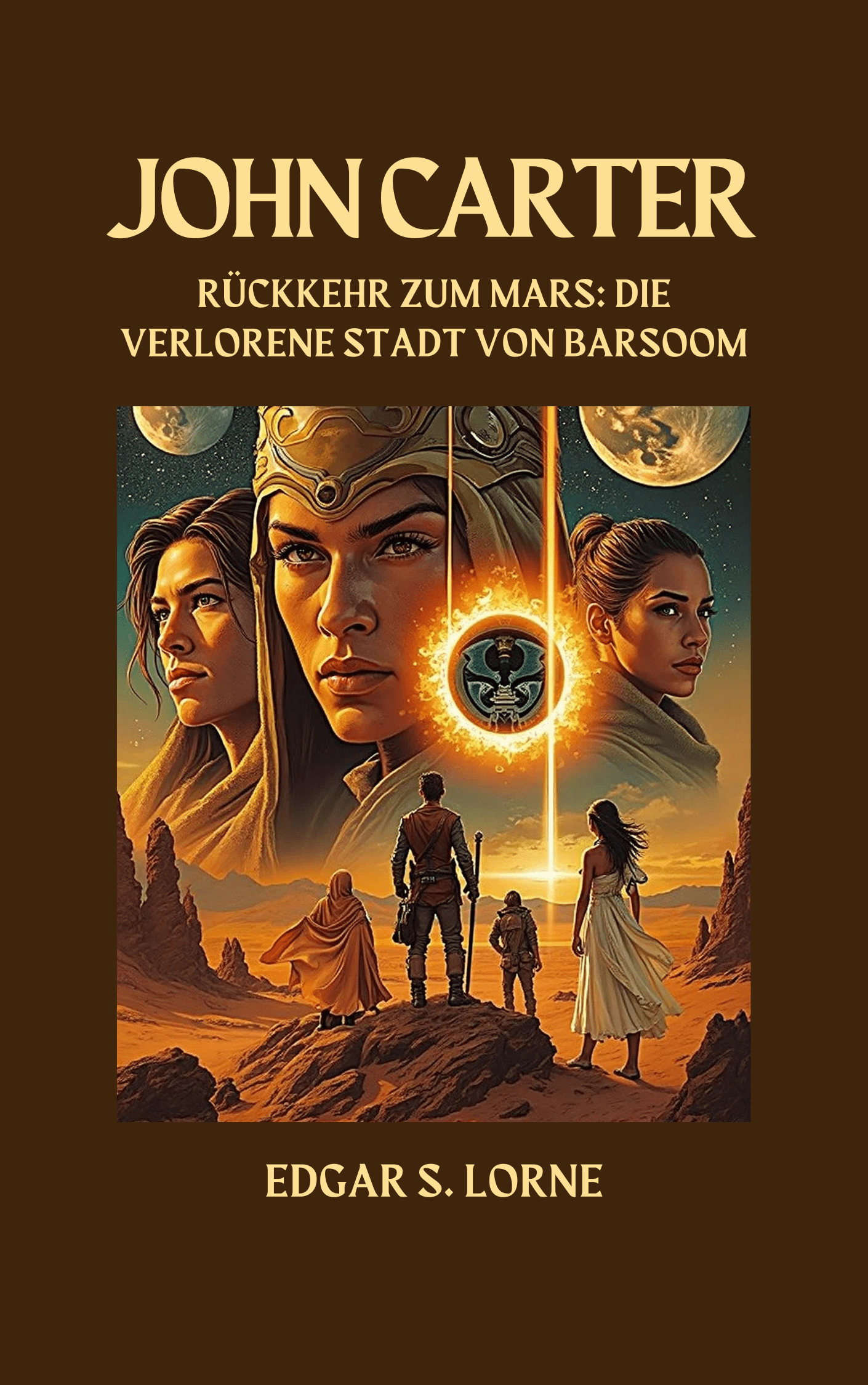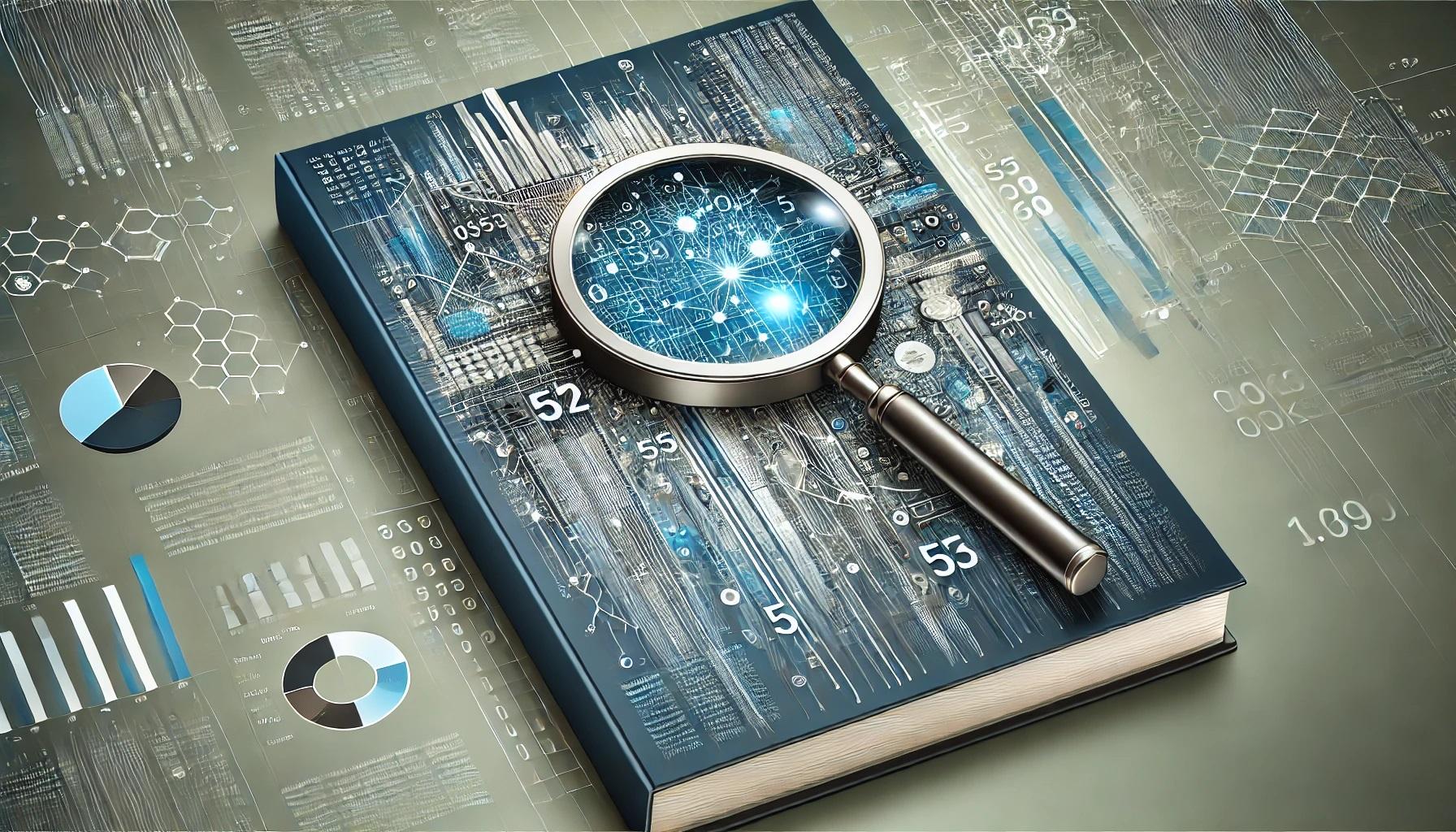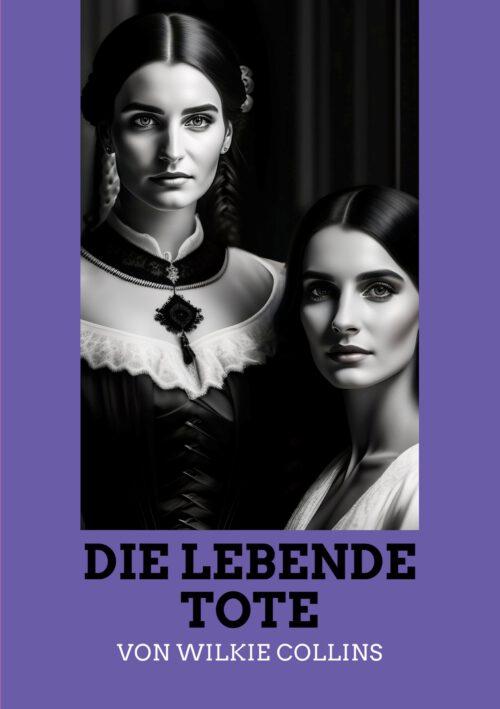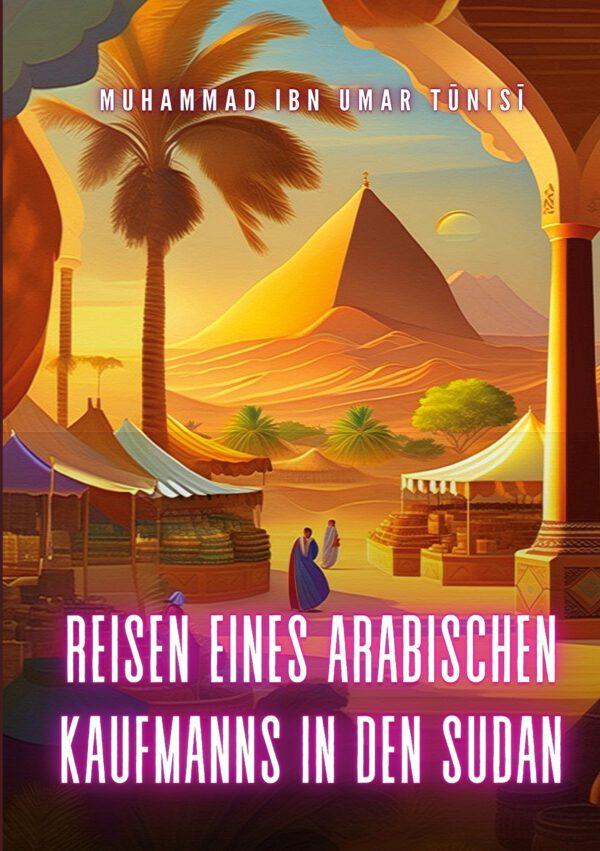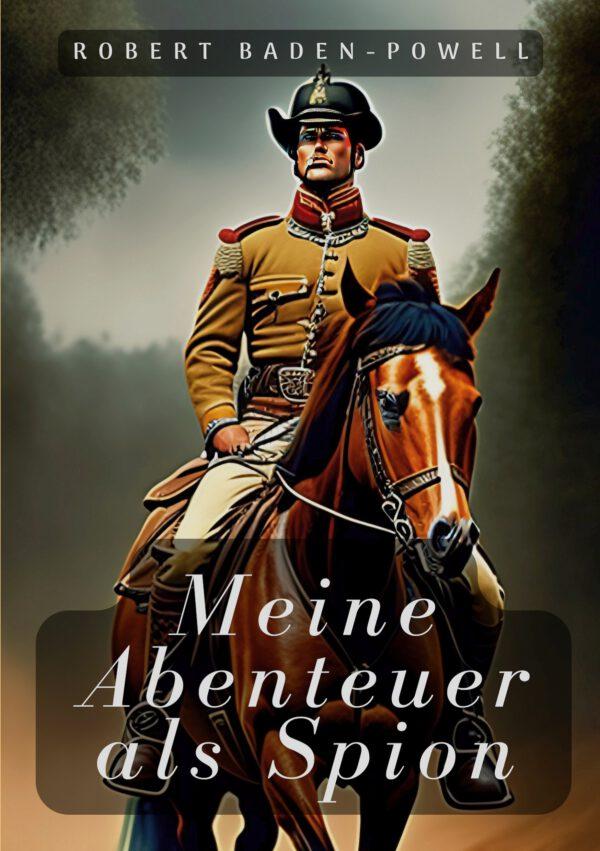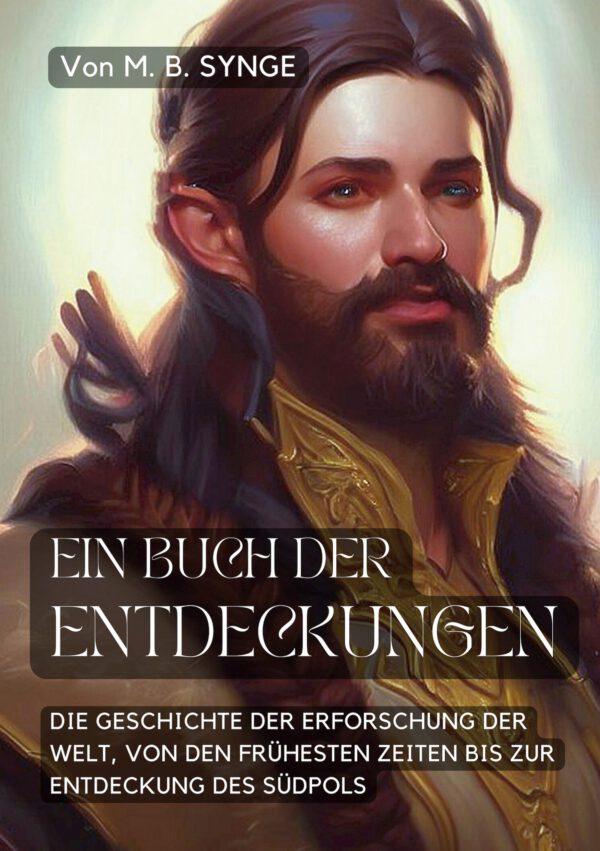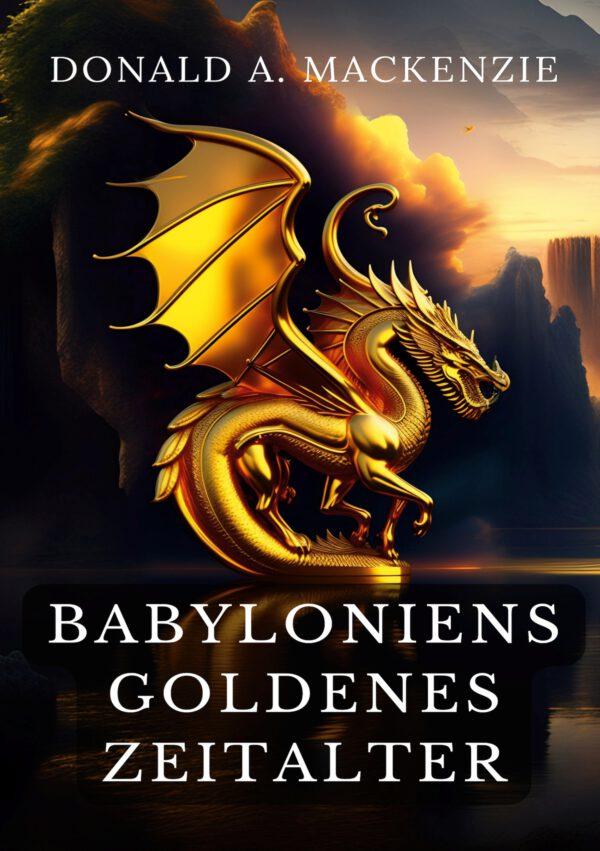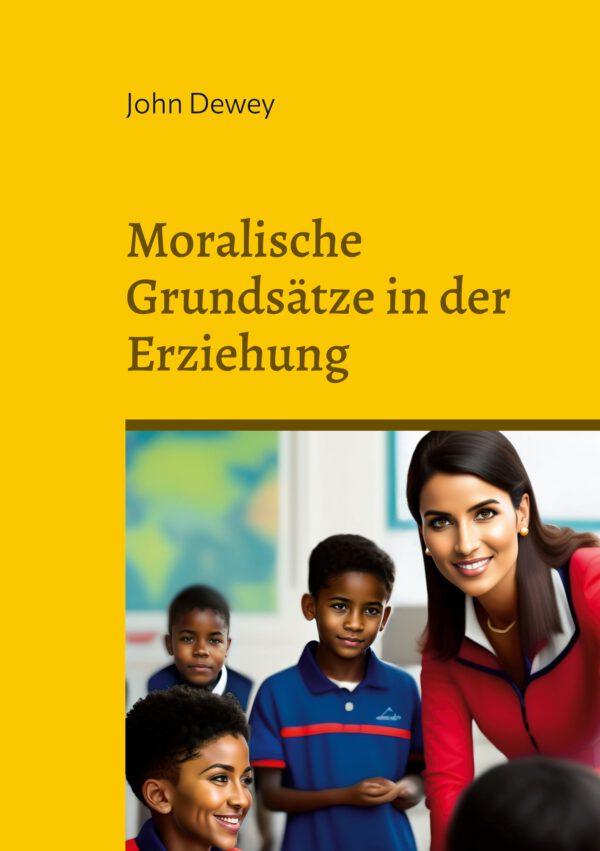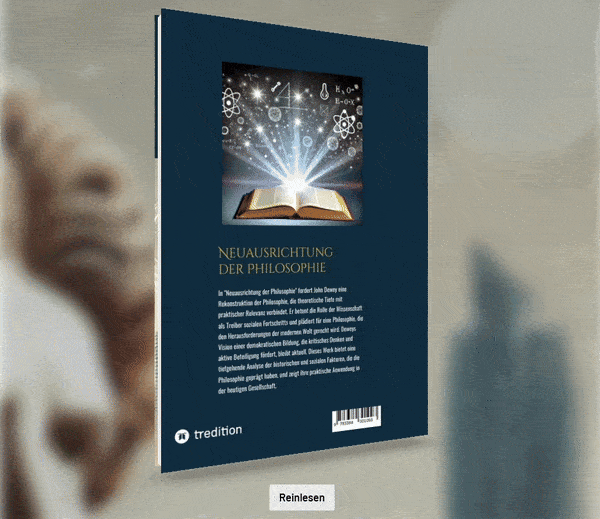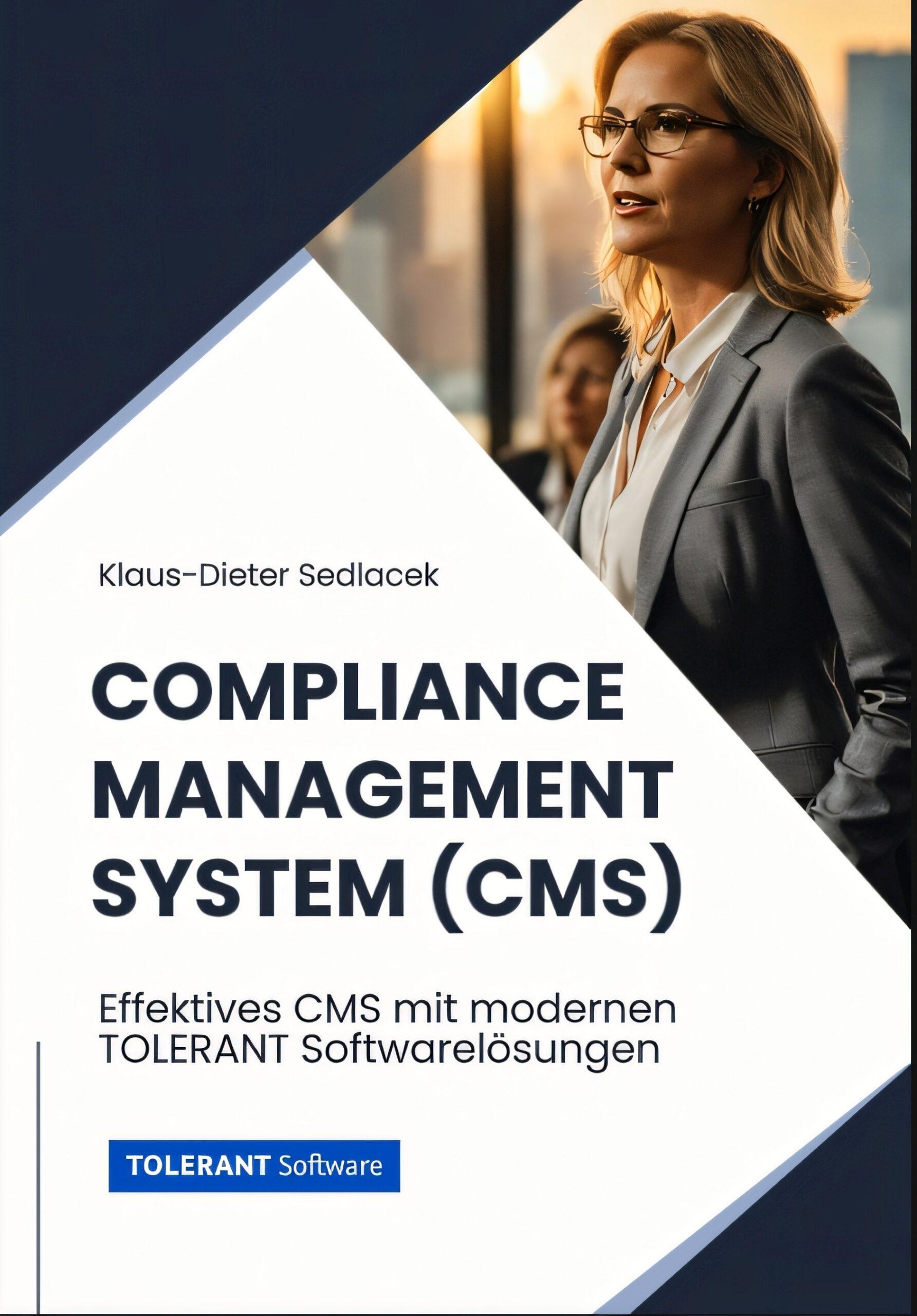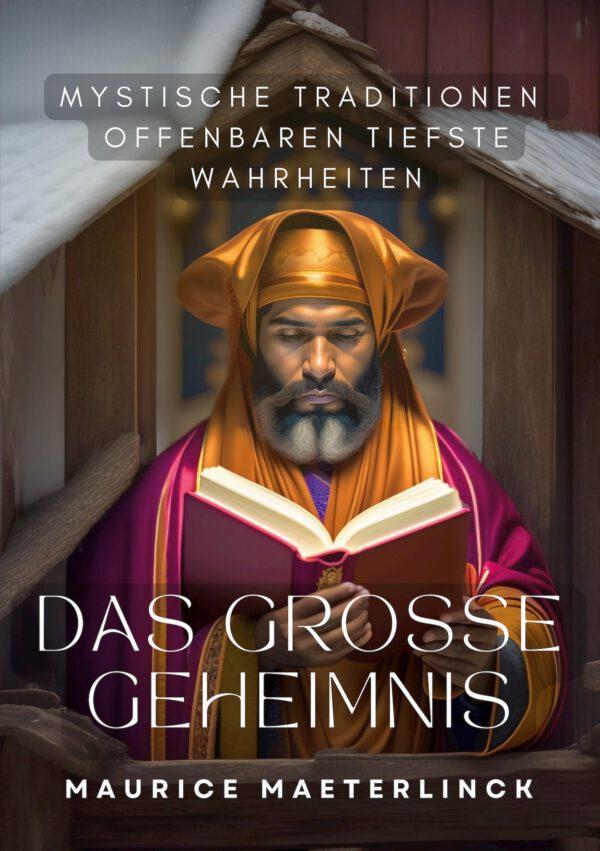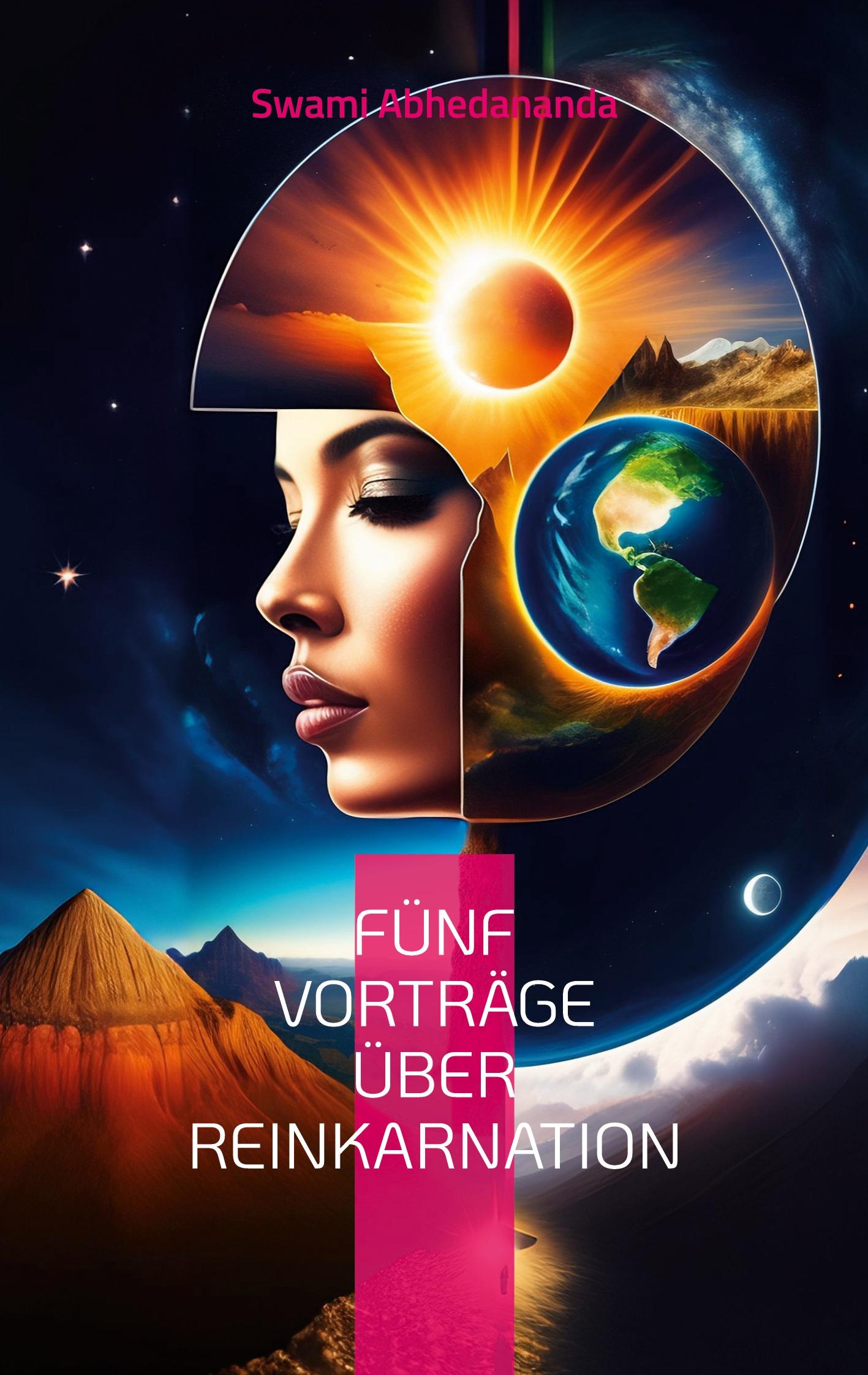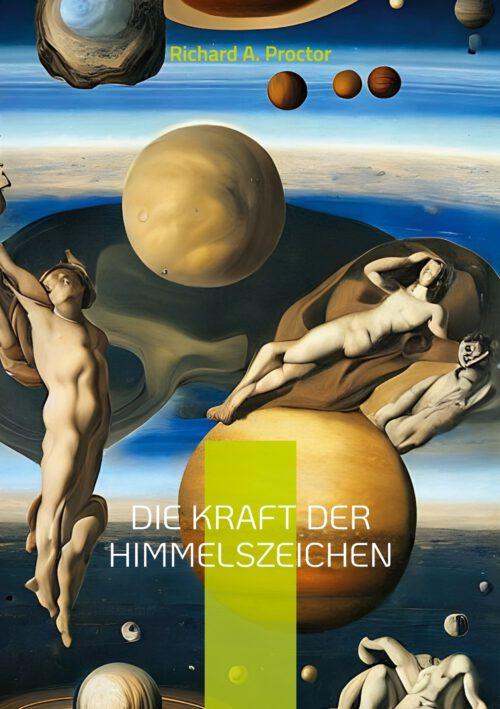In Deutschland ist eine lebhafte Diskussion über das sogenannte „Genderverbot“ entbrannt, das von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ins Leben gerufen wurde. Dieses Verbot zielt darauf ab, die Verwendung geschlechtergerechter Sprache in offiziellen Dokumenten und in der öffentlichen Kommunikation einzuschränken. Die Kontroversen um dieses Thema spiegeln die tiefen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wider, die sich um Geschlechteridentität und die Rolle der Sprache in der Gleichstellung der Geschlechter ranken.
Laura Neuhaus, die Chefredakteurin der Duden-Redaktion, äußerte sich in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zu diesem wichtigen Thema. Sie betont, dass es nicht ausreichend sei, das Gendern auf die Verwendung von Sonderzeichen zu reduzieren, wie es viele Kritiker des Genderns oft tun. Ihrer Ansicht nach ist die Frage der geschlechtergerechten Sprache vielschichtiger und erfordert ein umfassenderes Verständnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen Sprache wirkt.
Das Gendern, also die bewusste Berücksichtigung von Geschlechteridentitäten in der Sprache, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Es geht dabei nicht nur um die Verwendung von Formen wie „Student:innen“ oder „Lehrer*innen“, sondern auch um die grundlegende Frage, wie Sprache Geschlechterrollen reflektiert und formt. Neuhaus weist darauf hin, dass Sprache ein lebendiges und dynamisches System ist, das sich ständig weiterentwickelt. Daher sollte auch die Debatte um geschlechtergerechte Sprache nicht auf eine starre Regelung reduziert werden.
Die Diskussion um das Genderverbot ist auch eine Reaktion auf die zunehmende Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft. Immer mehr Menschen erkennen, dass die traditionelle Sprache oft nicht ausreichend ist, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten abzubilden. Dies führt zu einem Umdenken und zu einem stärkeren Bewusstsein für die Bedeutung von Sprache als Werkzeug zur Förderung der Gleichstellung.
Kritiker des Genderns argumentieren häufig, dass geschlechtergerechte Sprache umständlich und unverständlich sei. Sie befürchten, dass die Einführung von Sonderzeichen oder neuen Wortformen die Klarheit der Kommunikation beeinträchtigen könnte. Neuhaus widerspricht diesem Argument und legt dar, dass die Verständlichkeit der Sprache nicht zwangsläufig unter geschlechtergerechten Formen leiden muss. Vielmehr könne eine bewusste und durchdachte Verwendung geschlechtergerechter Sprache zur Förderung eines respektvollen und inklusiven Miteinanders beitragen.
Ein weiterer Aspekt der Debatte ist die Rolle von Institutionen und Bildungseinrichtungen. Diese spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie Sprache in der Gesellschaft vermittelt wird und welche Normen sich etablieren. Neuhaus hebt hervor, dass Schulen und Universitäten dazu beitragen sollten, ein Bewusstsein für geschlechtergerechte Sprache zu schaffen und deren Verwendung zu fördern. Dies könnte dazu führen, dass zukünftige Generationen mit einem anderen Verständnis von Sprache und Geschlecht aufwachsen.
Insgesamt zeigt die Diskussion um das Genderverbot und die geschlechtergerechte Sprache, wie komplex und vielschichtig das Thema ist. Es geht nicht nur um sprachliche Formen, sondern auch um tiefere gesellschaftliche Fragestellungen. Die Art und Weise, wie wir sprechen, beeinflusst unsere Wahrnehmung von Geschlecht und Identität. In Anbetracht dieser Tatsache ist es wichtig, dass die Debatte offen und respektvoll geführt wird, um Raum für verschiedene Meinungen und Perspektiven zu schaffen.
Laura Neuhaus‘ Appell, das Gendern nicht auf Sonderzeichen zu reduzieren, ist ein wichtiger Beitrag zu dieser Diskussion. Es ist entscheidend, dass wir die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten in unserer Sprache widerspiegeln und dadurch zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen. Die Herausforderungen, die mit der Umsetzung geschlechtergerechter Sprache verbunden sind, sollten nicht als Hindernisse betrachtet werden, sondern als Chancen, die gesellschaftliche Kommunikation zu bereichern und eine inklusive Kultur zu fördern.