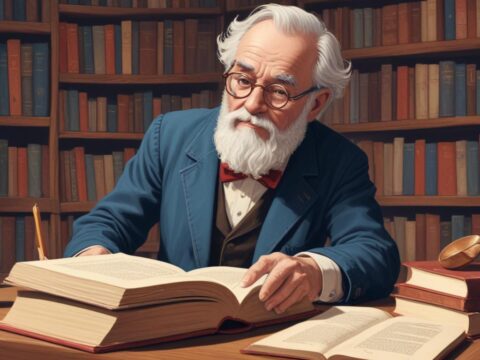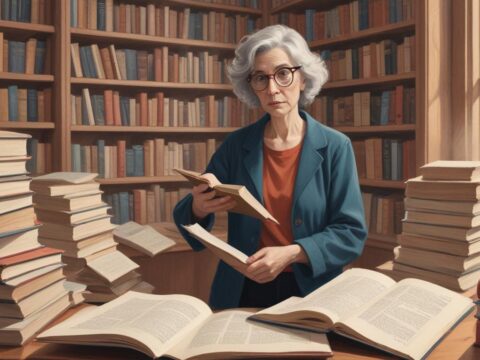Sebastian Susteck hat sich in seiner neuesten Veröffentlichung mit dem Werk des Schriftstellers und Journalisten Heinrich Hauser, der von 1901 bis 1955 lebte, auseinandergesetzt. Hauser gilt als einer der bedeutendsten Reporter der späten Weimarer Republik und hat ein umfangreiches literarisches Schaffen hinterlassen. Sustecks Studie konzentriert sich auf die Jahre 1925 bis 1934 und bietet eine alphabetische Anamnese von Hausers Arbeiten, die sowohl Reportagen als auch Romane umfasst.
Hauser ist vor allem für seine eindrucksvollen Reportagen bekannt, darunter „Schwarzes Revier“ über das Ruhrgebiet und „Feldwege nach Chicago“, die beide zu den wichtigsten Texten ihres Genres zählen. Darüber hinaus verfasste er die Reportage „Die letzten Segelschiffe“, die von seiner Reise mit der Pamir handelt, und die Ostreußenreportage „Wetter in Osten“. In den Jahren 1930 bis 1933 veröffentlichte er eine Vielzahl von Reportagen, ergänzt durch seine Romane „Donner überm Meer“ (1929) und „Noch nicht“ (1932). Während seiner journalistischen Laufbahn arbeitete Hauser für die Frankfurter Zeitung, ein renommiertes liberales Blatt der Weimarer Republik, und wurde von einem der bedeutendsten Verlage dieser Zeit, dem S. Fischer Verlag, unterstützt. Seine außergewöhnliche literarische Stellung wird auch durch die Zusammenarbeit mit Verlagen wie Reclam und Diederichs unterstrichen.
Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit war Hauser ein versierter Fotograf, der vom Neuen Sehen beeinflusst war, und produzierte sogar einen Film über seine Pamirreise. In den frühen 1930er Jahren war Hauser ein vielversprechender Autor, dessen Werke großes Potenzial zeigten. Doch mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus driftete er zunehmend nach rechts. Seine Ostreußenreportage wies bereits auf eine Nähe zum nationalen Lager hin, während seine Widmung für Hermann Göring in „Ein Mann lernt fliegen“ eine provokante Geste gegenüber seinem Verlag darstellte. Der Roman „Kampf“ von 1934 verdeutlichte dann unmissverständlich seine politische Ausrichtung.
In den folgenden Jahren verlor Hauser jedoch an Einfluss innerhalb der literarischen Szene. Seine Karriere nahm einen Niedergang, als er sich als Auftragsautor für Unternehmen wie Opel verdingte und schließlich Deutschland in Richtung Kanada und die USA verließ. In seinen frühen Reportagen offenbarte Hauser eine innerliche Zerrissenheit zwischen der modernen Welt und einer nostalgischen Vorstellung einer idealisierten Vergangenheit. Er fühlte sich von der bürgerlichen Eintönigkeit abgestoßen und suchte nach Abenteuern und der Dynamik unsicherer Zeiten. Gleichzeitig hegte er eine Sehnsucht nach einer Welt, in der traditionelle Rollenbilder noch Gültigkeit hatten. Hauser war von der Unmittelbarkeit und der Rohheit vor-zivilisatorischer Verhältnisse fasziniert, konnte diese jedoch nicht lange ertragen.
Sebastian Sustecks Studie bietet einen differenzierten Blick auf Hausers literarisches Schaffen zwischen 1925 und 1934. Anstatt eine konsistente, linear strukturierte Analyse zu liefern, wählt Susteck einen alphabetischen Ansatz, der von „Agrikultur“ bis „Zukunft“ reicht. Dies ermöglicht es ihm, die ideologischen Ambivalenzen und Widersprüche in Hausers Werk zu beleuchten. Susteck verdeutlicht, dass bereits frühe Forschungsergebnisse, insbesondere von Helmut Lethen, Hauser dem sogenannten „Weißen Sozialismus“ zuordneten, was auf die präfaschistische Neuen Sachlichkeit hinweist. Die Schriften Hausers erscheinen somit als ein vielschichtiger, aber auch hilfloser Gegenentwurf zum Werk von Egon Erwin Kisch, dessen Reisen Hauser publizistisch nachfolgte.
Durch die alphabetische Gliederung gelingt es Susteck, die thematischen Linien und Denkmuster Hausers nachzuvollziehen und aufzuzeigen, wie diese durch die jeweilige Fragestellung beeinflusst werden. Dabei bleibt er weitgehend von einer Diskussion der aktuellen Forschungsliteratur unberührt, bezieht jedoch zeitgenössische Denker wie Klages, Tönnies, Benjamin und Heidegger ein, um Hausers Gedankenwelt historisch einzuordnen. Dies erhöht den Wert von Sustecks Arbeit als Nachschlagewerk. Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob der multiple Ansatz nicht zu Redundanzen führt, da er oft zu ähnlichen Mustern gelangt.
Insgesamt zeigt Sustecks Arbeit auf, dass die Annäherung Ha