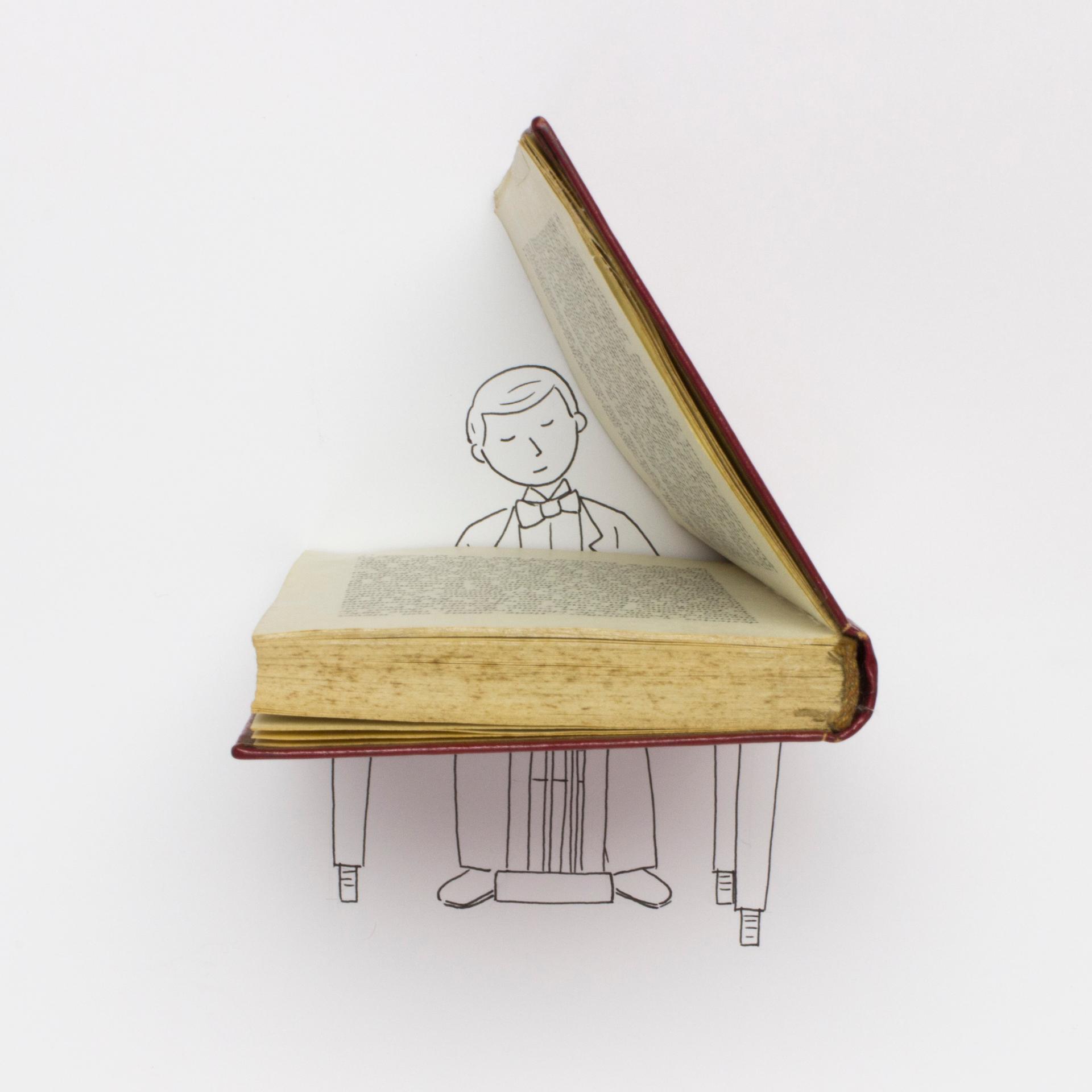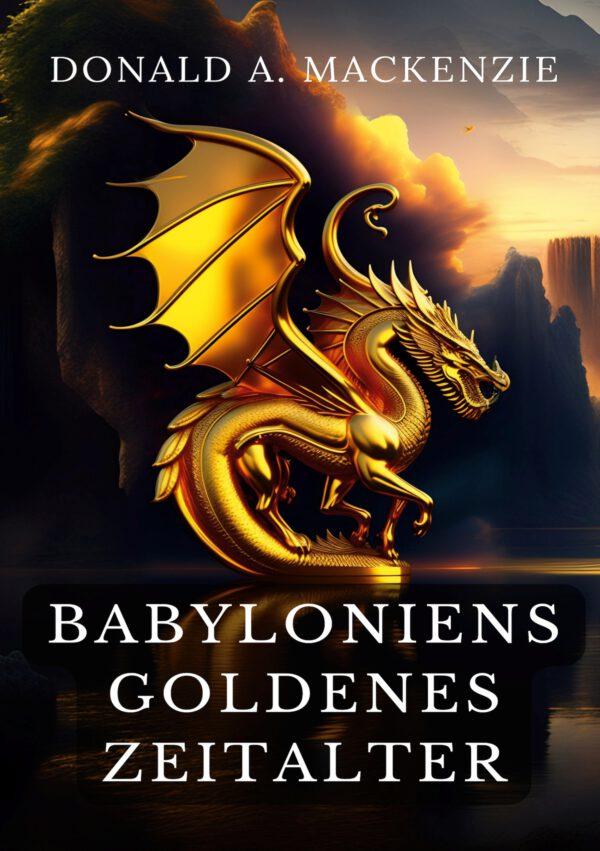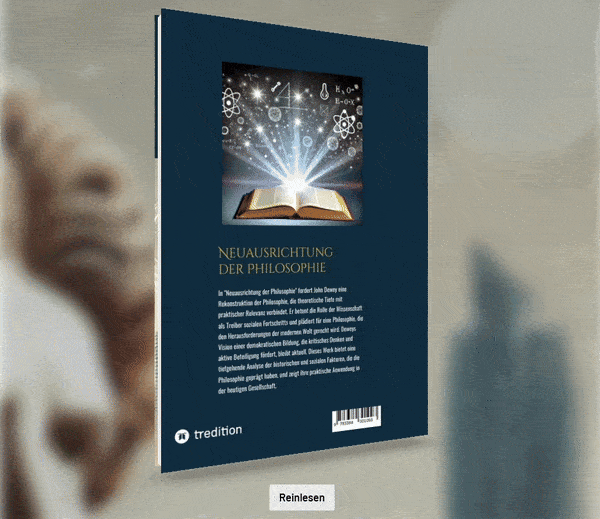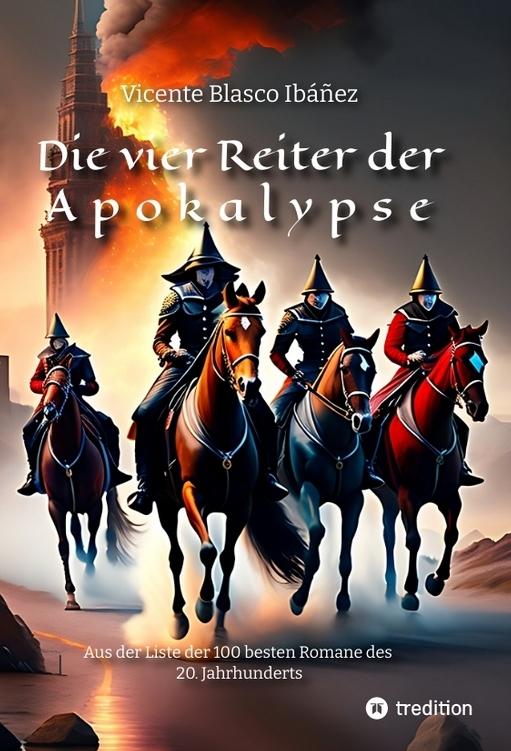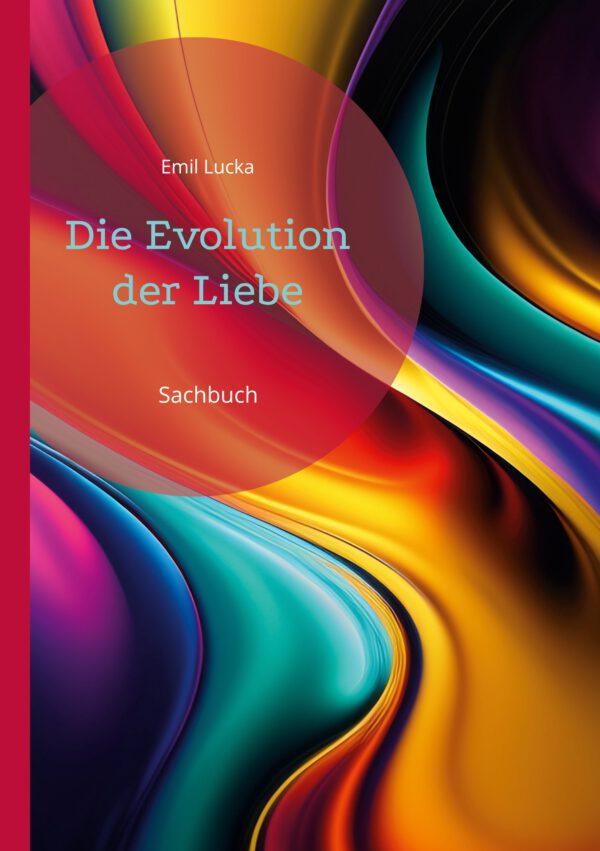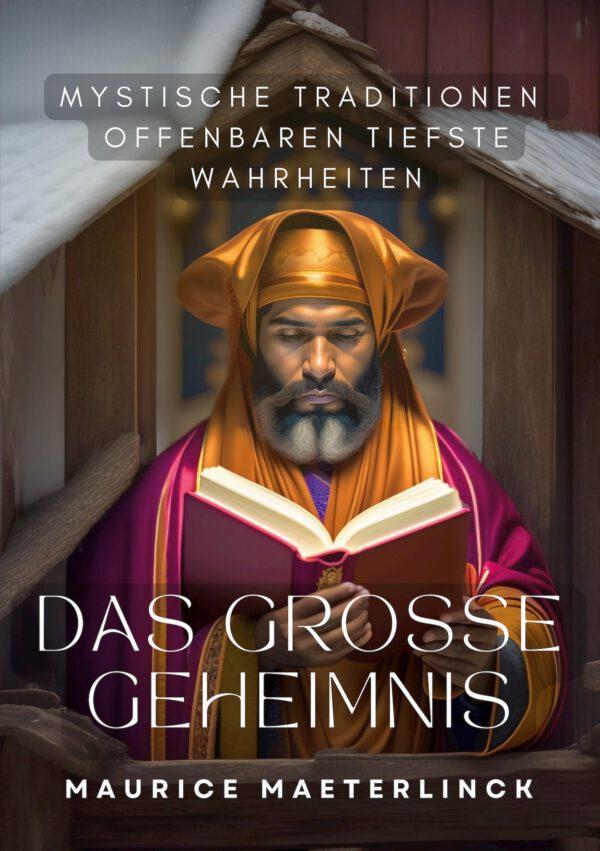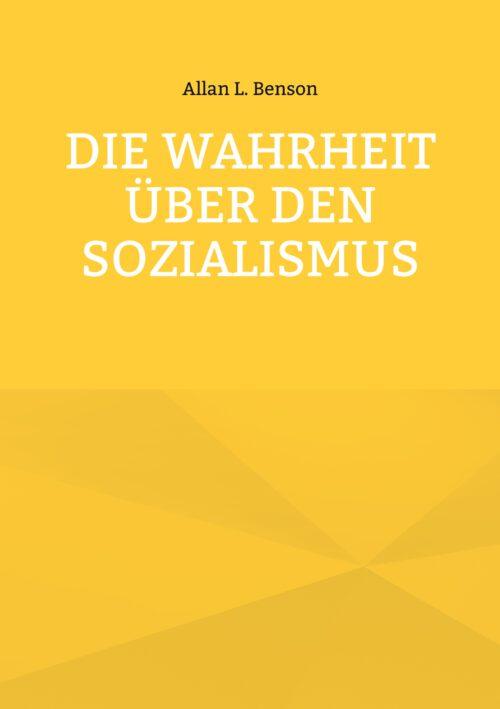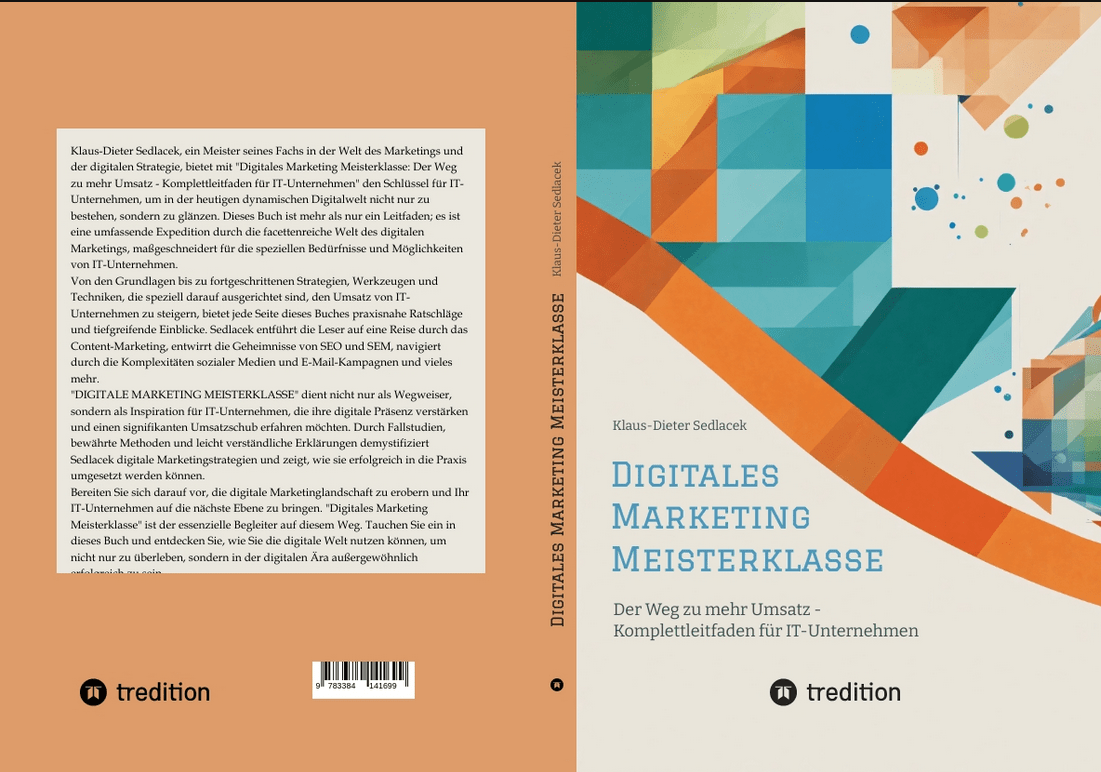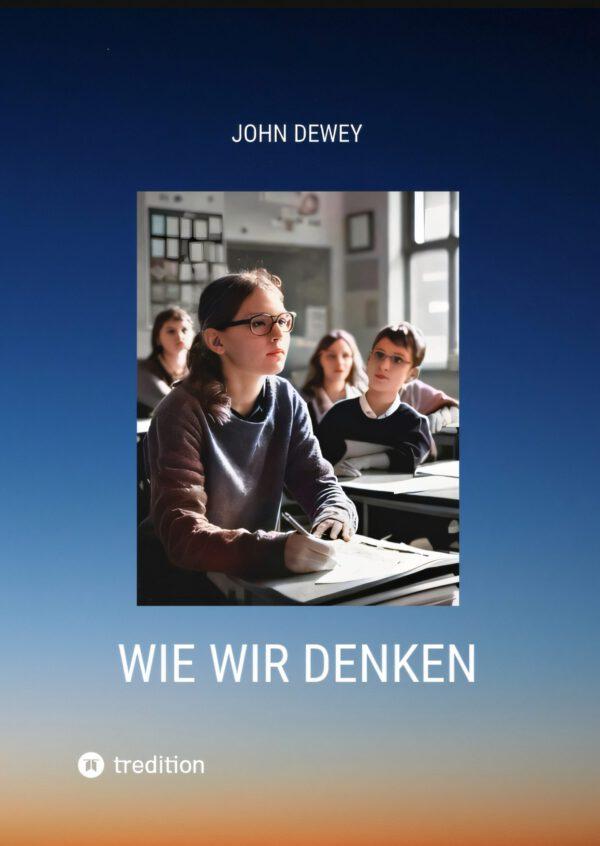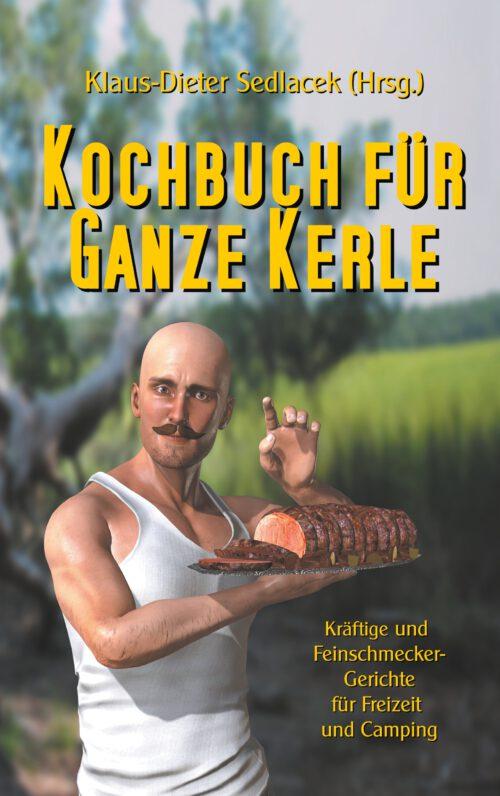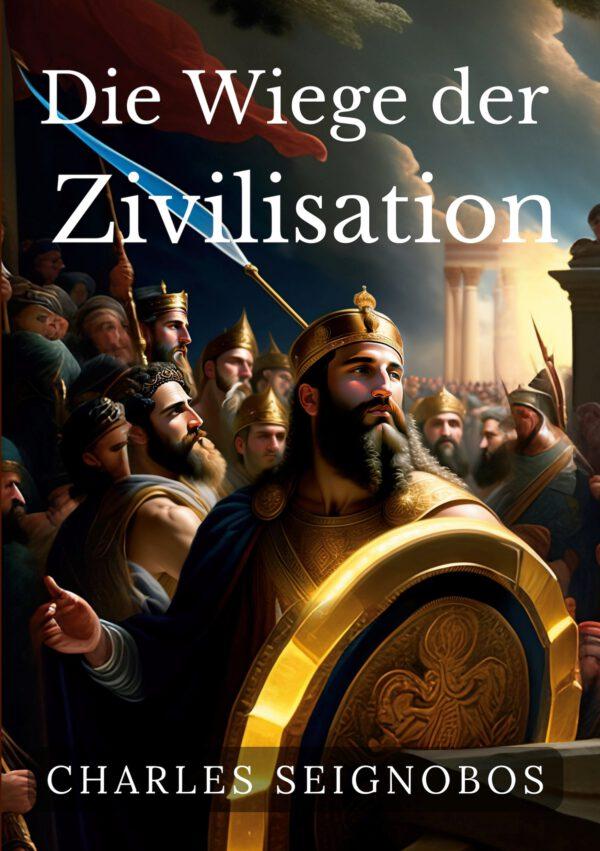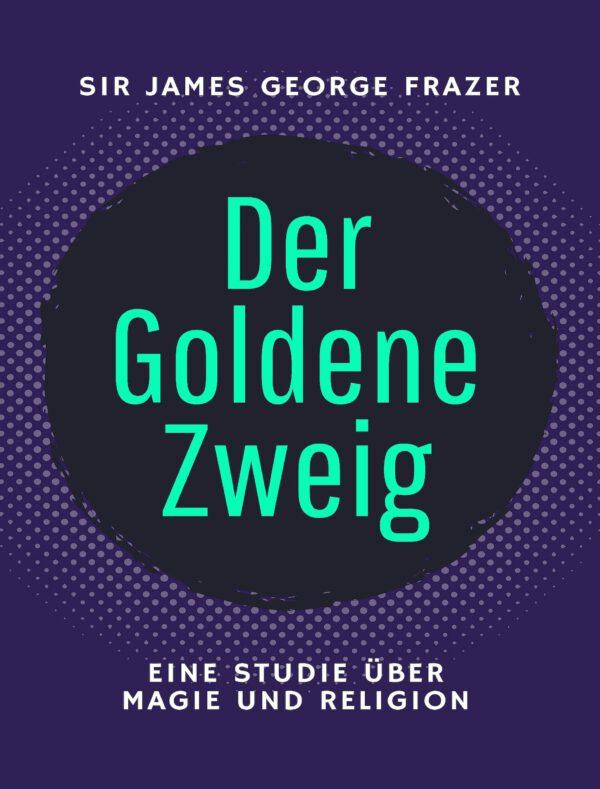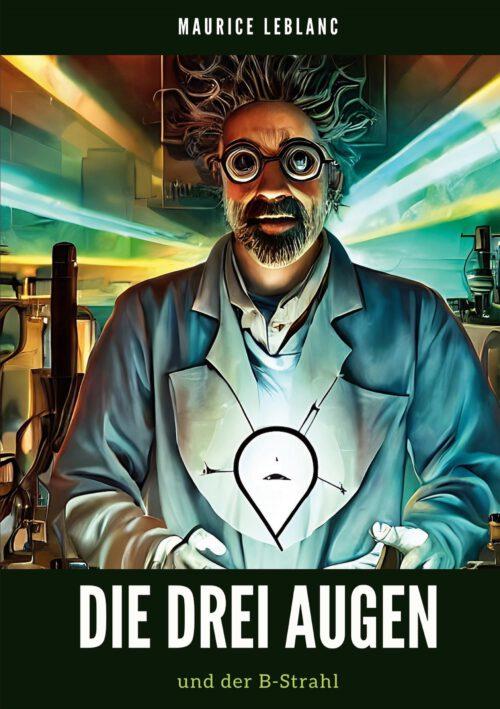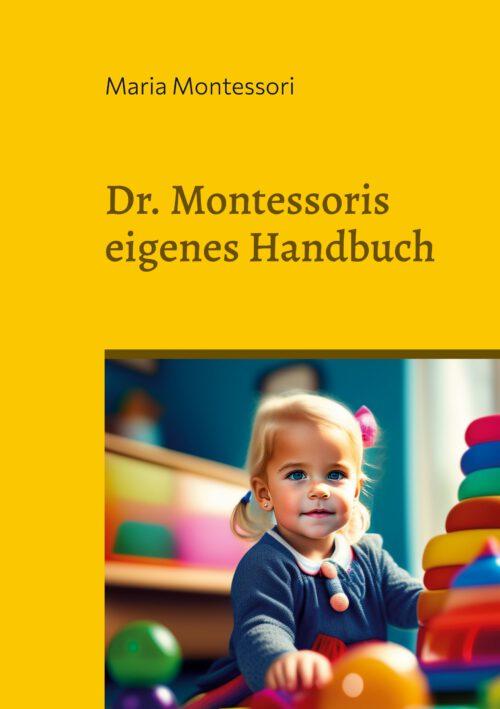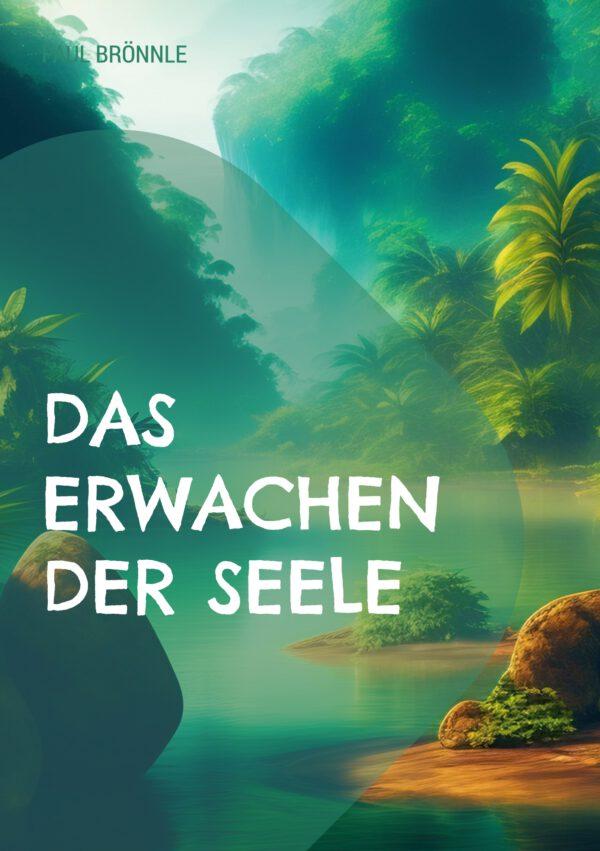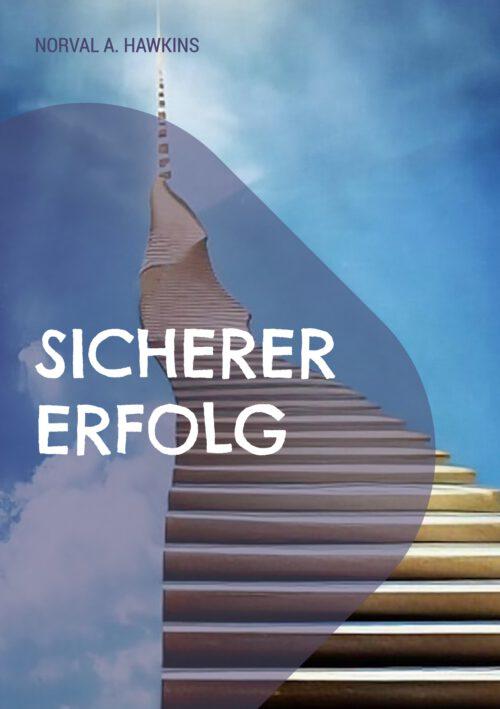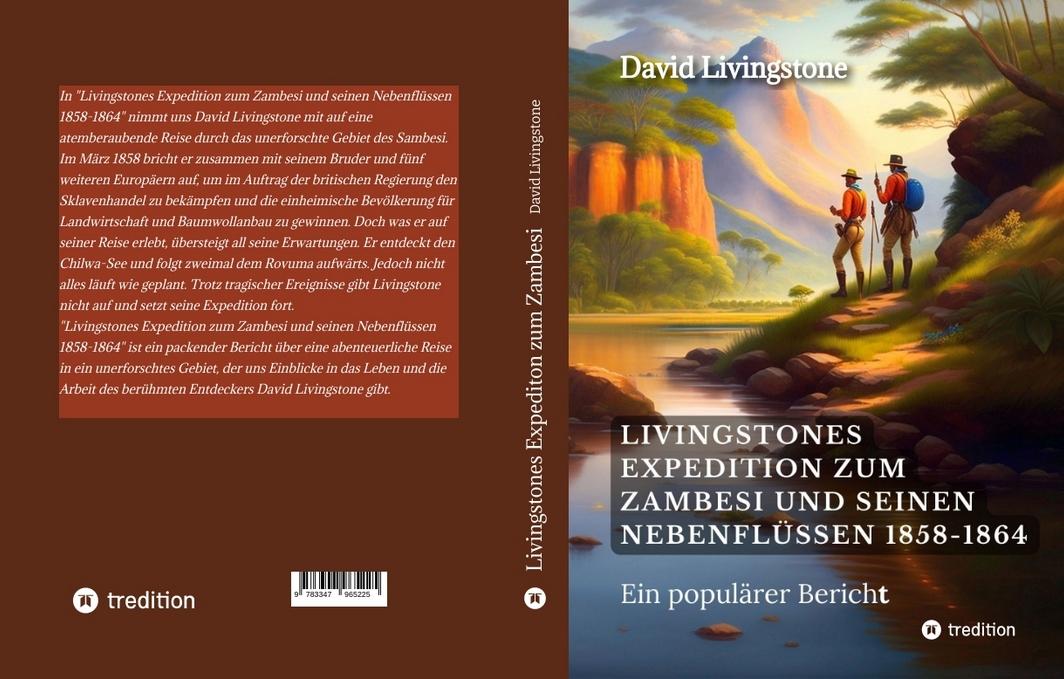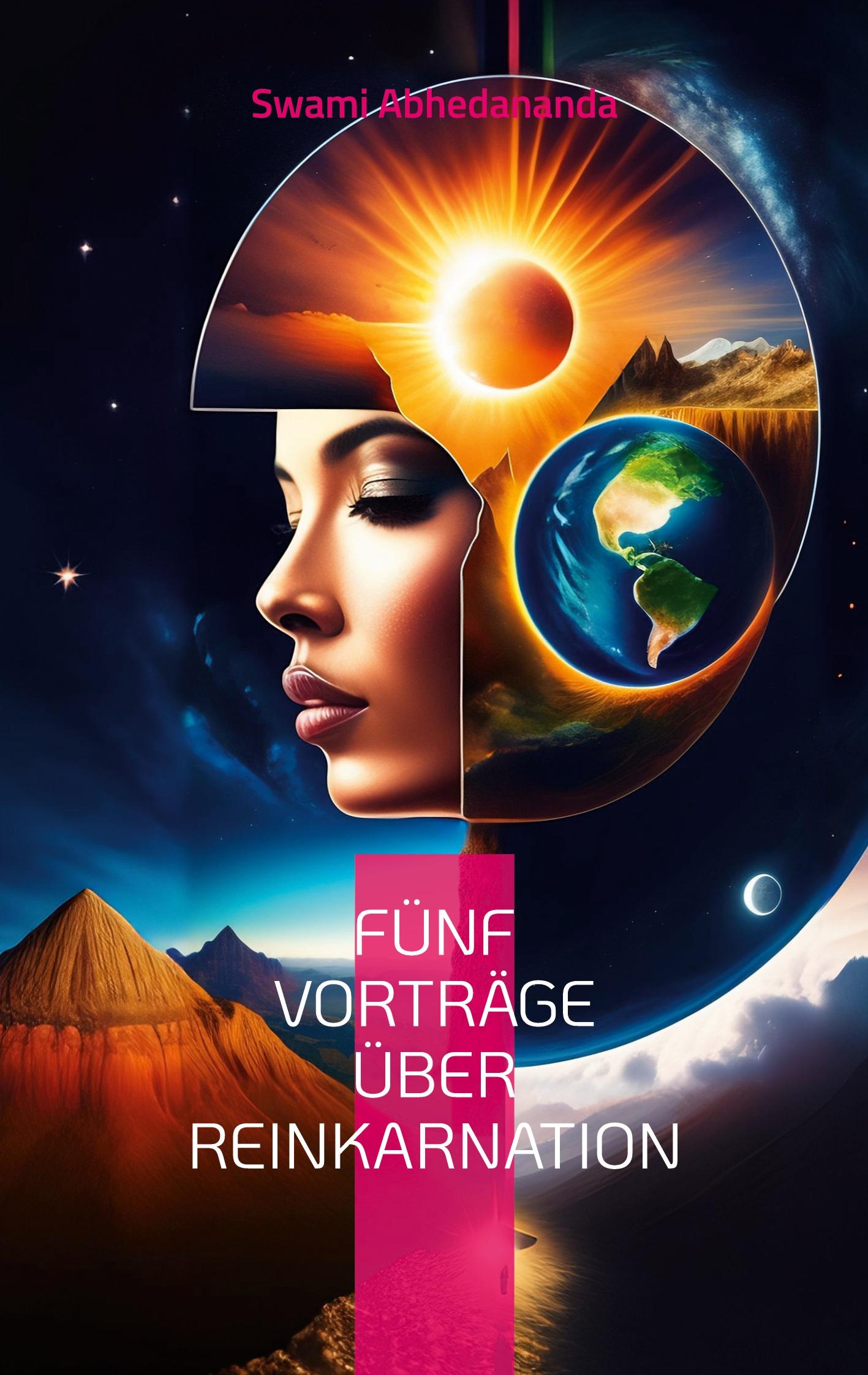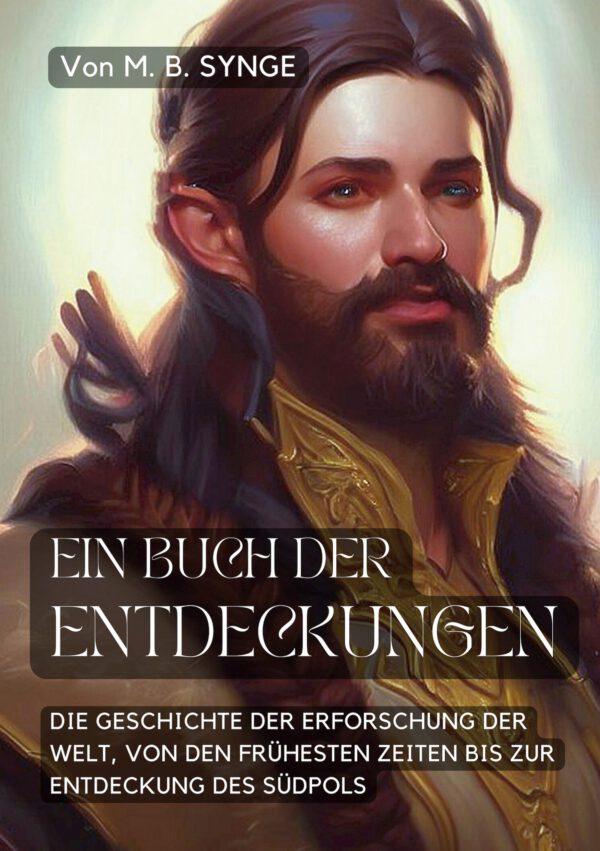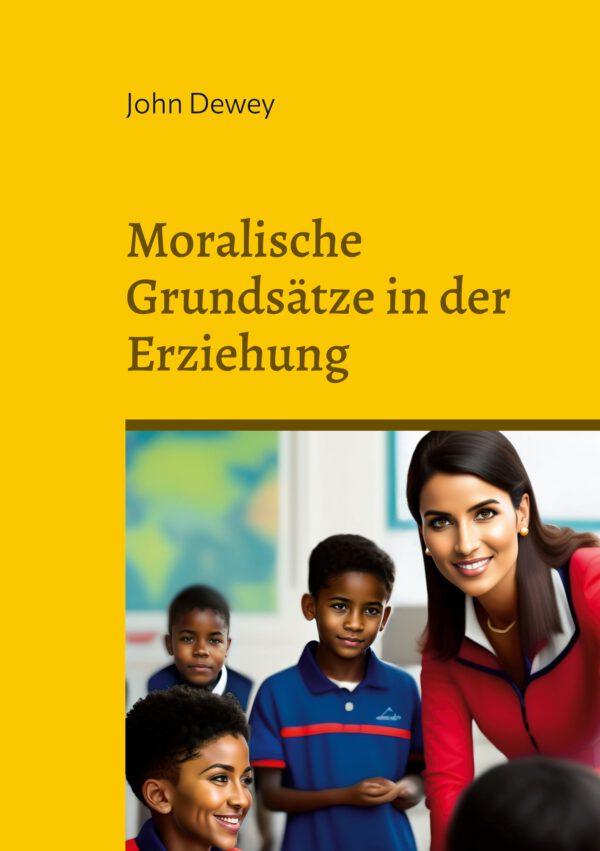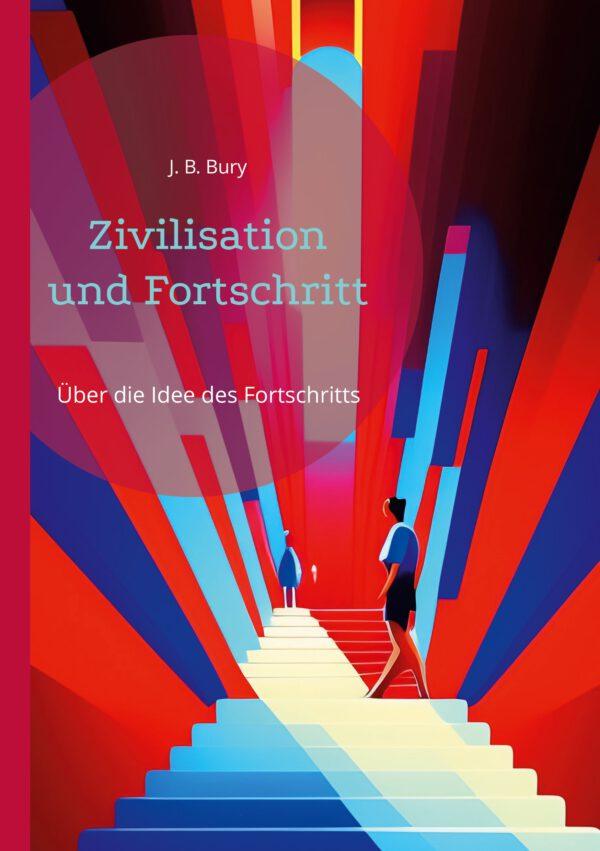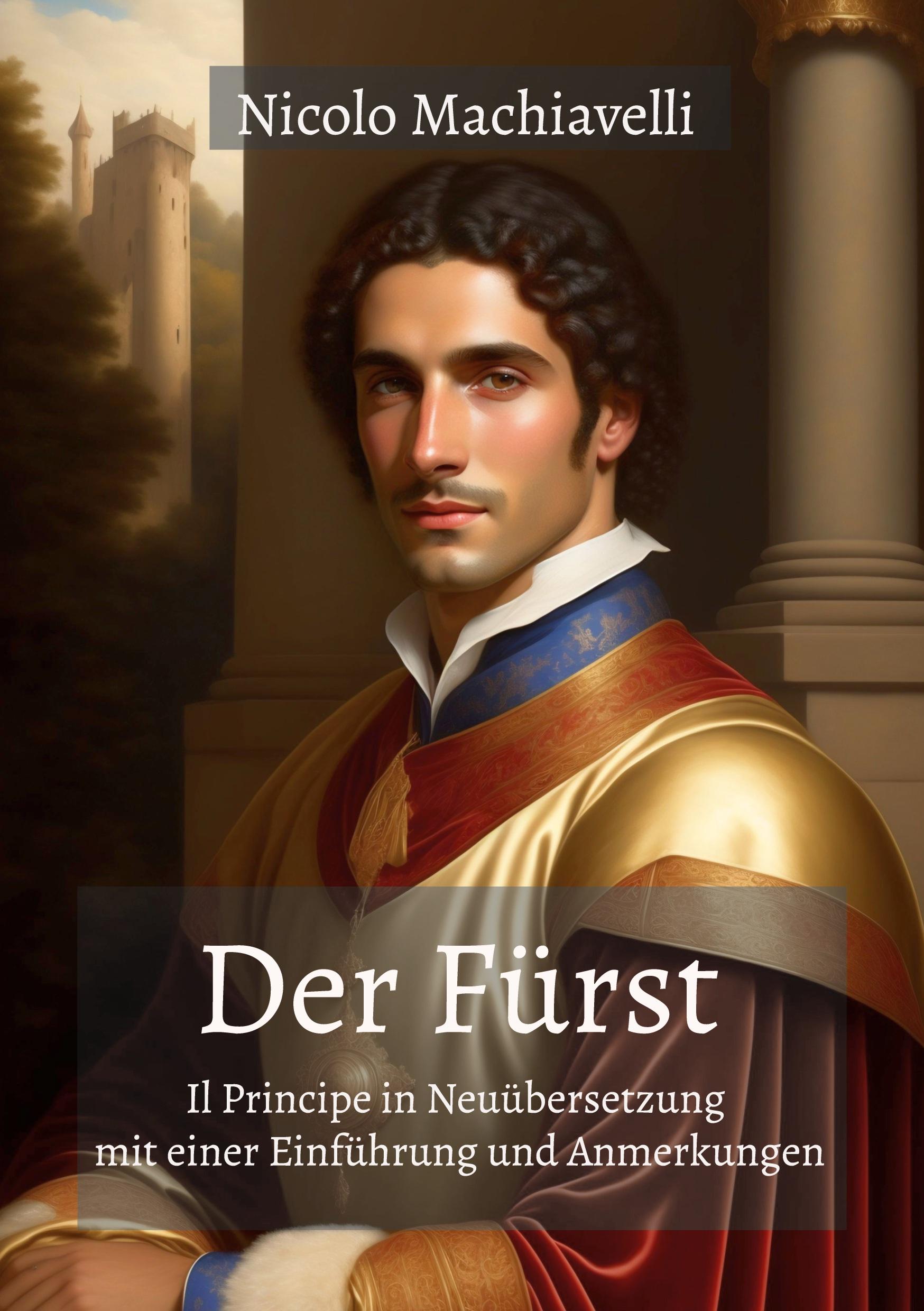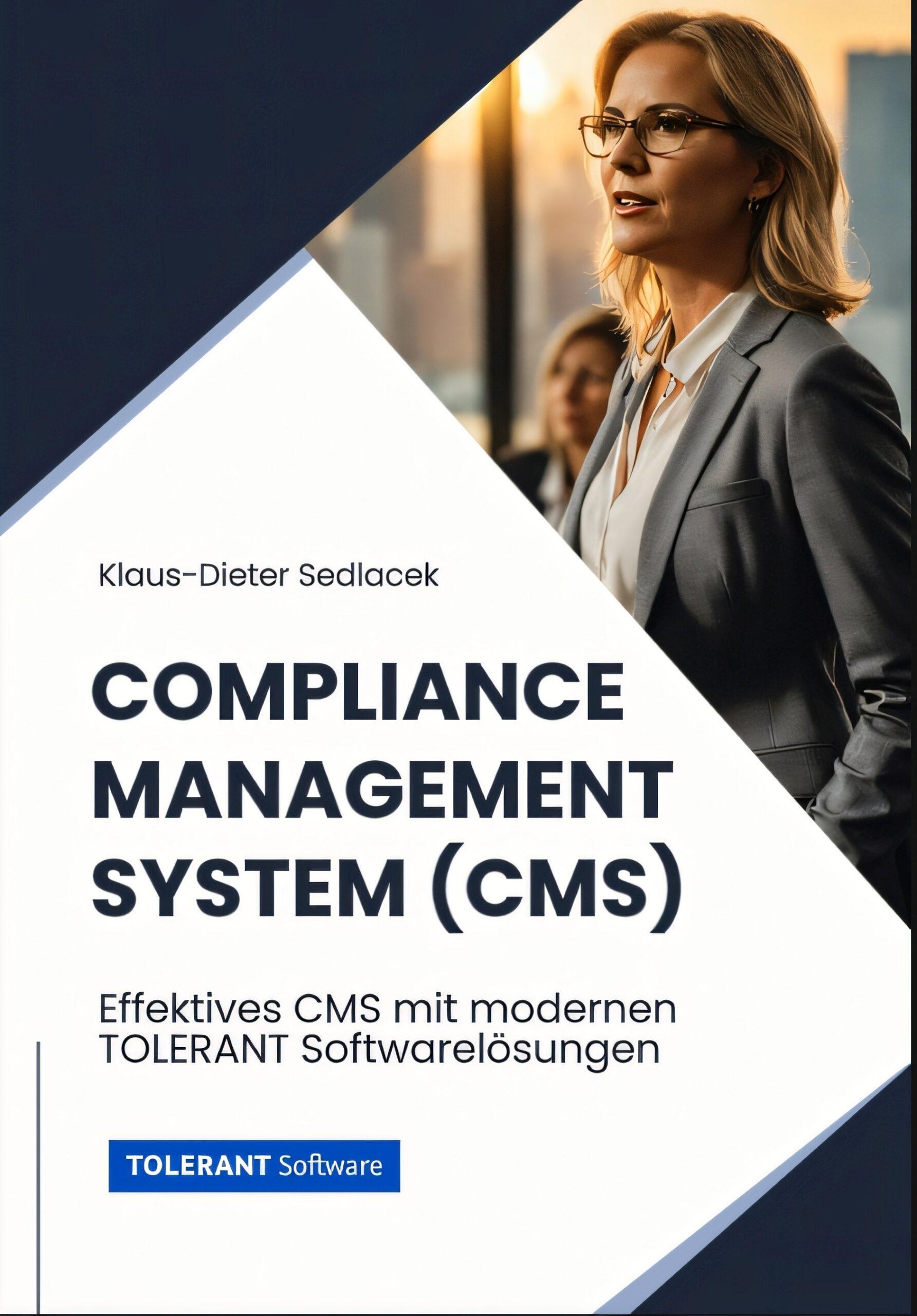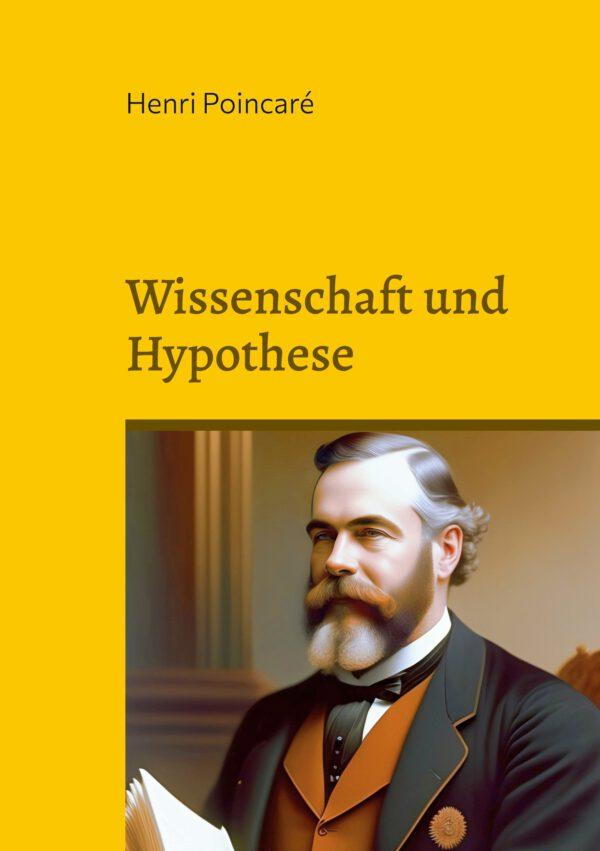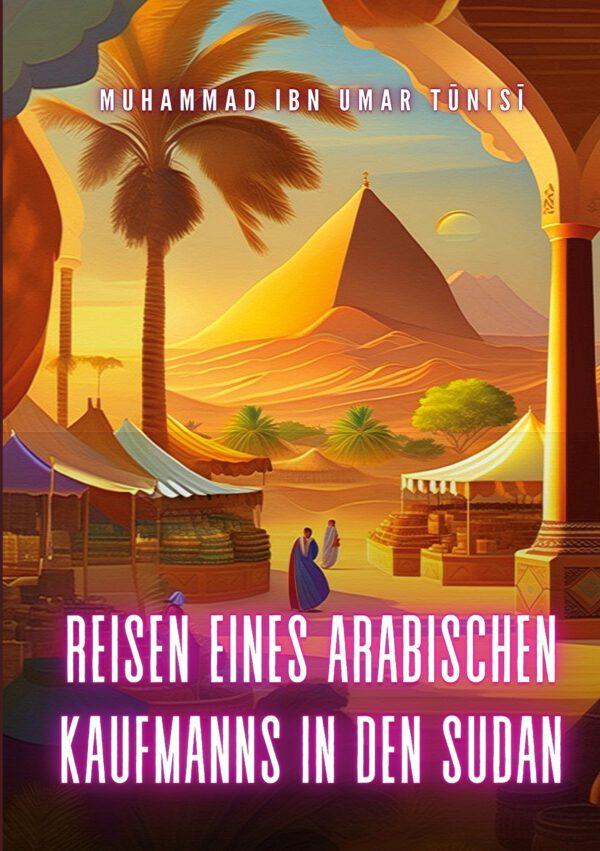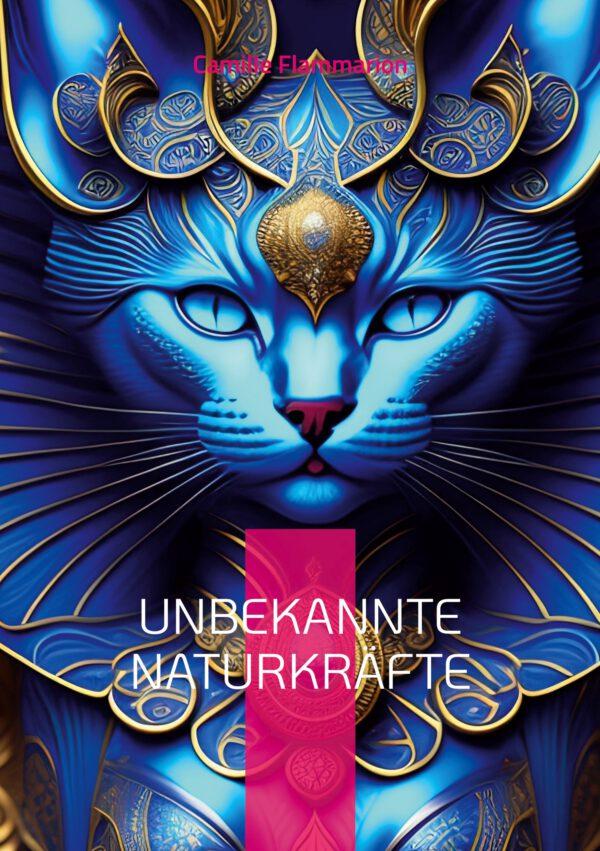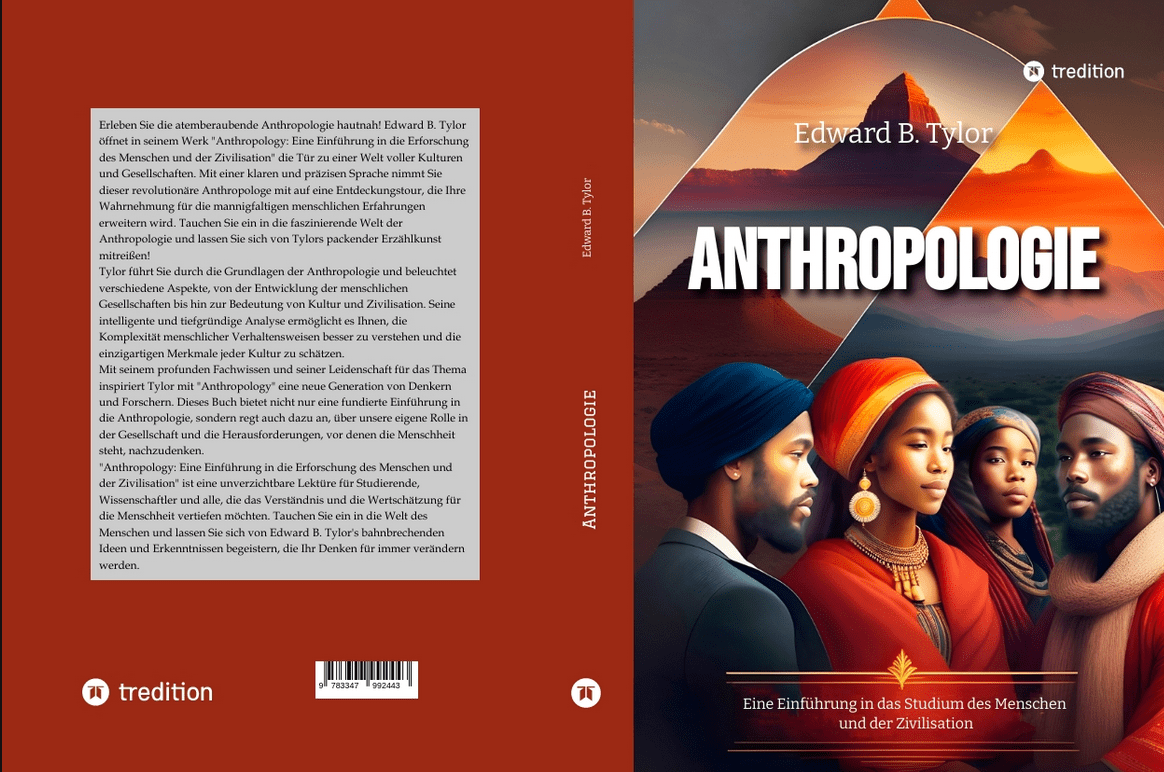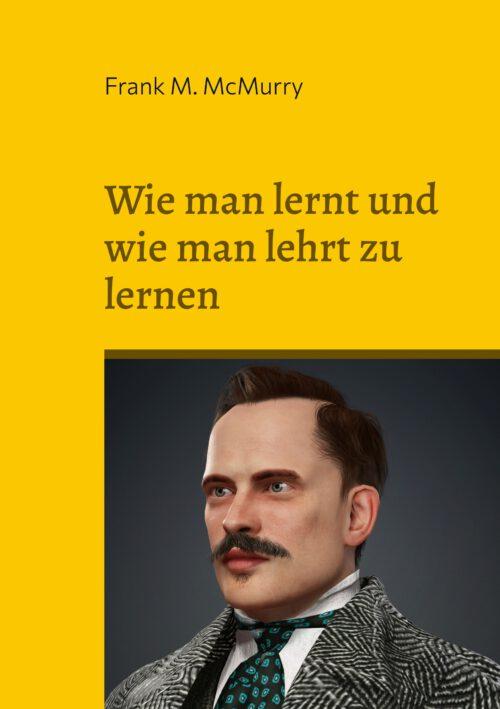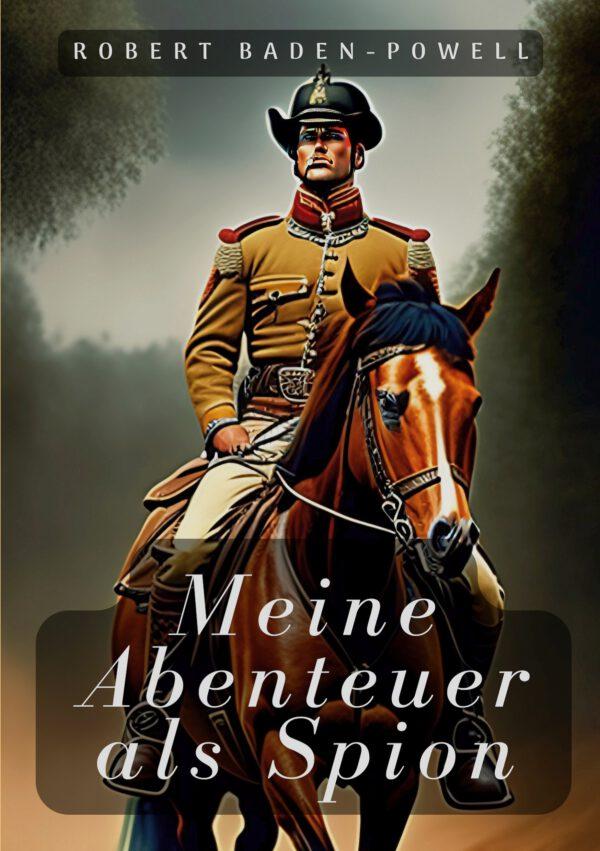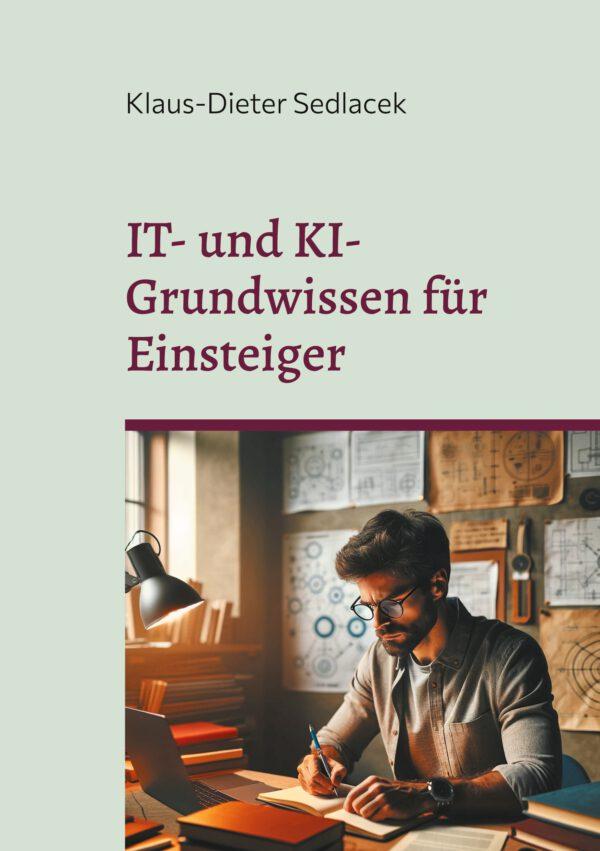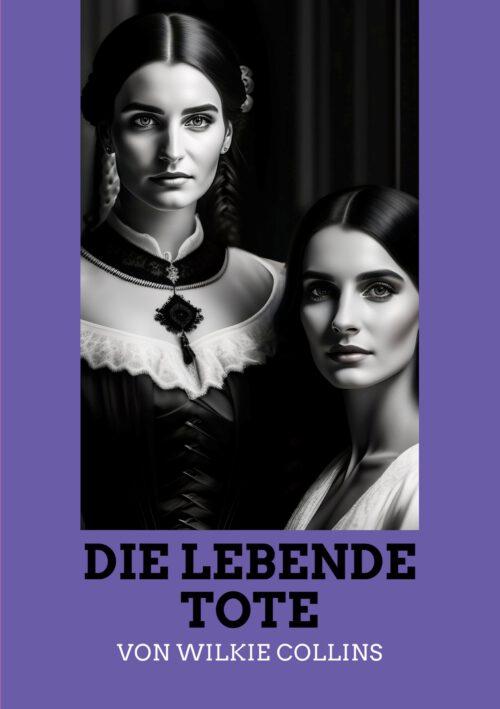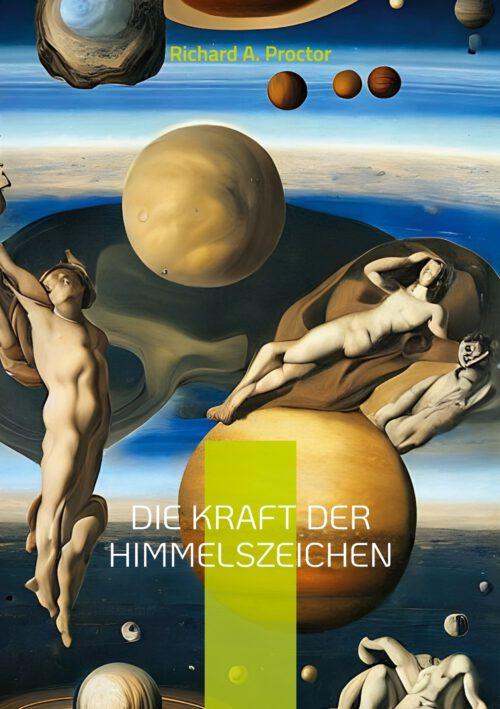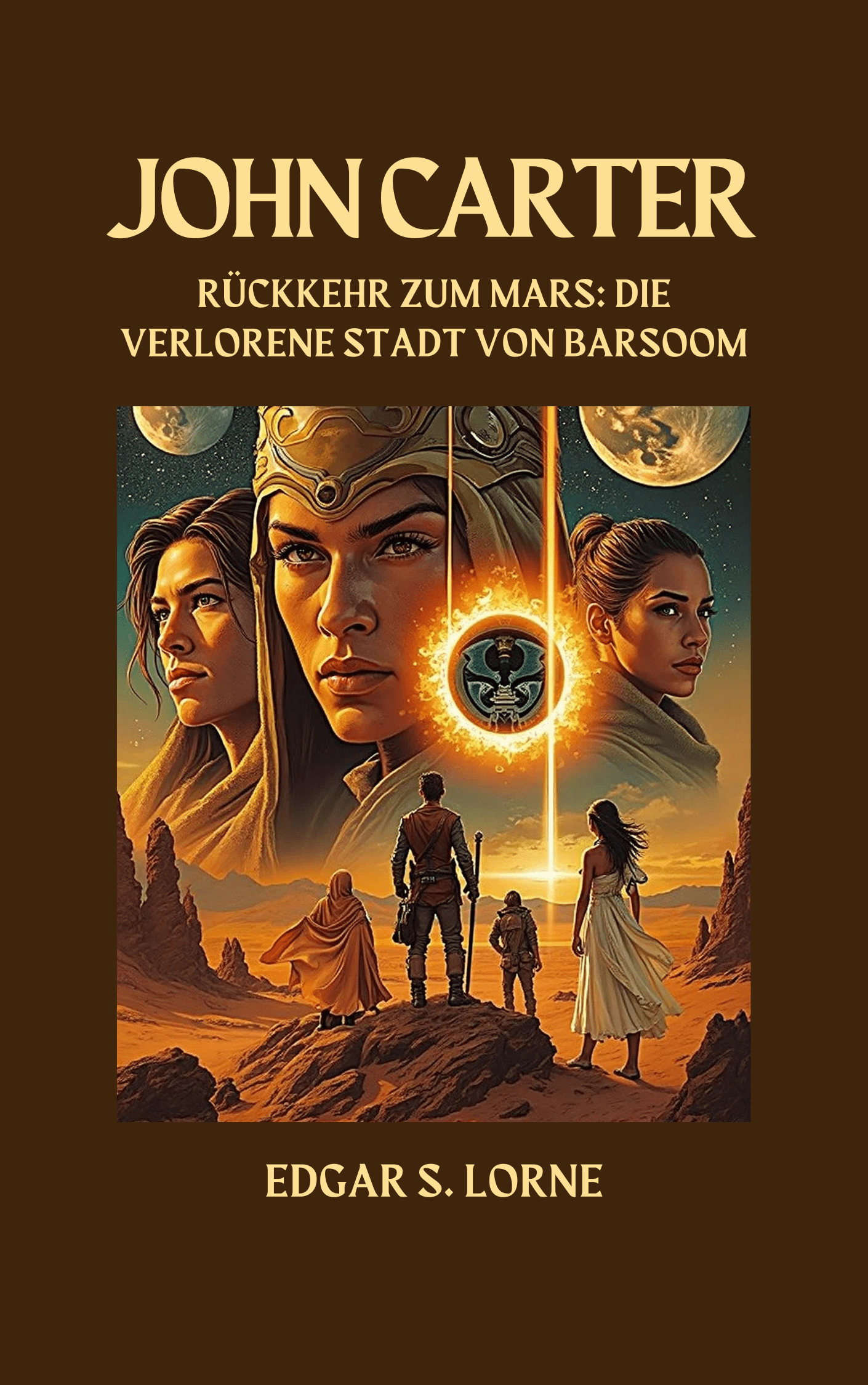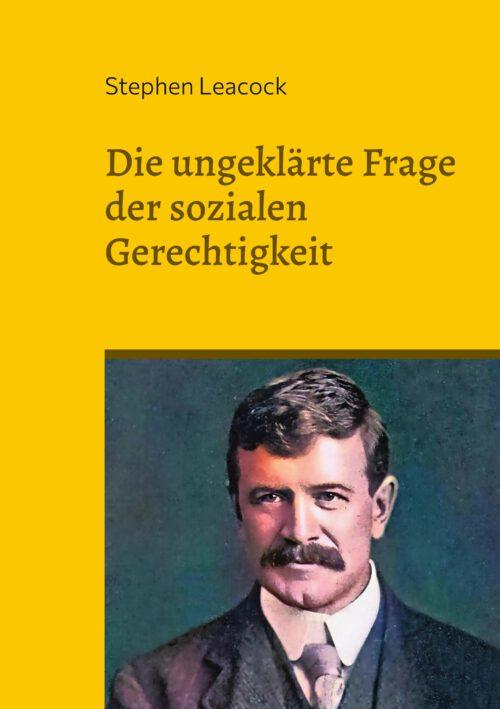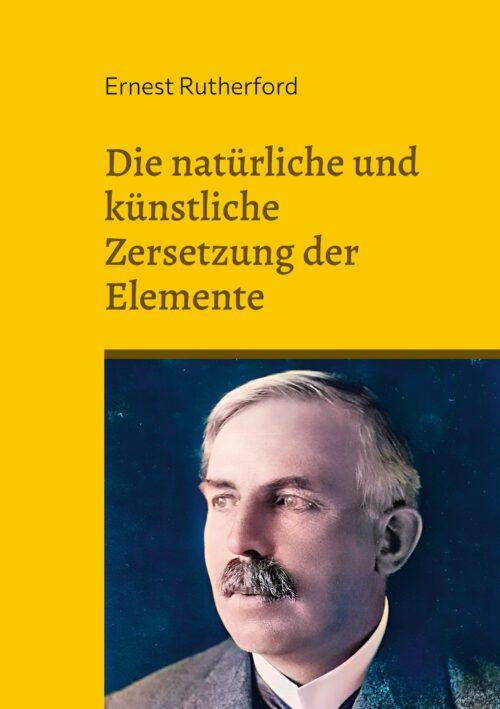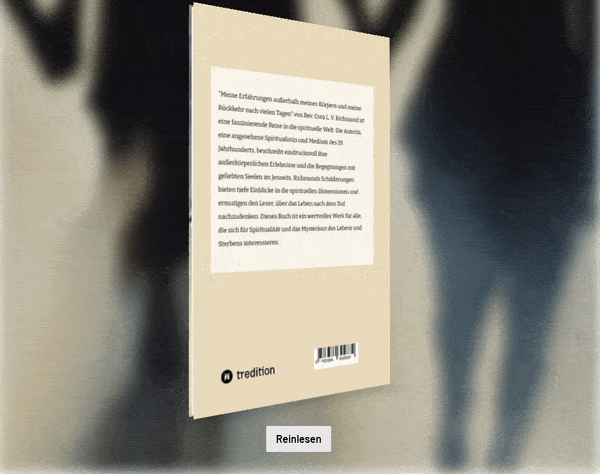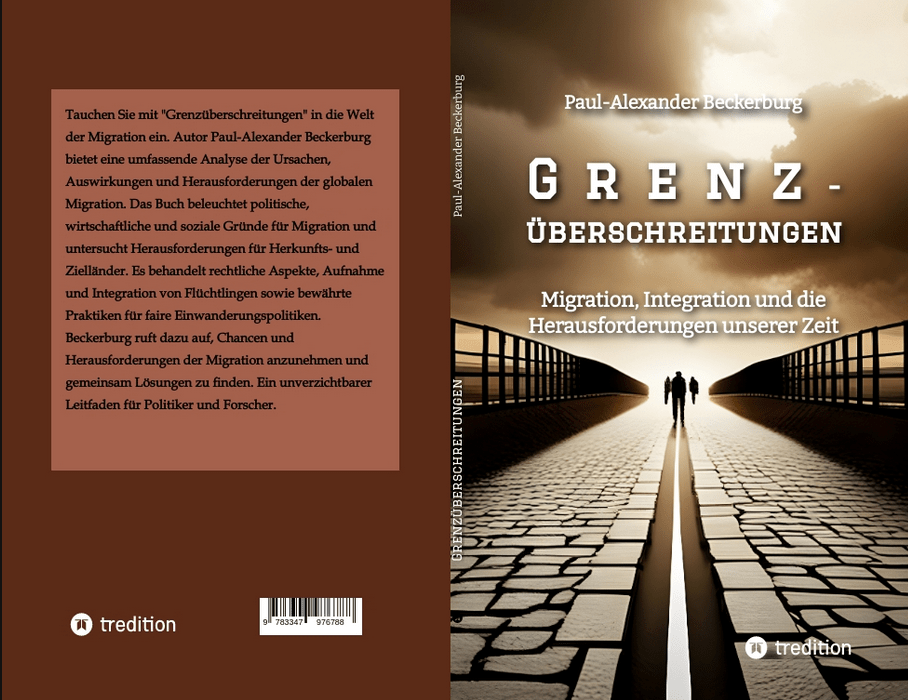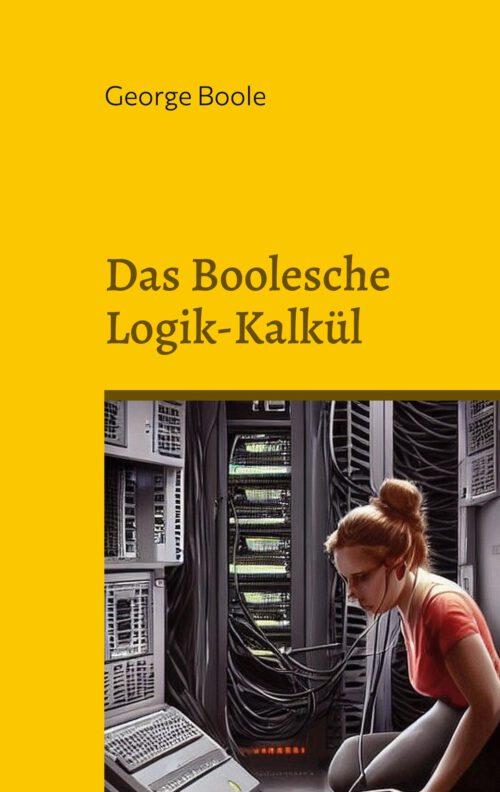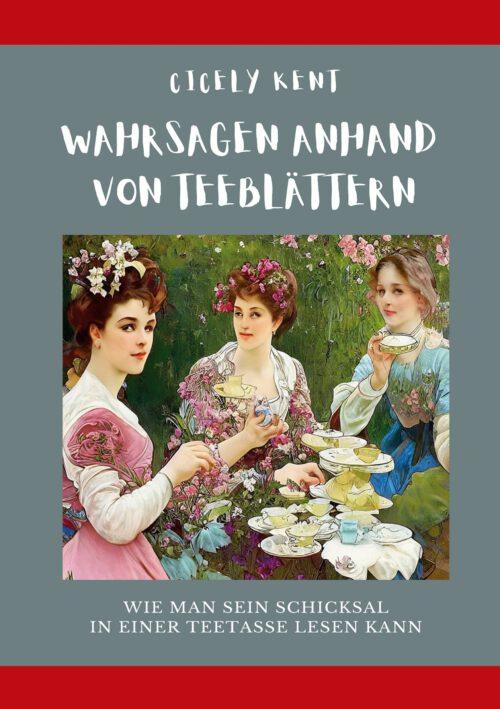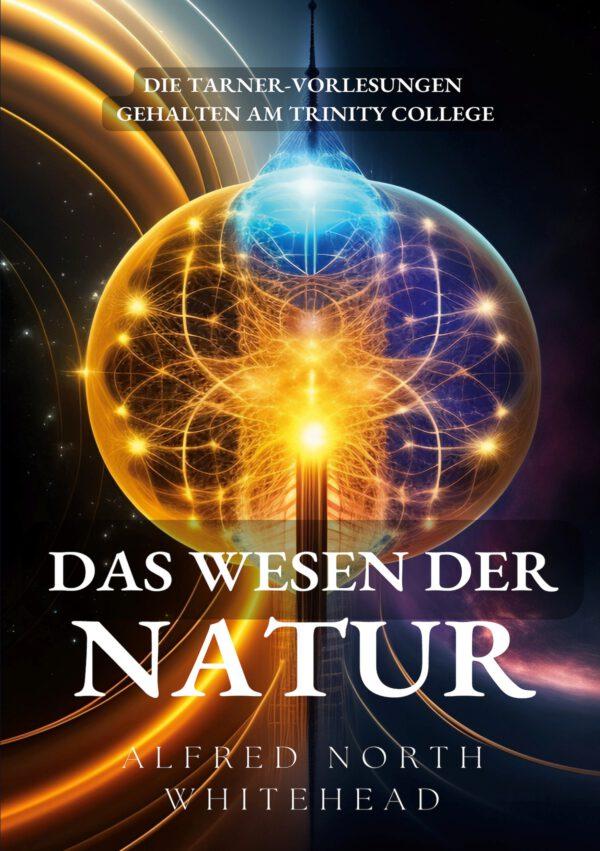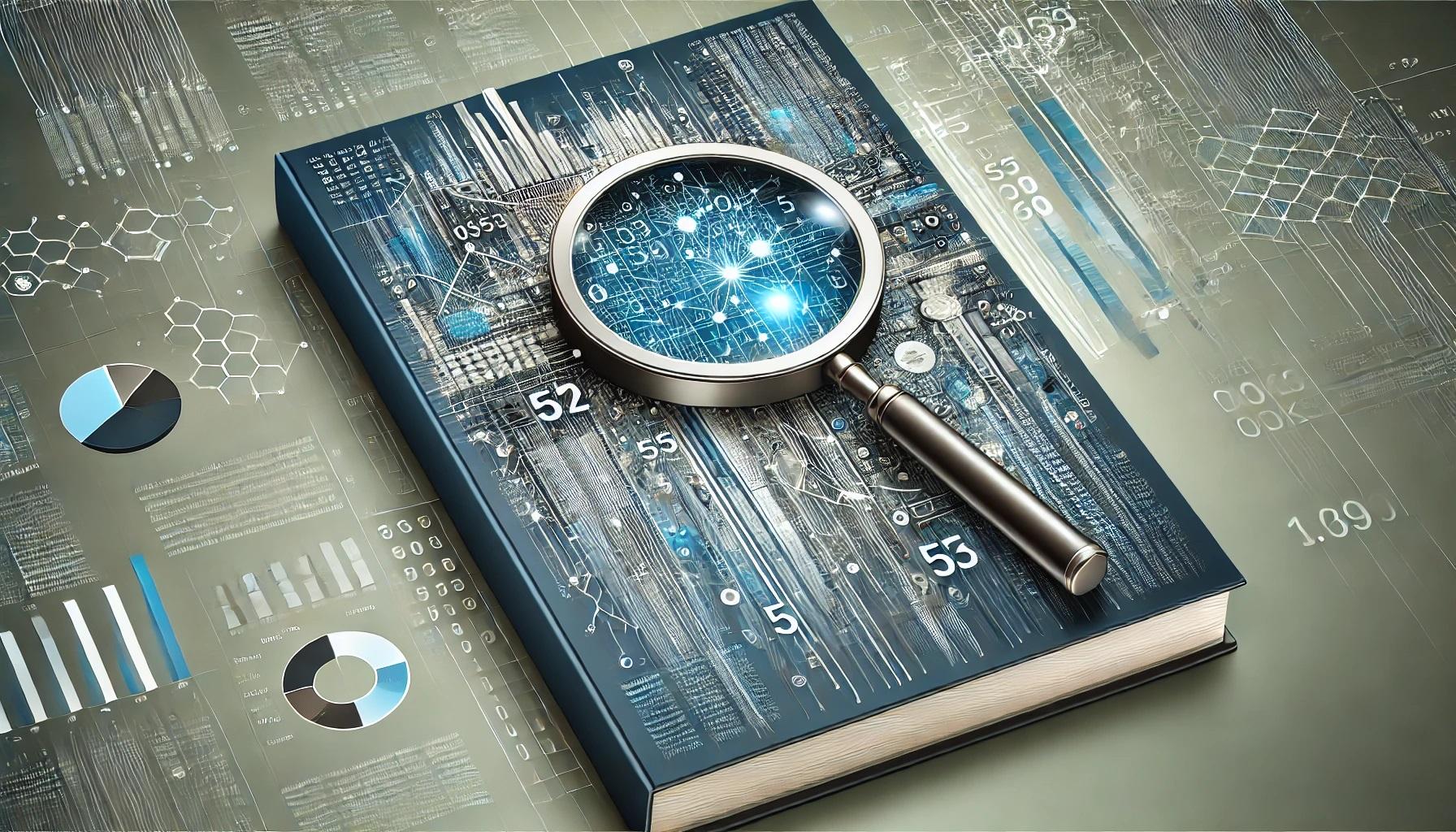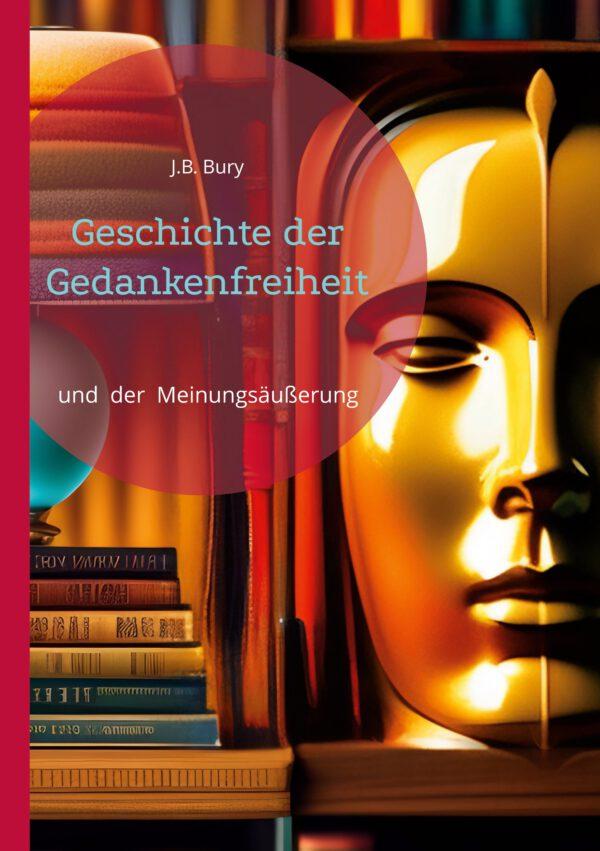Die Stadtbücherei Münster sah sich in letzter Zeit mit einer rechtlichen Auseinandersetzung konfrontiert, nachdem sie in zwei ihrer Bücher Warnhinweise angebracht hatte. Diese Maßnahme wurde von einem der betroffenen Autoren nicht unwidersprochen hingenommen, woraufhin er Klage einreichte. In der zweiten Instanz erhielt der Autor schließlich Recht, was die Diskussion um die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bibliotheken und deren Entscheidungen über Inhalte neu entfachte.
Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) hat in einer offiziellen Stellungnahme auf das Urteil reagiert und fordert eine klare rechtliche Grundlage für Bibliotheken, um künftig ähnliche Situationen zu vermeiden. Diese Forderung ist besonders relevant, da Bibliotheken eine wichtige Rolle in der Bereitstellung von Informationen und Literatur für die Öffentlichkeit spielen. Sie sind nicht nur Orte des Lesens und Lernens, sondern auch Schnittstellen zwischen Kultur, Bildung und Gesellschaft.
Die Entscheidung des Gerichts wirft grundlegende Fragen auf, die weit über den spezifischen Fall hinausgehen. Eine der zentralen Überlegungen ist, inwieweit Bibliotheken für die Inhalte verantwortlich gemacht werden können, die sie bereitstellen. Es geht um die Abwägung zwischen dem Schutz der Leser vor als problematisch empfundenen Inhalten und dem grundsätzlichen Recht auf Meinungsfreiheit und die ungehinderte Verbreitung von Literatur.
Bibliotheken stehen oft vor der Herausforderung, ein vielfältiges und umfassendes Angebot an Büchern und Medien zu präsentieren, das die unterschiedlichsten Ansichten und Perspektiven widerspiegelt. Dabei müssen sie jedoch auch die Sensibilitäten ihrer Nutzer im Blick behalten. Warnhinweise können in bestimmten Fällen sinnvoll erscheinen, um auf potenziell verstörende oder anstößige Inhalte hinzuweisen. Doch das Anbringen solcher Hinweise kann auch als Zensur oder als Eingriff in die Freiheit der Autoren und die Integrität der Werke interpretiert werden.
Der dbv hat betont, dass es unerlässlich ist, einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen, der Bibliotheken in ihrer Arbeit unterstützt und ihnen gleichzeitig die nötige Flexibilität lässt, um auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer einzugehen. Ein solcher Rahmen sollte klare Richtlinien bieten, die es Bibliotheken ermöglichen, verantwortungsvoll mit sensiblen Inhalten umzugehen, ohne dabei in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu werden.
Die Diskussion um Warnhinweise in Bibliotheken spiegelt ein größeres gesellschaftliches Dilemma wider: Wie gehen wir mit kontroversen oder herausfordernden Inhalten um? In einer Zeit, in der Debatten über Meinungsfreiheit, Zensur und die Verantwortung von Institutionen in der Öffentlichkeit immer lauter werden, ist es entscheidend, dass die Stimmen von Autoren, Bibliothekaren und Nutzern gehört werden.
Bibliotheken sollten als Orte der Diversität und des offenen Dialogs verstanden werden. In diesem Sinne könnte eine offene Diskussion über die Notwendigkeit und Angemessenheit von Warnhinweisen zu einem besseren Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven führen. Dabei wäre es hilfreich, einen Austausch zwischen Autoren, Bibliothekaren und der Öffentlichkeit zu fördern, um gemeinsam Lösungen zu finden, die sowohl die Integrität der Literatur als auch die Bedürfnisse der Leser respektieren.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Fall der Stadtbücherei Münster nicht nur eine rechtliche Auseinandersetzung ist, sondern auch eine Gelegenheit, über die Rolle von Bibliotheken in unserer Gesellschaft nachzudenken. Es liegt an uns, einen Raum zu schaffen, der sowohl für die Freiheit der Kunst als auch für die Sensibilität der Leser respektvoll ist. Ein klar definierter rechtlicher Rahmen könnte dazu beitragen, dass Bibliotheken in Zukunft besser auf die Herausforderungen reagieren können, die sich aus der Bereitstellung von Literatur und Informationen ergeben.