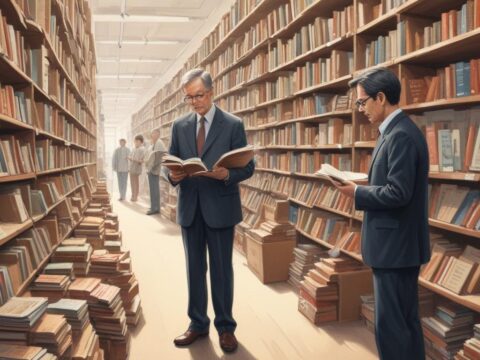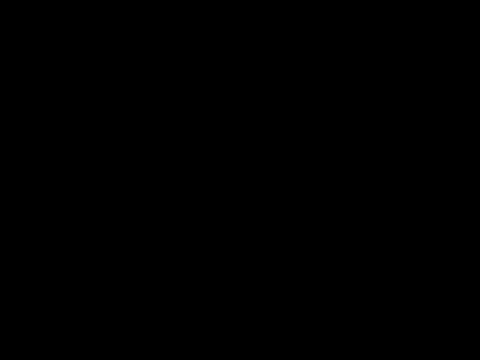In seinem Werk „Kreative Gesellschaft“ untersucht Tomas Kačerauskas die komplexe Rolle der kreativen Klasse im Kontext der postmodernen Schöpfung und interdisziplinären Analyse. Diese Thematik hat seit Richard Floridas Buch „The Rise of the Creative Class“ an Bedeutung gewonnen und ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil lebhafter gesellschaftlicher Debatten. Die kreative Klasse wird zunehmend als etwas Einzigartiges betrachtet, was sich auch in den hohen Gehältern für neuartige Berufe wie das Prompt Engineering widerspiegelt. Diese Entwicklungen sind ein Produkt der digitalen Revolution und der sozialen Medien, die den Zugang zur kreativen Arbeit für eine Vielzahl von Menschen geöffnet haben.
Kačerauskas greift in seiner Analyse die Idee auf, dass die kreative Gesellschaft tief in der westlichen Kulturgeschichte verwurzelt ist. Sein Ansatz ist interdisziplinär und reicht von den Ursprüngen der Kreativität in der Antike bis hin zu zeitgenössischen Diskursen in Philosophie, Kommunikationswissenschaft und Soziologie. Dies verleiht seiner Arbeit eine umfassende Perspektive, die sowohl kritisch als auch ambitioniert ist.
Bereits in der Einleitung seines Buches macht Kačerauskas deutlich, dass es eine wichtige Unterscheidung zwischen Schöpfung und Kreativität gibt. Während kreative Arbeit früher vor allem einer kleinen, künstlerischen Elite vorbehalten war, praktizieren heute über fünf Milliarden Menschen weltweit kreatives Wirken, insbesondere über soziale Medien. Diese Entwicklung hat die Generation X besonders geprägt, da sie zwischen einer analogen Vergangenheit und einer digitalen Gegenwart lebt. Der Autor beschreibt dieses Phänomen als „Kreazialien“ und thematisiert es im Kontext von Postkreativität und Postökonomie. Er hinterfragt, wie sich die kreative Klasse von anderen kreativen Akteuren in der Gesellschaft unterscheidet, sowohl auf sozialer als auch auf ökonomischer Ebene.
Ein zentrales Problem in Kačerauskas’ Analyse ist die Gleichsetzung von kreativer Tätigkeit mit künstlerischer Schöpfung. Dies führt dazu, dass die kreative Gesellschaft hauptsächlich aus der Perspektive der Künste betrachtet wird. Kačerauskas hebt zwar die Unterschiede zwischen Kreativität und Schöpfung hervor, lässt jedoch das Thema Design, das für ein umfassendes Verständnis der kreativen Gesellschaft entscheidend ist, weitgehend unberücksichtigt. Die Logiken, die künstlerische Schöpfung und gestalterische Praxis bestimmen, sind fundamental unterschiedlich, sowohl in ihrer Zielsetzung als auch in ihrer gesellschaftlichen Funktion.
Die Struktur von Kačerauskas’ Buch, das aus einer Lehrveranstaltung an der Vilnius Gediminas Technischen Universität hervorgegangen ist, ist klar und didaktisch. Der hierarchische Aufbau und die wiederkehrenden einführenden sowie zusammenfassenden Abschnitte machen den Text zugänglich, führen jedoch gelegentlich zu Redundanzen. Dennoch bietet diese Struktur den Lesenden die Möglichkeit, das Werk als umfassende Bestandsaufnahme interdisziplinärer Entwicklungen zu nutzen.
Ein besonders spannender und politischer Aspekt seines Buches ist die Diskussion um den Begriff des Kreativkapitals, das Richard Florida geprägt hat, im Verhältnis zum Sozialkapital. Während Sozialkapital die gesellschaftlichen Bindungen wie Bildung, Kultur und Werte beschreibt, basiert Kreativkapital auf Individualismus und Offenheit. Kačerauskas zeigt, dass beide Konzepte nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen müssen und dass eine Gesellschaft gleichzeitig über ein wachsendes Kreativ- sowie Sozialkapital verfügen kann. Diese Überlegung ist entscheidend, da sie auf das Spannungsfeld zwischen individueller Kreativität und sozialem Zusammenhalt hinweist.
Ein weiterer spannender Punkt in Kačerauskas’ Argumentation ist die Abgrenzung von Richard Floridas Definition der kreativen Klasse. Während Florida eine Transformation der gesamten Gesellschaft zur kreativen Klasse beschreibt, zieht Kačerauskas bewusst engere Grenzen, um die Exklusivität der kreativen Klasse zu betonen. Diese differenzierte Sichtweise könnte die Vorstellung einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation bereichern und aufzeigen, dass wir möglicherweise am Anfang einer neuen Ära stehen.
Die wissenschaftliche Genauigkeit, mit der Kačerauskas seine Argumente formuliert, ist beeindruckend, jedoch wünscht man sich an manchen Stellen eine größere visionäre Perspektive. Trotz der tiefgründigen Analyse bleibt die Frage, wie der individuelle kreative Ausdruck in die gesellschaftliche Struktur integriert werden kann, ein zentrales und herausforderndes Thema der heutigen Zeit.
Insgesamt bietet „Kreative Gesellschaft“ von Tomas Kačerauskas einen fundierten und vielschichtigen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Verschmelzung von Kreativität und Gesellschaft ergeben.