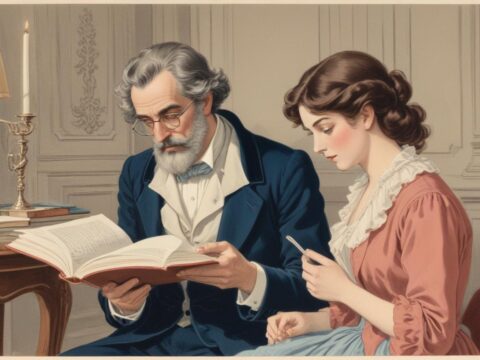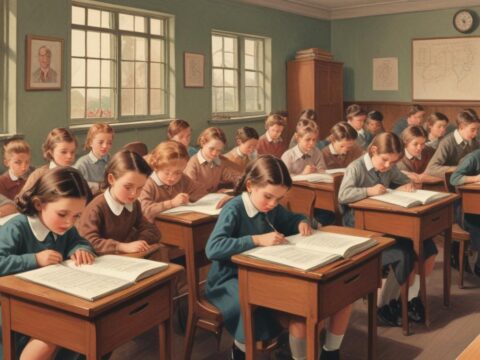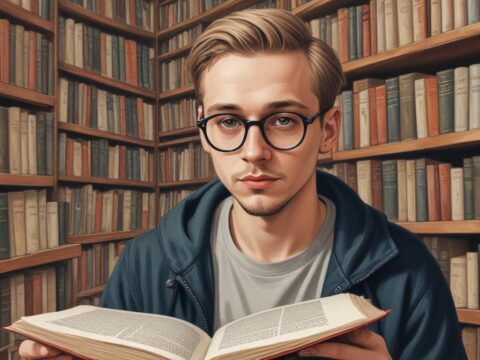In seinem Werk „Nachbilder“ beschäftigt sich Matthias N. Lorenz mit den gravierenden Mängeln in der Erinnerungskultur rund um das rassistische Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, das vom 22. bis 25. August 1992 stattfand. Dieses Ereignis stellt nicht nur einen dunklen Abschnitt in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands dar, sondern wirft auch Fragen über die Art und Weise auf, wie die Gesellschaft mit ihrer eigenen Vergangenheit umgeht. Indem Lorenz verschiedene Aspekte der Erinnerungskultur beleuchtet, wird deutlich, dass die kollektive Erinnerung an solche Gewaltausbrüche oft unzureichend ist und tiefgreifende gesellschaftliche Probleme verdeckt.
Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, bei dem eine Asylunterkunft angegriffen wurde, zeigt, dass die vermeintliche Überwindung nationalsozialistischer Ideologien in der deutschen Gesellschaft vor einem massiven Test steht. Lorenz argumentiert, dass die Reaktionen der Bevölkerung und der Behörden während und nach den Ausschreitungen eher die Verdrängung und Leugnung von Rassismus als eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Vorfällen widerspiegeln. In fünf Essays analysiert er die verschiedenen Dimensionen der Erinnerung und stützt sich dabei auf Fotografien, die während der Ereignisse aufgenommen wurden. Der Titel „Nachbilder“ bezieht sich auf die anhaltende Wirkung dieser Bilder, die über die Zeit hinaus fortbesteht und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verdeutlicht.
Ein zentrales Element von Lorenz’ Argumentation sind zwei Fotografien, die nahezu gleichzeitig entstanden sind und dieselben Personen zeigen. Eine dieser Bilder zeigt einen Mann in einem Deutschland-Trikot, der den Hitlergruß zeigt, während ein anderer Mann daneben steht und die Szene mit einem Grinsen beobachtet. Diese ikonischen Bilder dienen als Symbol für die Verdrängung der Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft, die Lorenz eindrücklich darstellt. Er verdeutlicht, dass die ikonische Darstellung des „hässlichen Deutschen“ als eine Art von Verdrängung fungiert, die es der Gesellschaft ermöglicht, ihre eigene Schuld zu leugnen und den Rassismus zu externalisieren.
Lorenz rekonstruiert die Bedingungen, die zu diesem Pogrom führten, und beschreibt, wie eine Kombination aus wirtschaftlicher Not, Arbeitslosigkeit und einem allgemeinen Gefühl des Kontrollverlusts in der Bevölkerung zu einem Nährboden für rassistische Gewalt wurde. Besonders aufschlussreich ist sein Hinweis auf die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern, die unter unzureichenden Bedingungen operierte und somit die Situation der Menschen vor Ort weiter verschärfte. Diese Umstände wurden von der Bevölkerung häufig als Gründe für die Ausschreitungen herangezogen, was die perfide Logik der Täter:innen und ihrer Unterstützer:innen verdeutlicht.
Ein weiterer zentraler Punkt in Lorenz’ Analyse ist die Rolle der Behörden während des Pogroms. Er beschreibt, wie staatliche Institutionen nicht nur versagten, sondern auch aktiv zur Verdrängung beitrugen. Anhand eines Beispiels einer Imbissbude, die während der Ausschreitungen betrieben wurde, veranschaulicht er, wie Täter:innen und Unterstützer:innen sich ungestört versorgen konnten, während die Polizei die Verantwortung für mögliche Eingriffe hin- und herschob. Diese Art der Duldung zeigt, dass der Rassismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch auf institutioneller Ebene verankert ist.
Darüber hinaus thematisiert Lorenz auch die anhaltende Ignoranz gegenüber den Opfern des Pogroms. Eine Gedenktafel, die 1992 am Rostocker Rathaus angebracht wurde, stellte eine Verbindung zwischen den Ausschreitungen und der Geschichte des Nationalsozialismus her, wurde jedoch lange Zeit ignoriert. Dieser Mangel an Aufarbeitung zieht sich bis in die Gegenwart und wird auch auf höchster politischer Ebene negiert. Lorenz zitiert Aussagen von politischen Entscheidungsträgern, die die Gewalt als inszeniert oder als von anderen politischen Gruppen ausgehend darstellten, was die Verdrängung der Verantwortung weiter verstärkt.
Mit „Nachbilder“ leistet Lorenz einen wesentlichen Beitrag zur Debatte über die Erinnerungskultur in Deutschland. Er verknüpft historische Analysen mit persönlichen Geschichten und gibt den Opfern des Pogroms eine Stimme. Gleichzeitig kritisiert er die gegenwärtigen Zustände und zieht Parallelen zu aktuellen rassistischen Strömungen. Der interdisziplinäre Ansatz, den Lorenz verfolgt, ermöglicht es, bisher vernachlässigte Aspekte in den Fokus zu rücken und