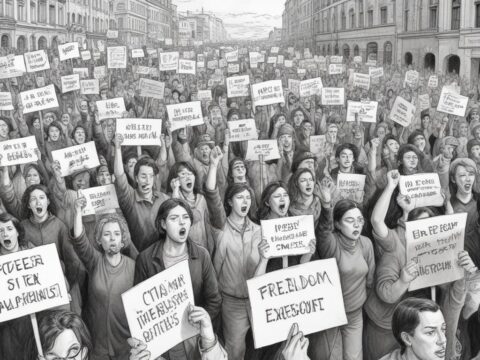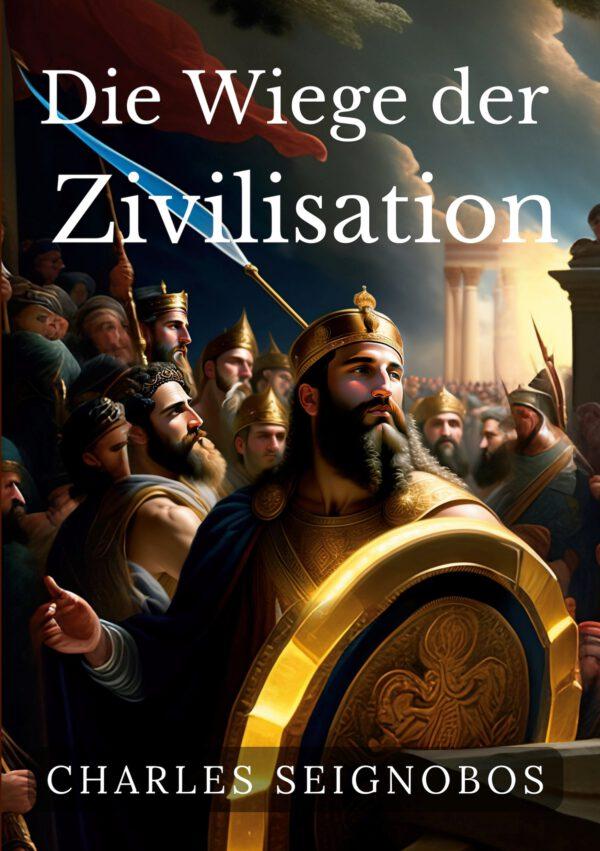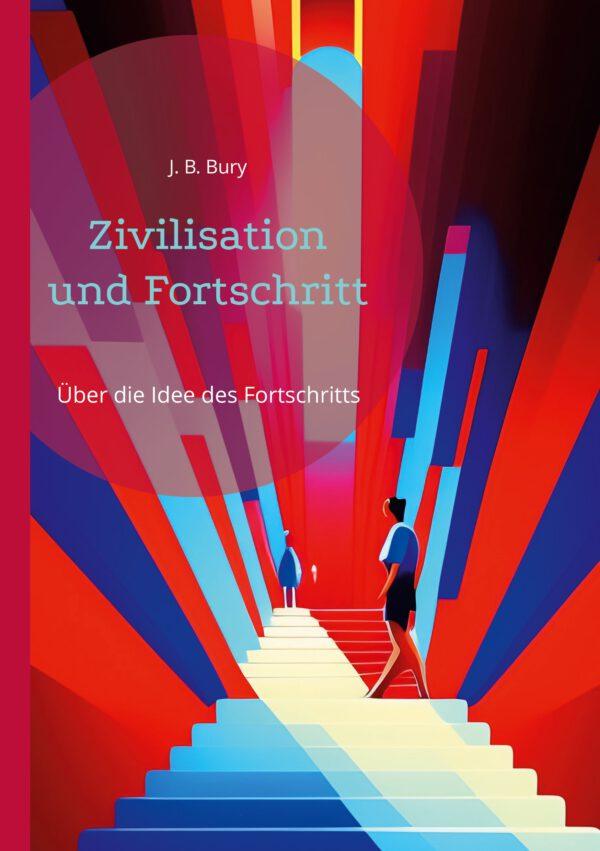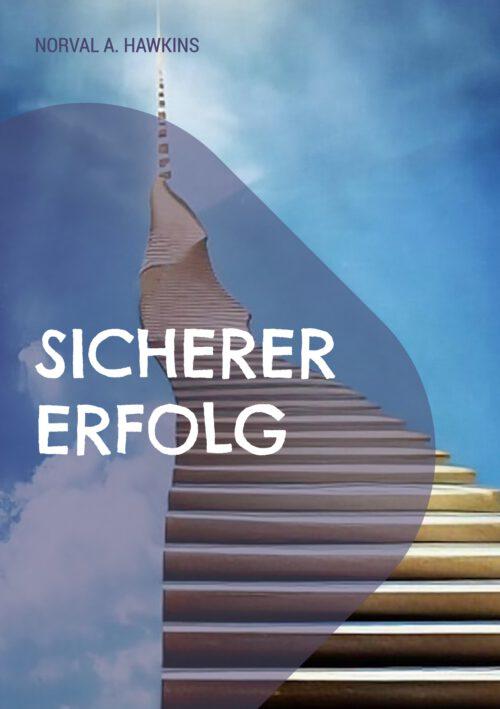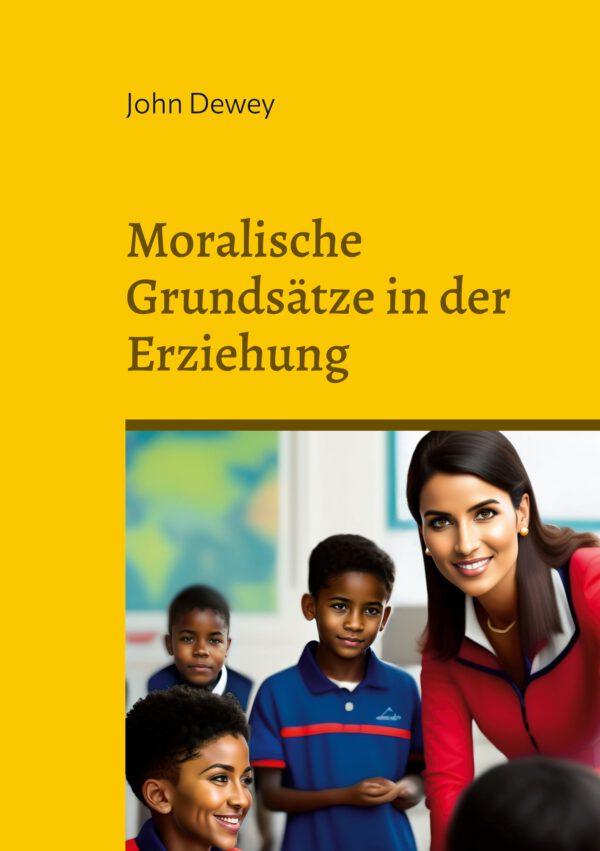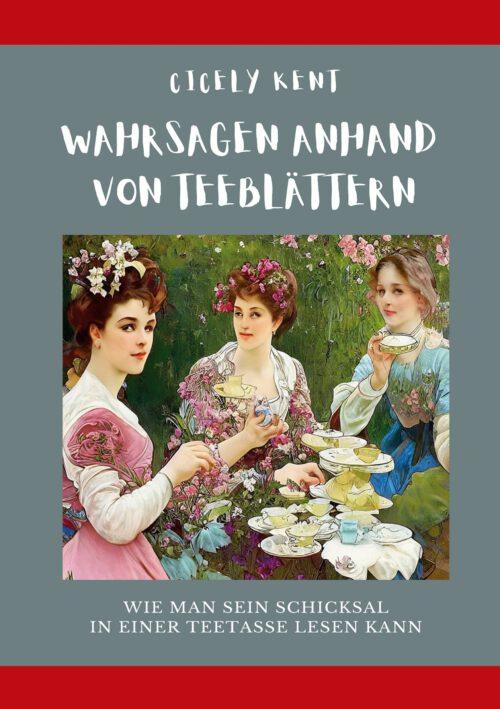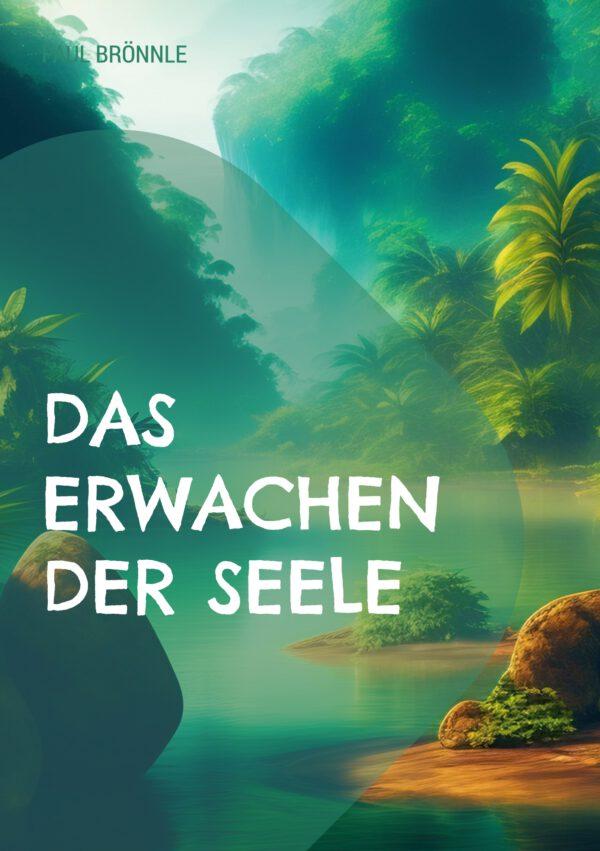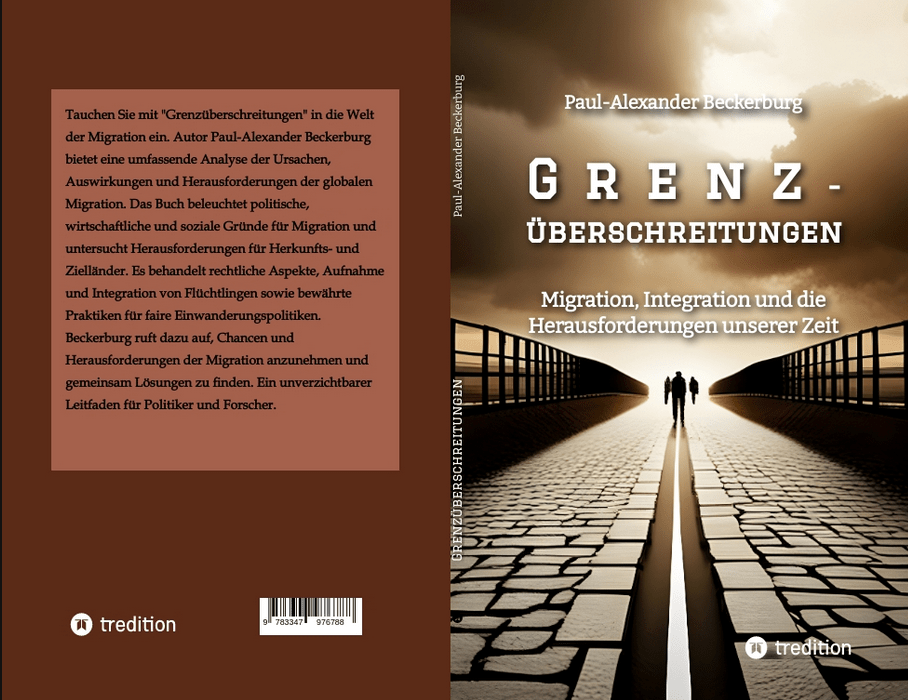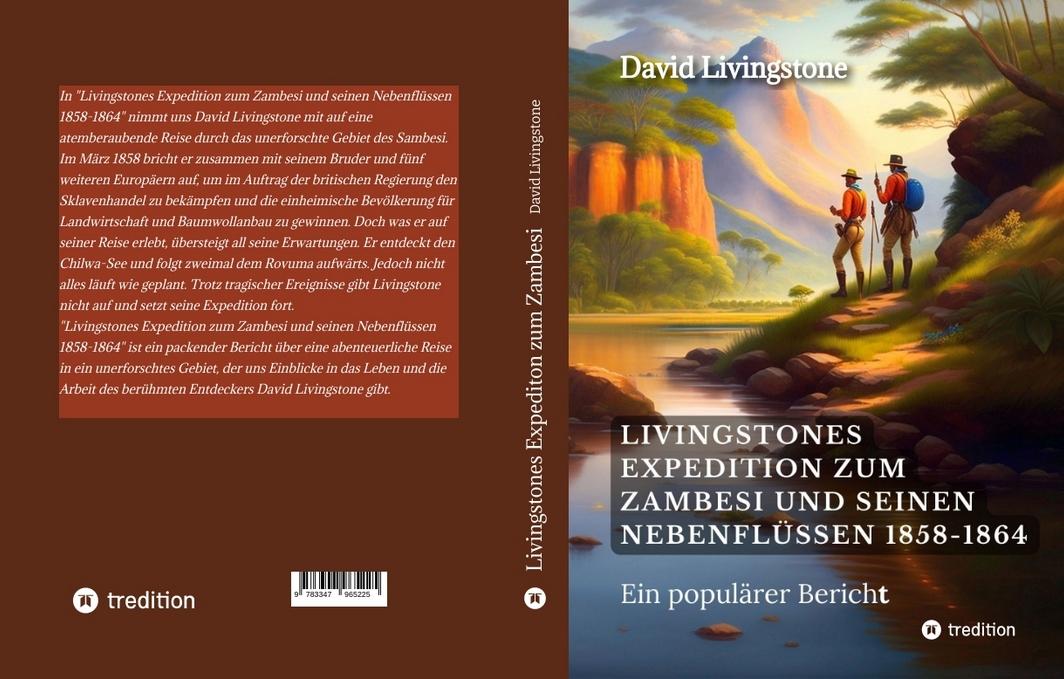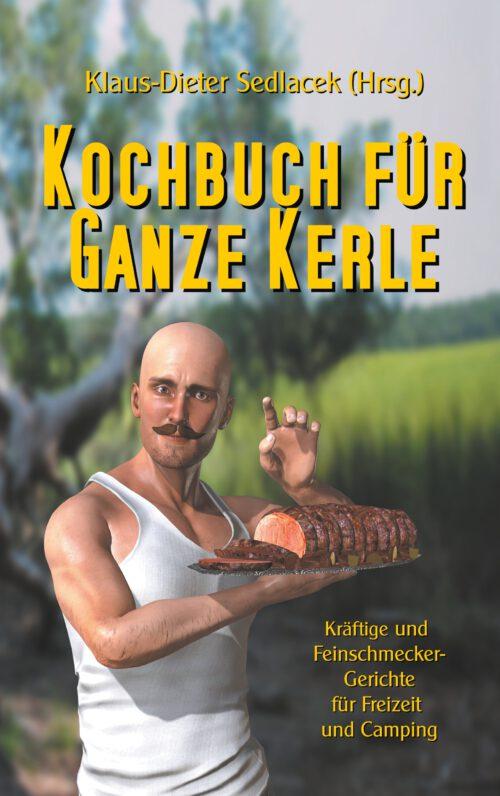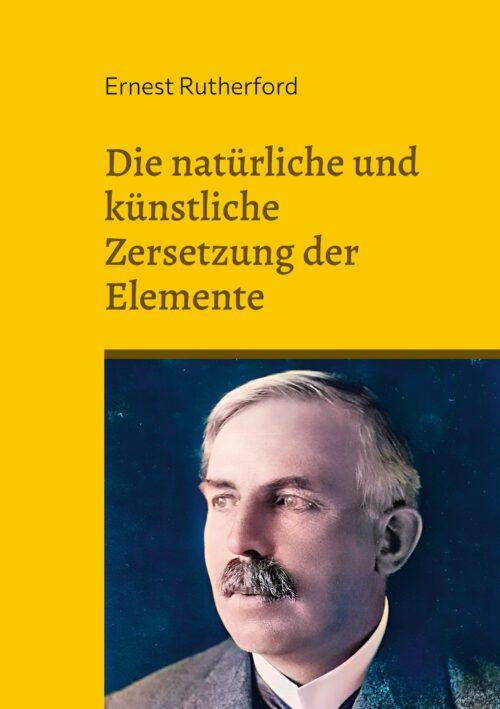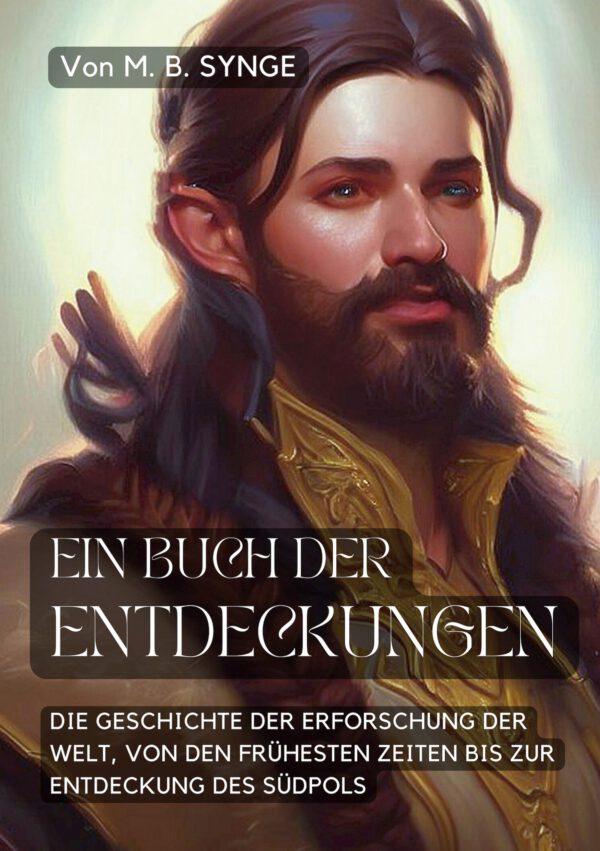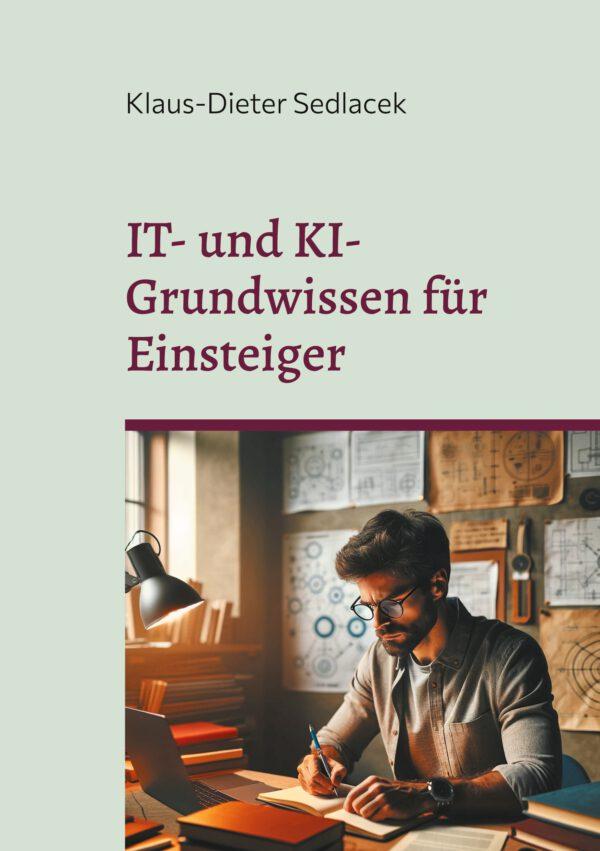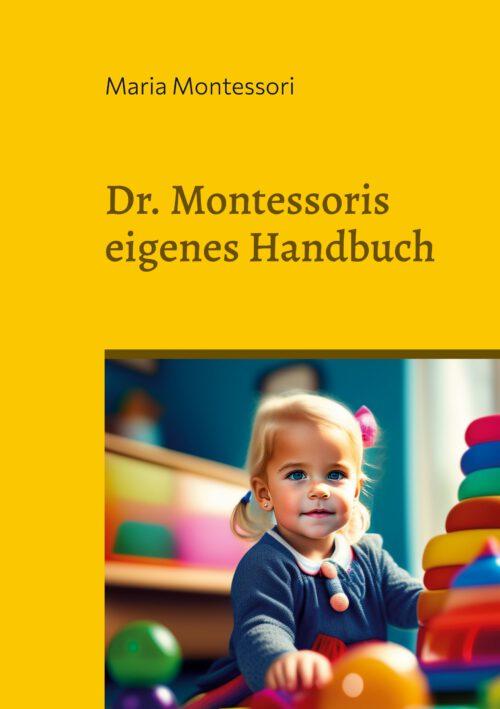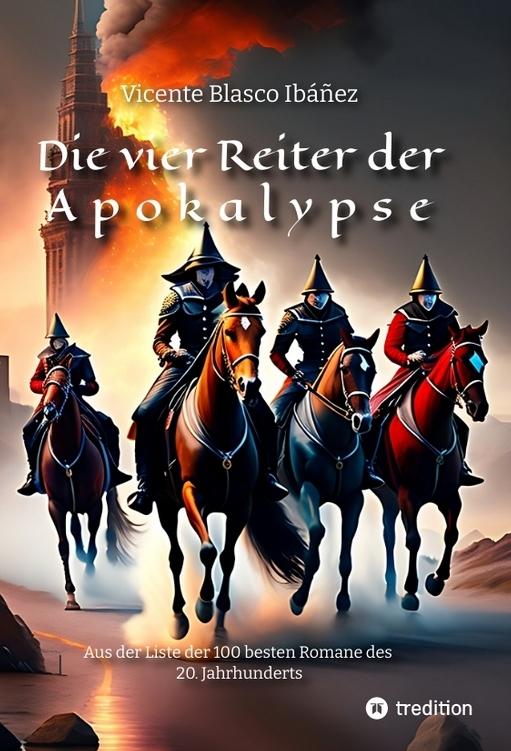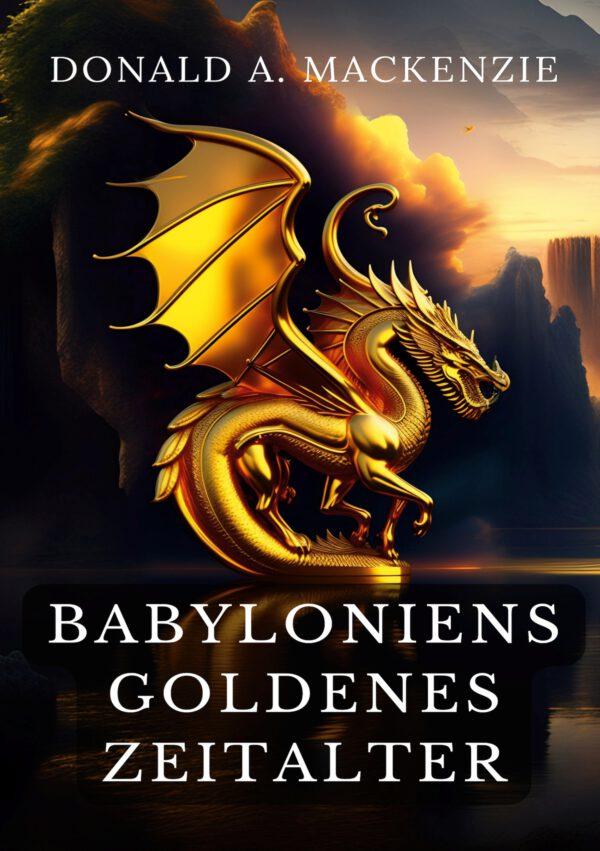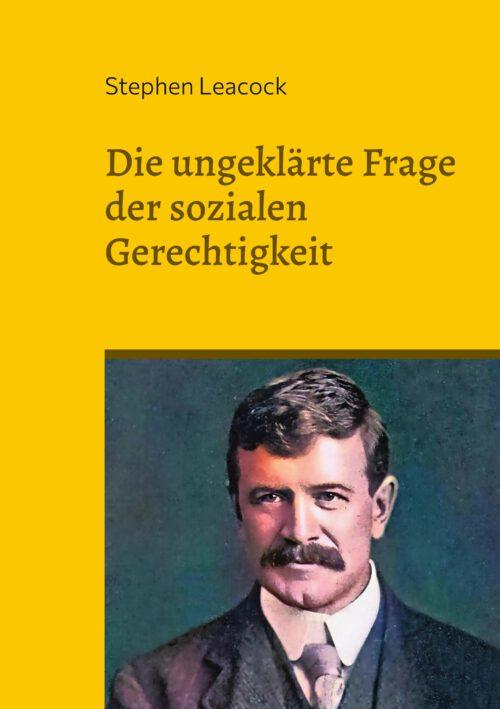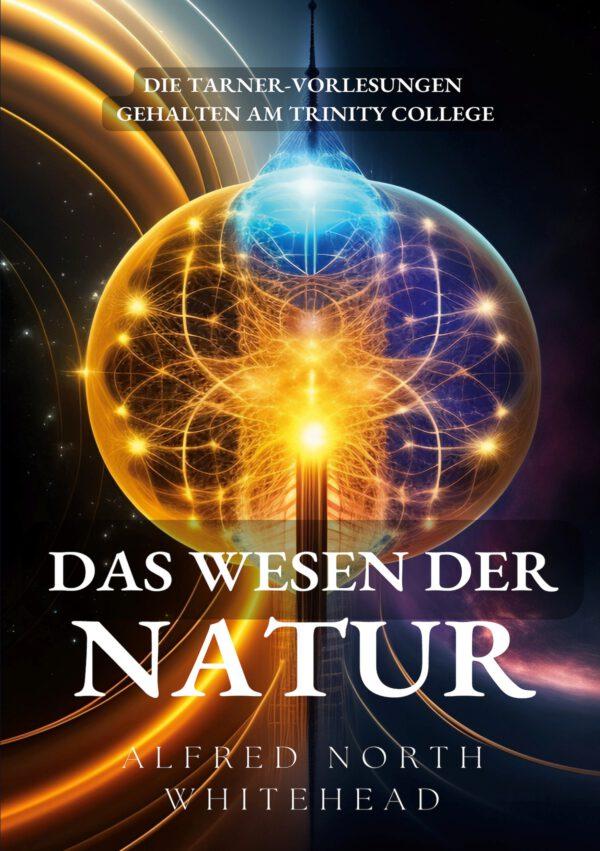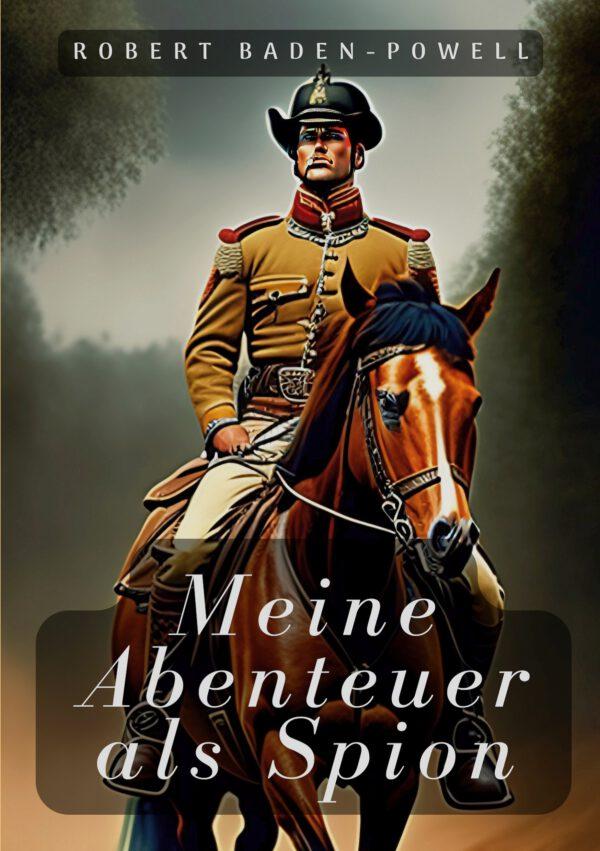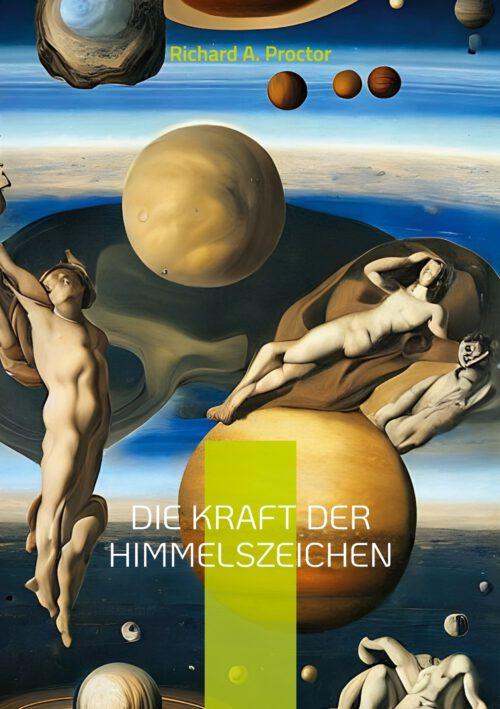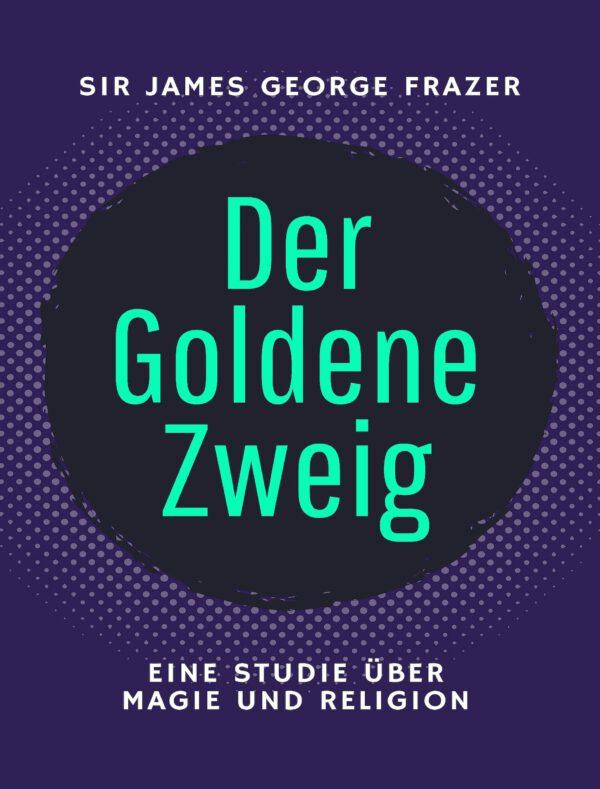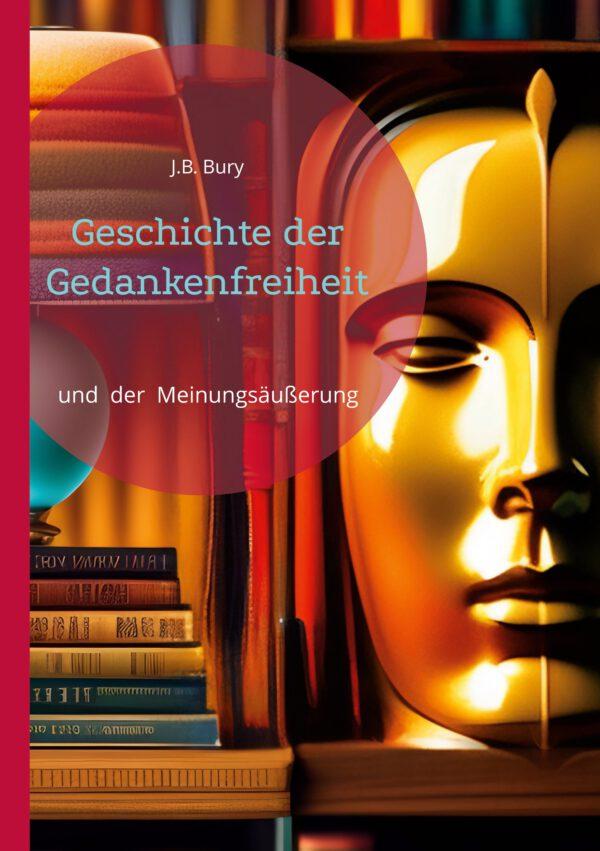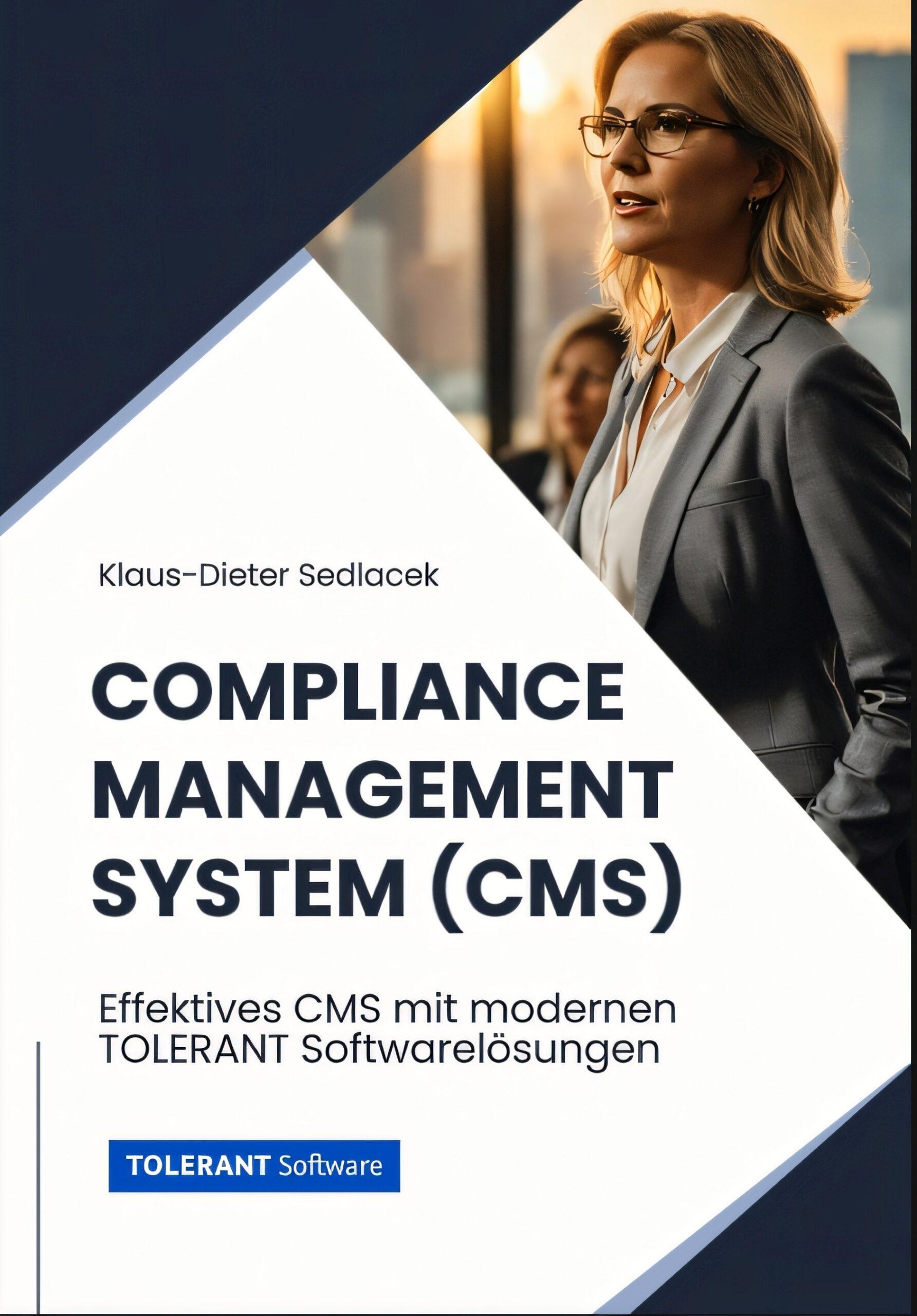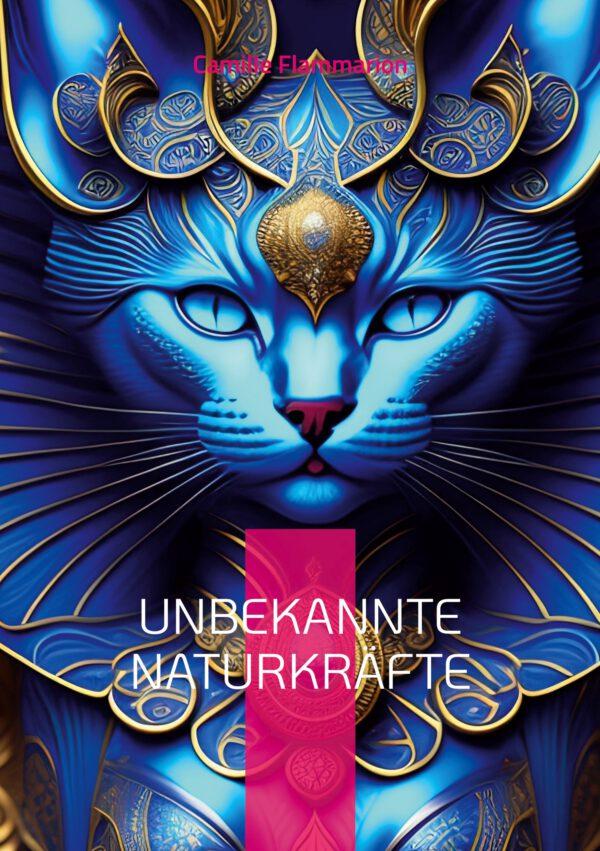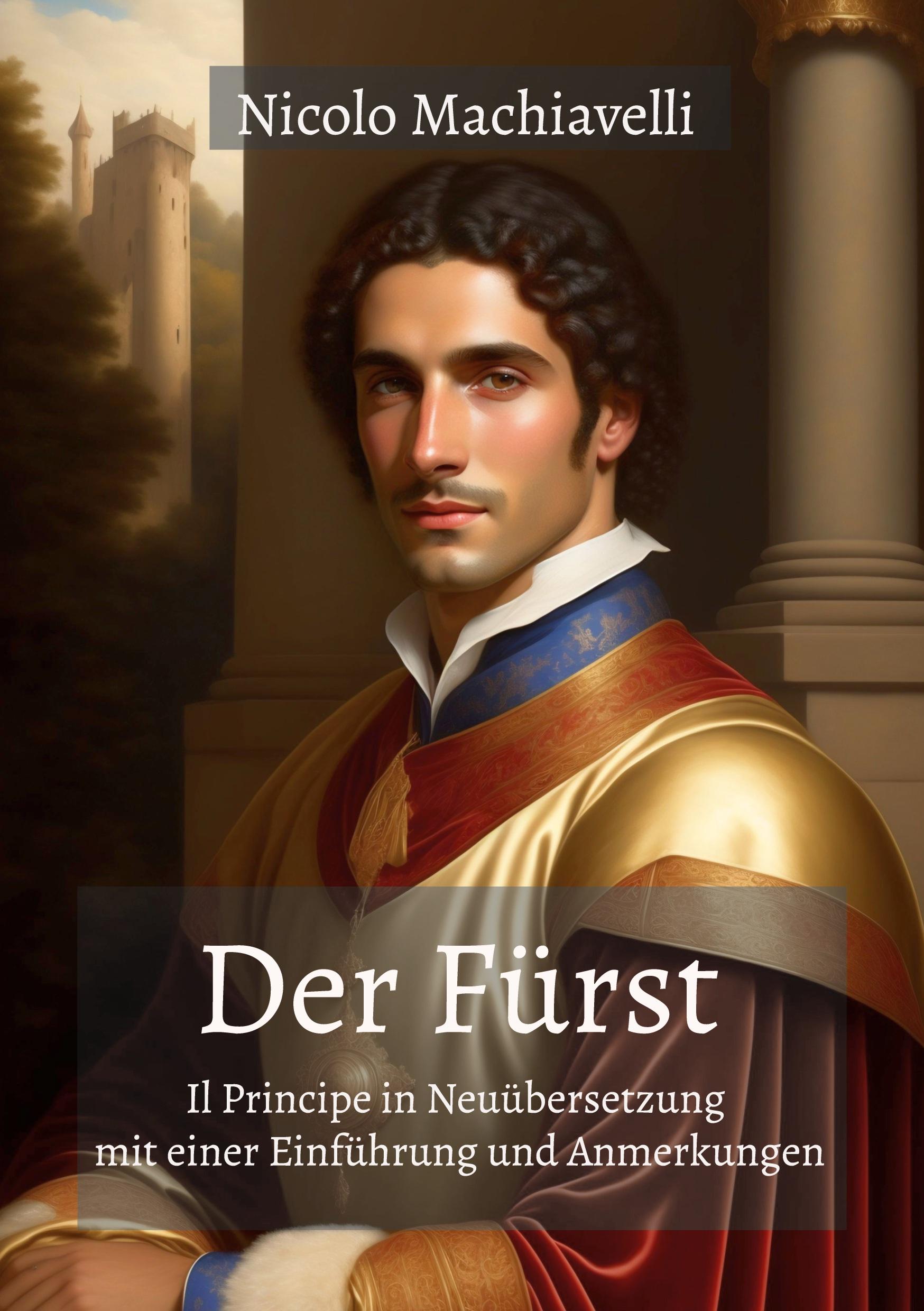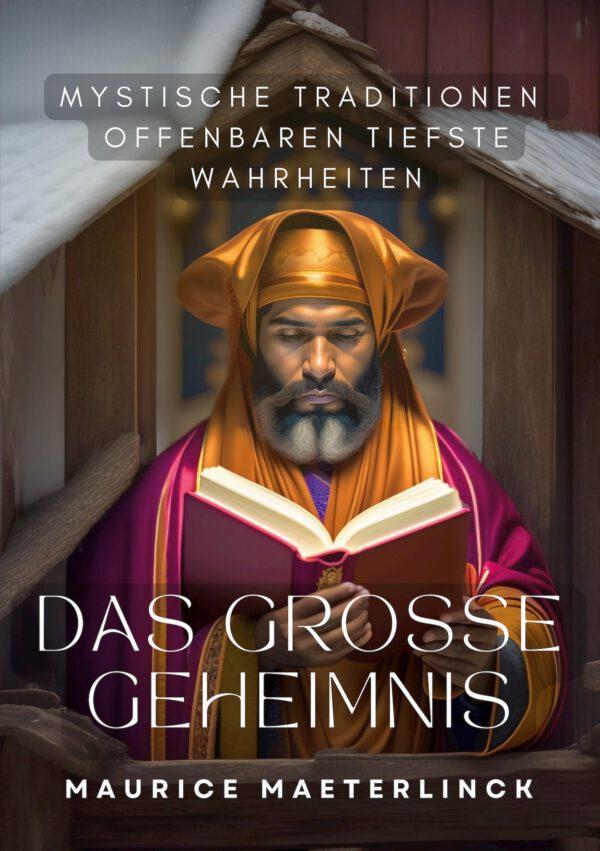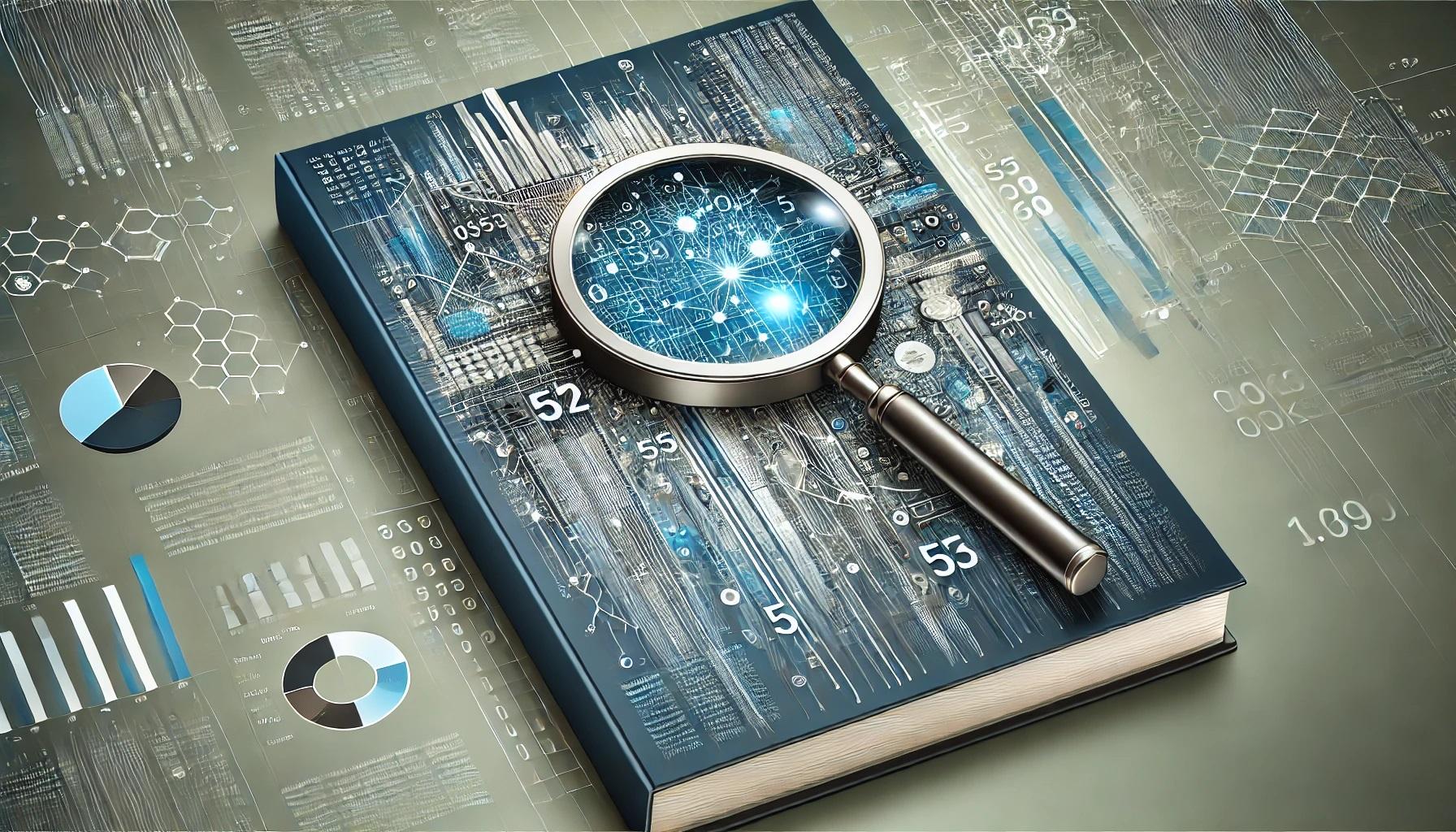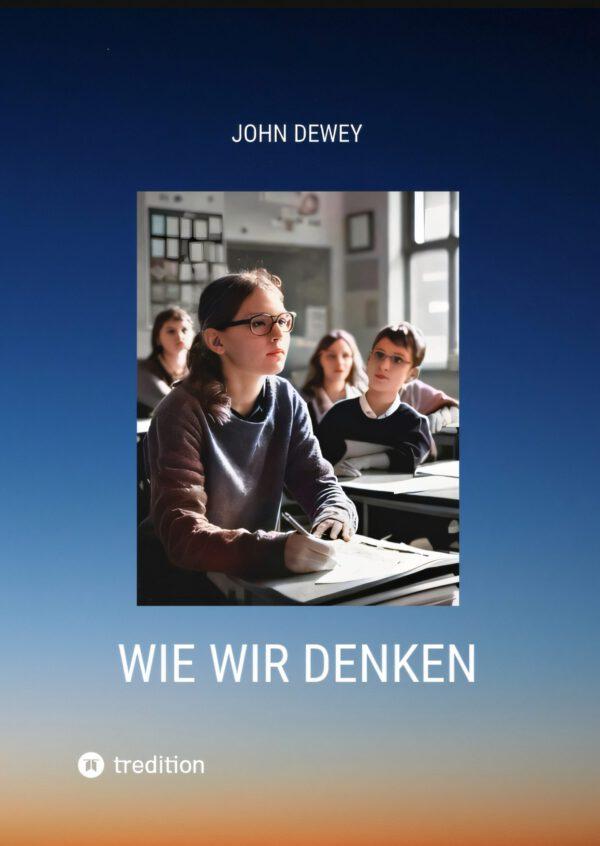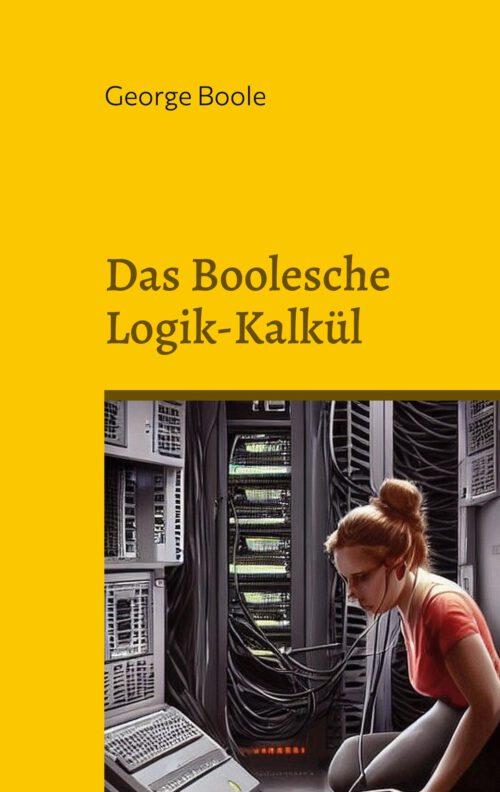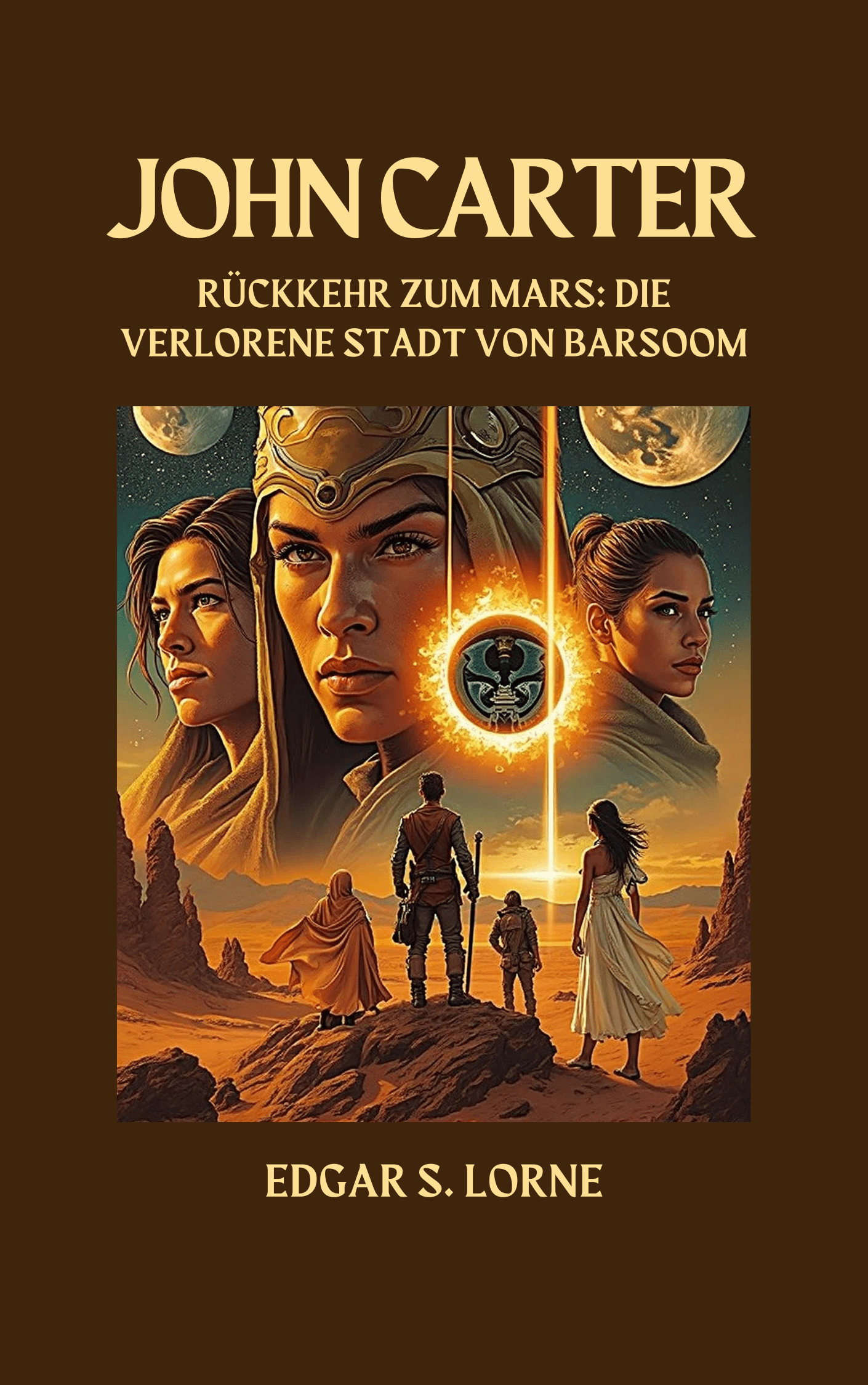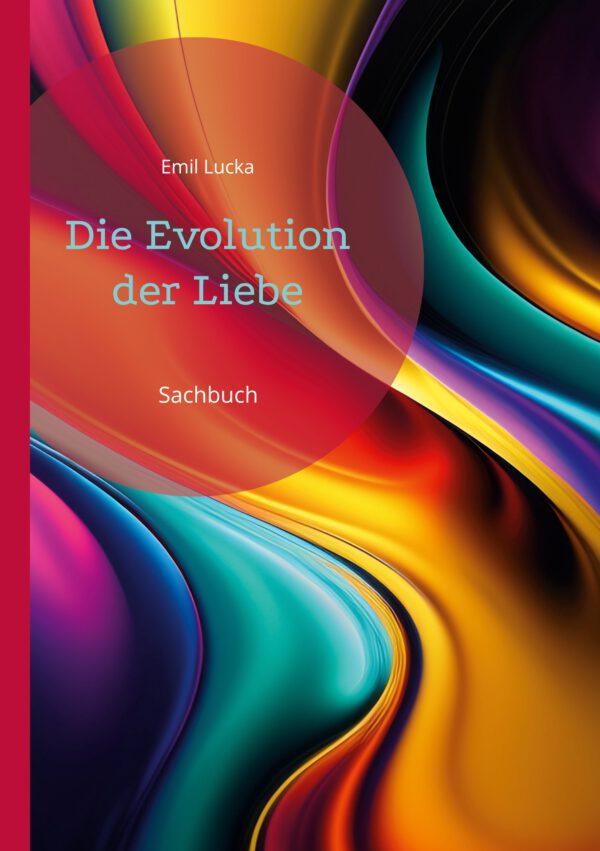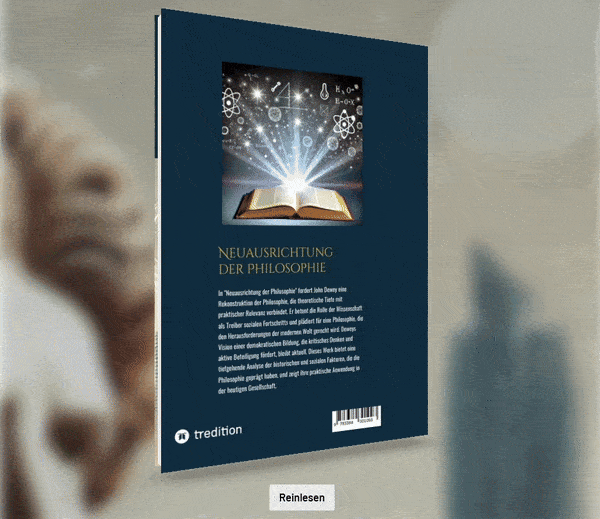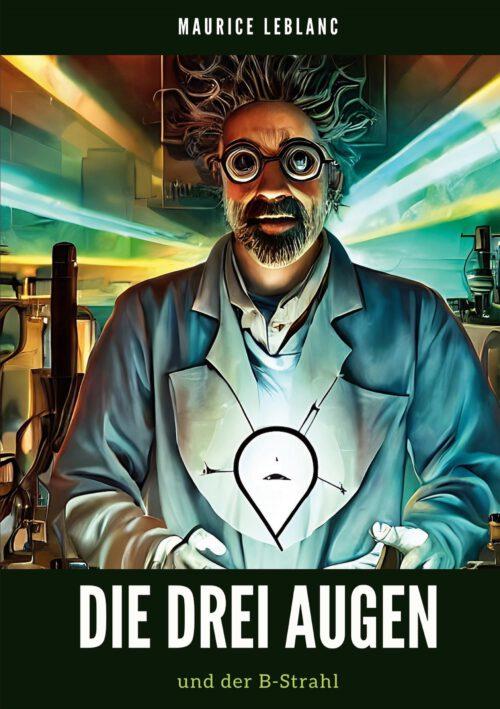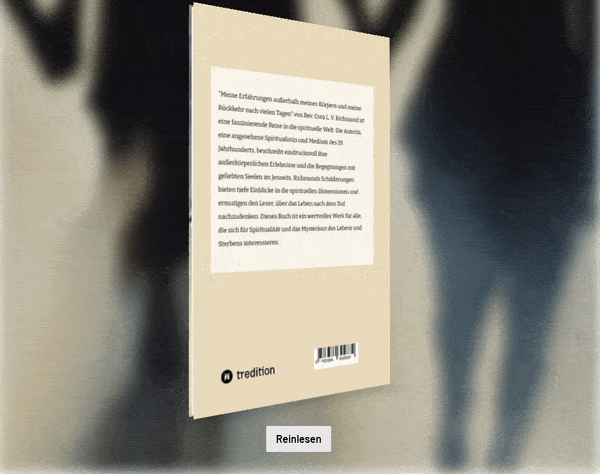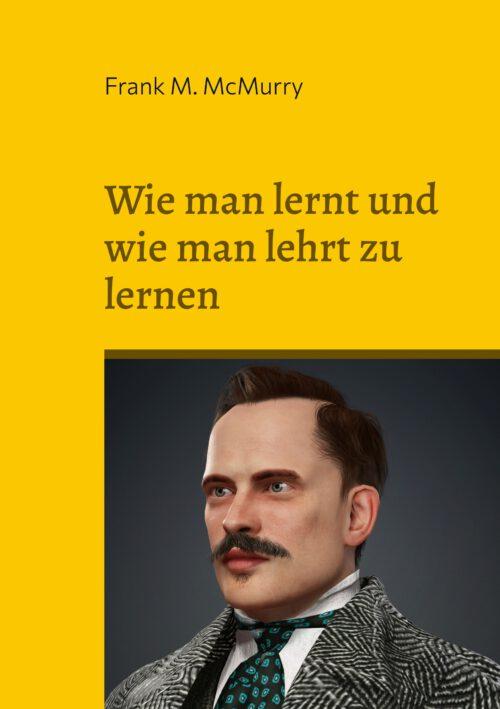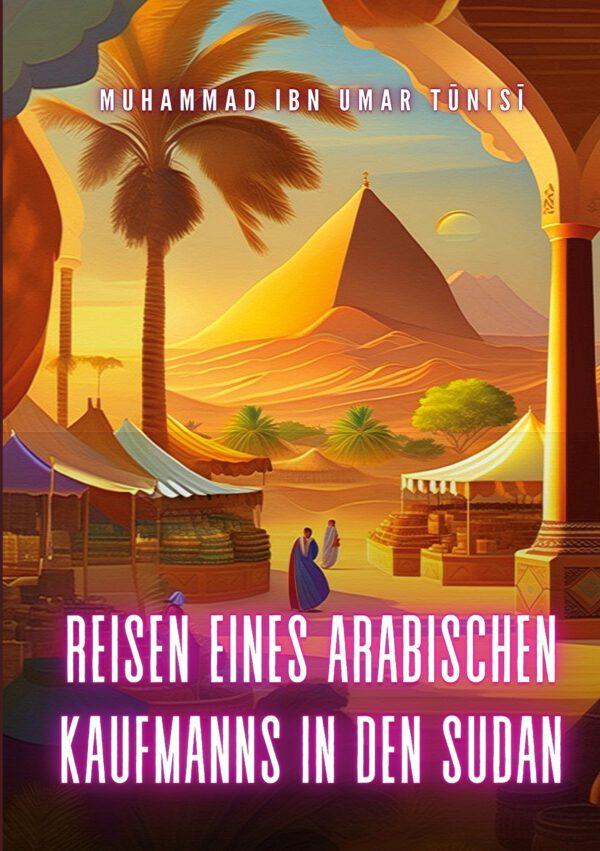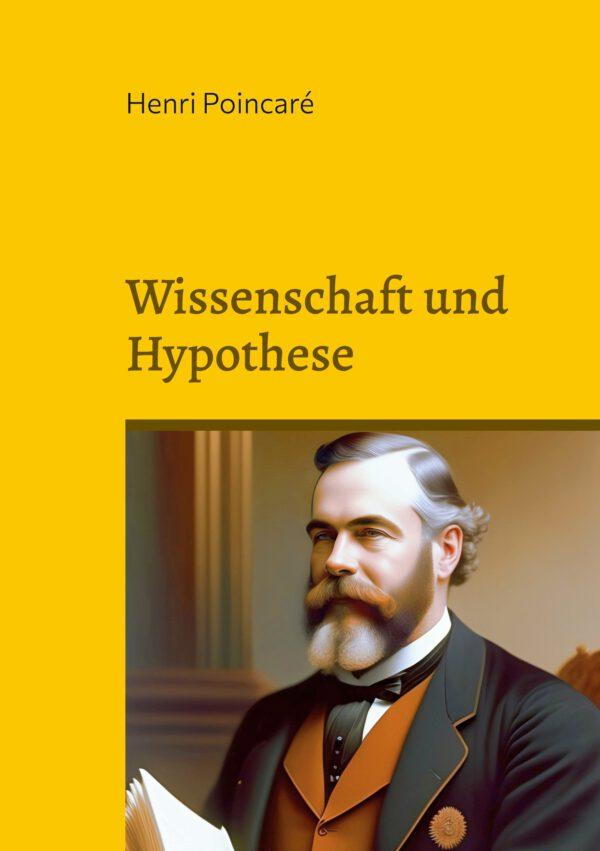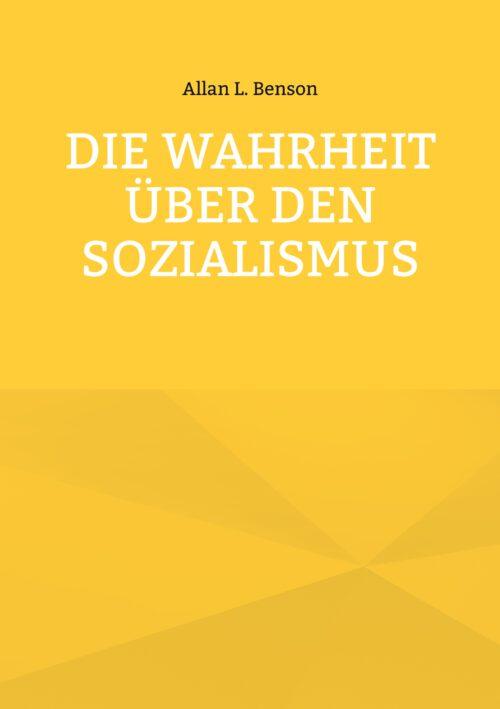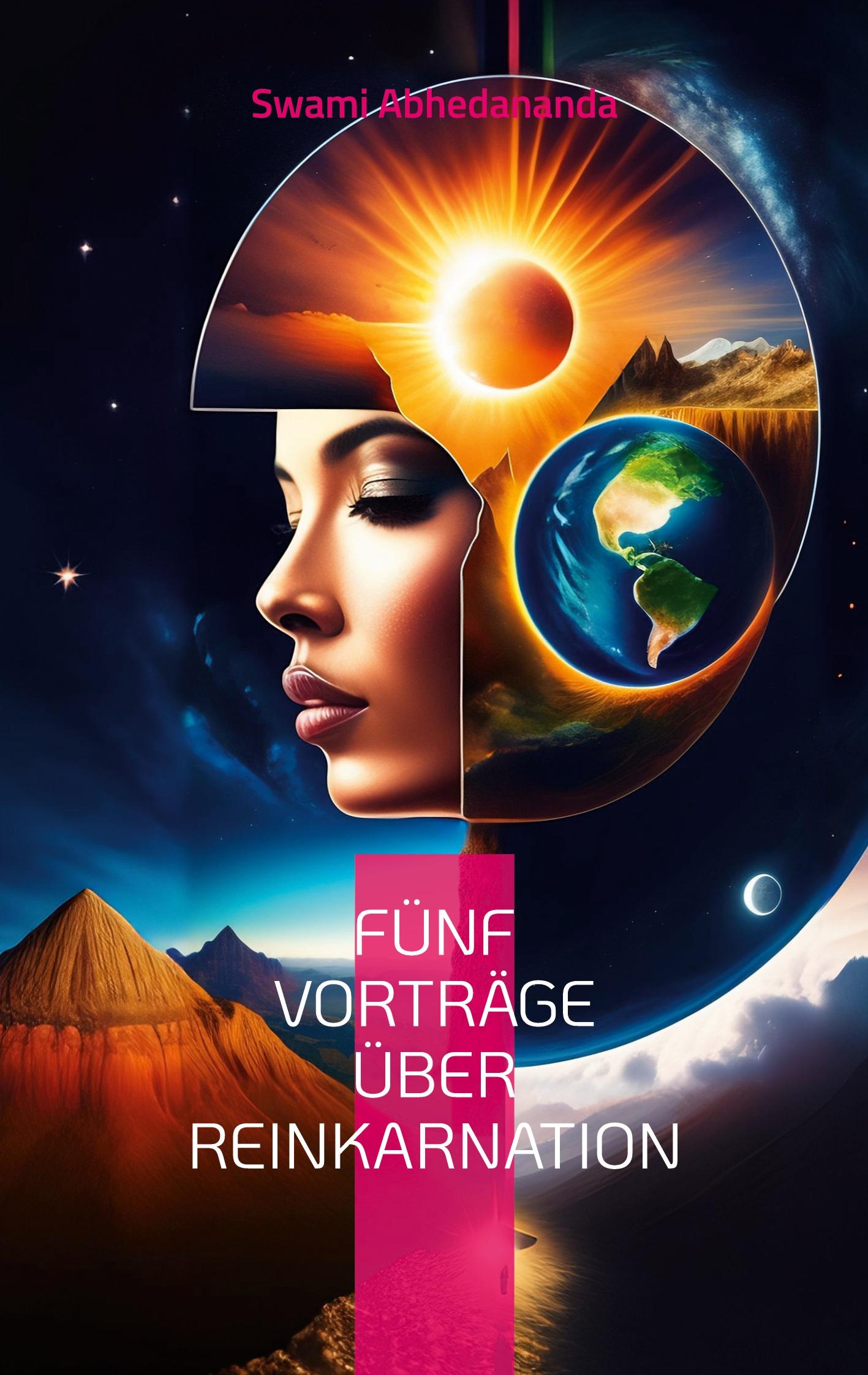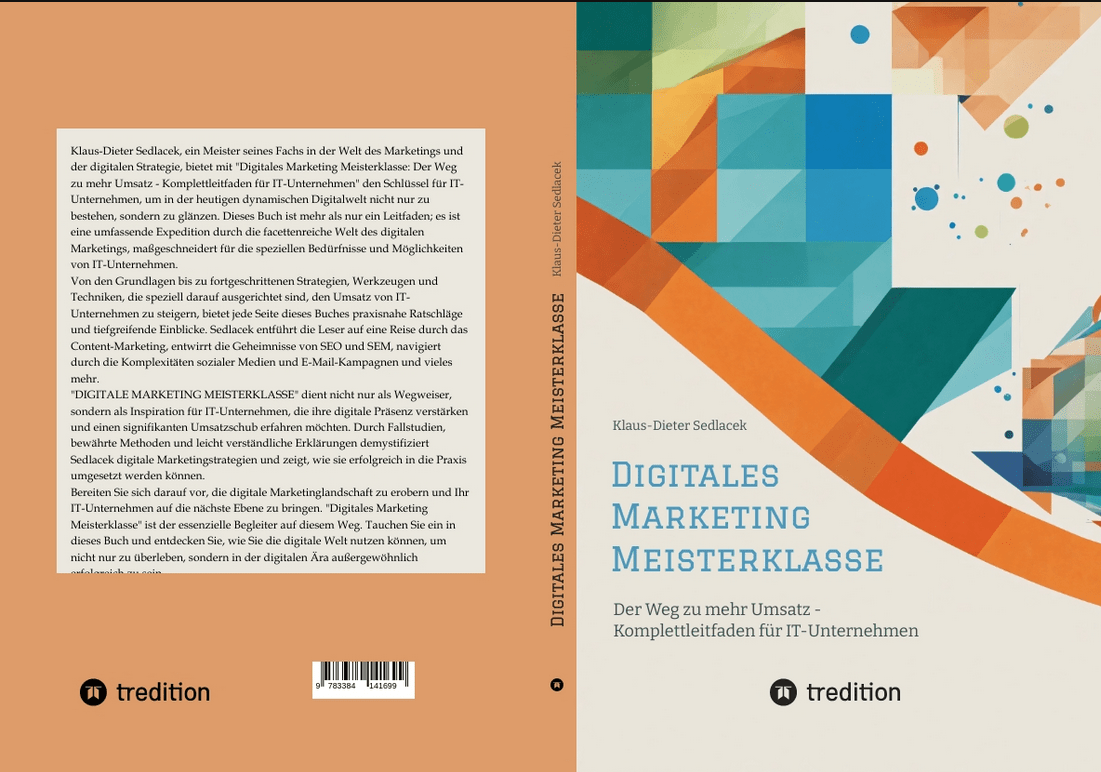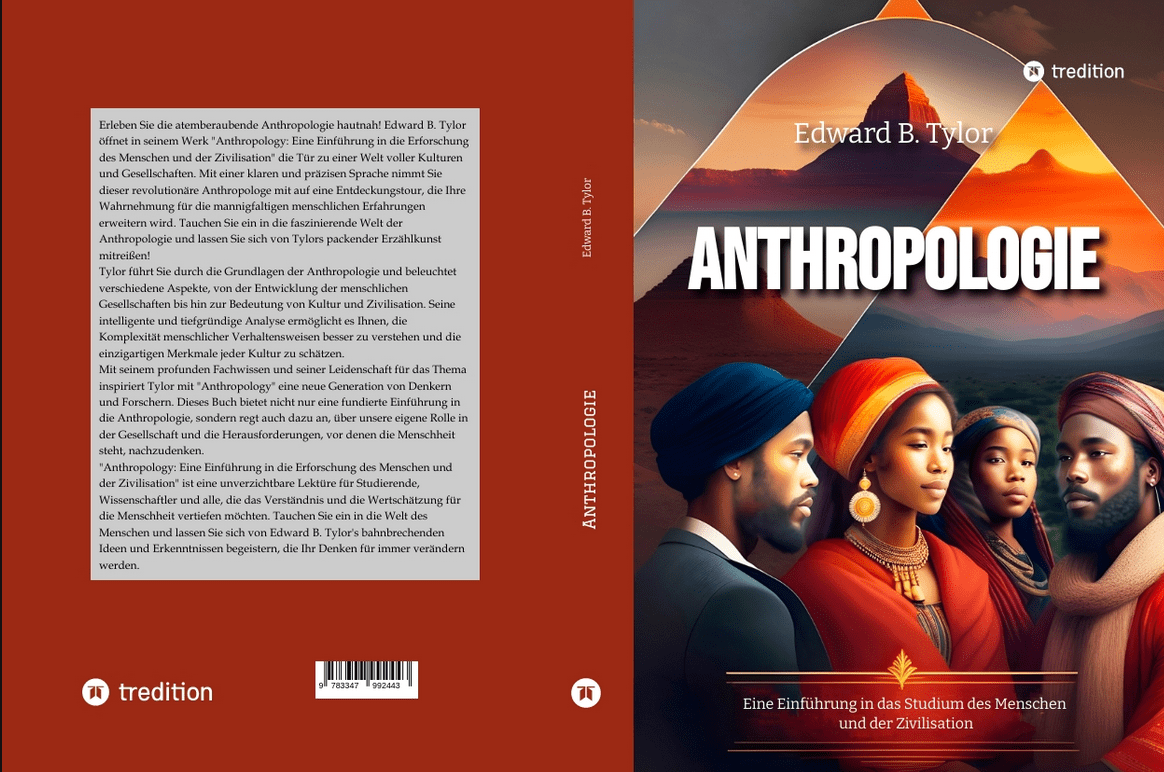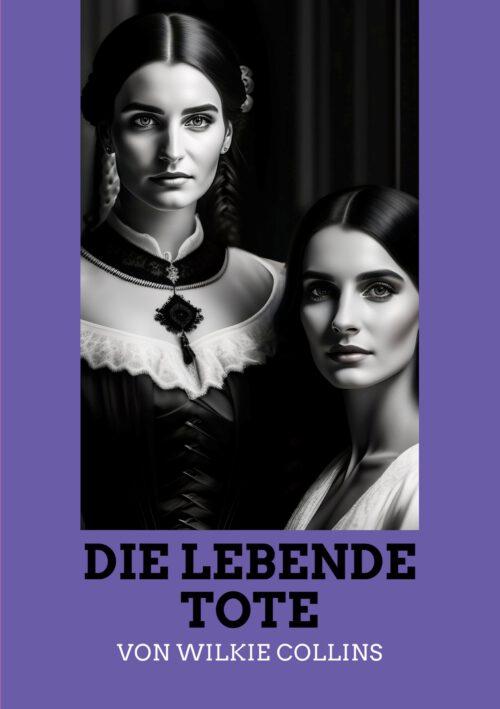Dialekte sind ein fester Bestandteil der deutschen Sprachlandschaft und prägen die regionale Identität. In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Mundarten, die sich nicht nur in ihrer Aussprache, sondern auch im Wortschatz und in der Grammatik unterscheiden. Diese Unterschiede können jedoch zu Missverständnissen führen, insbesondere wenn Menschen aus verschiedenen Regionen miteinander kommunizieren. So können beispielsweise die Dialekte zwischen Kiel im Norden und Konstanz im Süden erhebliche Hürden für die Verständigung darstellen.
Die Reihe „So geht Mundart“ bietet eine wertvolle Unterstützung, um diese Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden. Sie richtet sich an Menschen, die aus verschiedenen Teilen Deutschlands stammen – sei es Bayern, Sachsen, Franken oder Baden – und die sich in ihrer jeweiligen Mundart besser verständigen möchten. Der Fokus liegt nicht nur auf der Vermittlung von Dialektkenntnissen, sondern auch auf dem Verständnis für die kulturellen Hintergründe, die mit den verschiedenen Sprachvarianten verbunden sind.
In Deutschland ist die Vielfalt der Dialekte beeindruckend. Jeder Dialekt erzählt eine eigene Geschichte und spiegelt die Region wider, aus der er stammt. Während die Norddeutschen oft plattdeutsche Einflüsse in ihrer Sprache hören, zeichnen sich die Süddeutschen durch ihre melodischen und oft als „weich“ empfundenen Dialekte aus. Diese Unterschiede können in Gesprächen zu Verwirrung führen, da bestimmte Ausdrücke oder Redewendungen in einer Region gängig sind, in einer anderen jedoch unbekannt oder sogar missverständlich sein können.
Ein Beispiel für solche Missverständnisse ist das Wort „Semmel“. In Bayern und Teilen Baden-Württembergs wird damit ein Brötchen bezeichnet, während man im Norden Deutschlands einfach von einem „Brötchen“ spricht. Solche Begriffe können, wenn sie in einem Gespräch verwendet werden, dazu führen, dass der Gesprächspartner nicht versteht, worum es geht. Hier setzt die Initiative „So geht Mundart“ an und bietet einen Rahmen, in dem die Teilnehmer lernen, sich in den unterschiedlichen Dialekten besser zurechtzufinden.
Die Serie hat nicht nur das Ziel, die sprachlichen Barrieren zu reduzieren, sondern auch das Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt in Deutschland zu fördern. Die Kenntnisse über Dialekte können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und das Verständnis füreinander zu stärken. Durch die Auseinandersetzung mit den regionalen Eigenheiten wird den Teilnehmern nicht nur die Sprache nähergebracht, sondern auch die Lebensweise und die Traditionen der jeweiligen Region.
Darüber hinaus wird in der Reihe auch die Bedeutung der Mundart für die Identität der Menschen behandelt. Dialekte sind oft eng mit der Heimat und den Wurzeln der Sprecher verbunden. Sie sind ein Ausdruck der Zugehörigkeit und des Stolzes auf die eigene Region. Die Fähigkeit, in der eigenen Mundart zu sprechen, kann ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen aus der gleichen Region schaffen. Die Veranstaltungen und Workshops von „So geht Mundart“ bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, sich in ihrer Muttersprache auszudrücken und gleichzeitig die Dialekte anderer Regionen kennenzulernen.
Insgesamt trägt die Reihe „So geht Mundart“ dazu bei, den interregionalen Austausch zu fördern. Sie bietet eine Plattform, um die Unterschiede der Dialekte zu erkunden und die Schönheit der sprachlichen Vielfalt in Deutschland zu feiern. Durch die Vermittlung von Dialektkenntnissen wird die Kommunikation zwischen den verschiedenen Regionen erleichtert und das Verständnis füreinander gestärkt.
In einer zunehmend vernetzten Welt ist es wichtig, auch die sprachlichen Unterschiede zu respektieren und zu verstehen. Dialekte sind nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern auch ein Teil der kulturellen Identität. Die Initiative „So geht Mundart“ leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dass Menschen über regionale Grenzen hinweg miteinander ins Gespräch kommen und die Vielfalt der deutschen Sprache schätzen lernen.