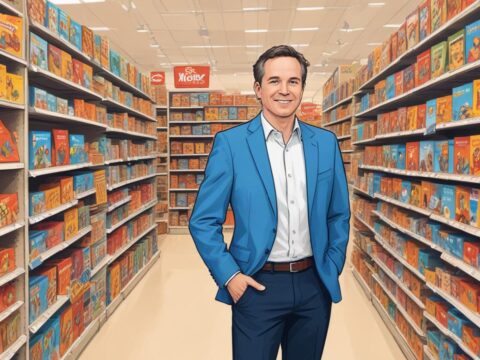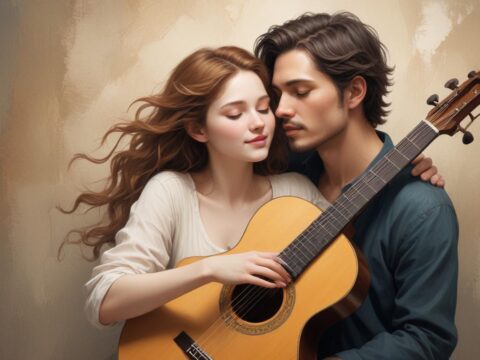In seiner umfassenden Studie „Medikaler Raum in der erzählenden Literatur der DDR“ beschäftigt sich Matthias Aumüller mit den subtilen gesellschaftlichen Hoffnungen, die in der Literatur der DDR verborgen liegen, auch in weniger bekannten Texten. Aumüllers Arbeit ist als dritter Band der Reihe „Medical Humanities“ beim Schwabe Verlag erschienen und untersucht die Darstellung medikaler Räume in den Werken von DDR-Autoren, darunter Romane, Erzählungen und Reportagen. Die Studie ist aus einem Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds hervorgegangen und präsentiert sich als tiefgreifende Analyse, die sowohl literaturtheoretische als auch narratologische Ansätze integriert.
Im ersten Teil seiner Arbeit legt Aumüller die theoretischen Grundlagen dar und erläutert die narratologischen Kategorien, die er in den folgenden Analysen anwendet. Dabei fokussiert er auf den Aspekt des Raums in der Erzählung, der im Vergleich zur Zeit bisher weniger Beachtung fand. Aumüller argumentiert, dass die Kategorie des Raums aufgrund ihrer interpretationsfähigen Natur komplexer ist, da sie durch sensorische Wahrnehmungen viele Eindrücke vermittelt, während die Zeit nicht auf dieselbe Weise erfasst werden kann. Auf dieser Basis versucht er, den Raum als narratologisches Element zu etablieren und seine Bedeutung in der Literatur herauszustellen.
Ein zentrales Beispiel in Aumüllers Untersuchung ist Christa Wolfs Roman „Nachdenken über Christa T.“, in dem die Protagonistin an Leukämie leidet. Aumüller analysiert hier den Zusammenhang von Erzählzeit und Raum und stellt fest, dass dem neuen Wohnhaus der Figur mehr narrative Zeit zugeschrieben wird als den Krankenhäusern, in denen sie einen bedeutenden Teil ihres Lebens verbringt. Diese Beobachtung eröffnet verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die Aumüller in seiner Analyse weiter vertieft. Insbesondere sieht er die Vernachlässigung der medikalen Räume als eine bewusste Entscheidung, die versucht, die pathologischen Aspekte zu minimieren und stattdessen die häusliche Umgebung der Protagonistin zu betonen.
Im weiteren Verlauf seiner Analyse untersucht Aumüller die Entwicklung der medikalen Räume in der DDR-Literatur über verschiedene Phasen hinweg. Er identifiziert vier wesentliche Entwicklungsphasen: die Aufbauphase des Sozialismus bis 1961, die Phase des wissenschaftlich-technischen Aufschwungs nach dem Mauerbau, eine Phase der politischen Desillusionierung nach dem Prager Frühling und eine letzte Phase, die von wirtschaftlichem Niedergang geprägt ist. Jede dieser Phasen spiegelt sich in der Darstellung von medikalen Räumen wider, die zunehmend als Symbole für den ideologischen Zustand der DDR interpretiert werden können.
Besonders interessant ist Aumüllers Betrachtung des Romans „Besiegte Schatten“ von Hildegard Maria Rauchfuß, der in einem Tuberkulosekrankenhaus spielt. Hier wird der Konflikt zwischen traditionellen Heilmethoden und einem ganzheitlichen Therapieansatz thematisiert. Während in den früheren Texten der DDR die medikalen Räume oft als positiv und optimistisch dargestellt wurden, zeigen spätere Werke eine zunehmende Medikalisierung und eine kritische Reflektion der gesellschaftlichen Zustände.
Der Mauerbau 1961 stellt einen Wendepunkt dar, den Aumüller in der Analyse zweier Romane thematisiert: Christa Wolfs „Der geteilte Himmel“ und J.C. Schwarz’ „Das gespaltene Herz“. Während Wolfs Werk als Rechtfertigung des Mauerbaus interpretiert werden kann, kritisiert Schwarz die Abwerbung ostdeutscher Ärzte durch den Westen und thematisiert die damit verbundenen Herausforderungen.
In den 70er Jahren zeigt sich eine klare Tendenz zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen politischen Vergangenheit, wobei medikale Räume als Schauplätze für diese Reflexionen fungieren. Die Protagonisten in den Romanen von Autoren wie Werner Heiduczek und Stefan Heym nutzen ihre Aufenthalte in den Heilorten, um sich mit ihren Erinnerungen und Verstrickungen in das Regime auseinanderzusetzen.
Aumüller schließt seine Studie mit der Feststellung, dass die Darstellung medikaler Räume in den Texten der 80er Jahre zunehmend düsterer und verfallener wird, was die „Krankheit“ der DDR symbolisiert. Die medikalen Räume fungieren nicht mehr nur als Kulissen, sondern sind tief in die gesellschaftlichen und politischen Probleme der Zeit verwoben.
Durch die innovative Perspektive, die Aumüller einnimmt, werden nicht nur bekannte Werke neu interpretiert, sondern auch weniger beachtete Texte entdeckt,