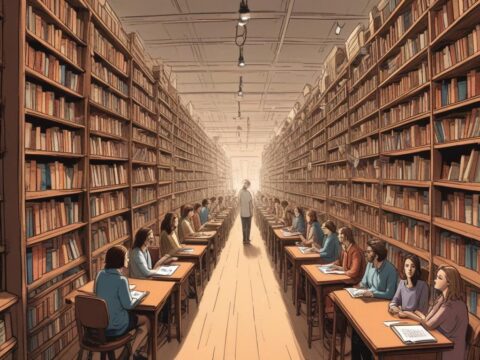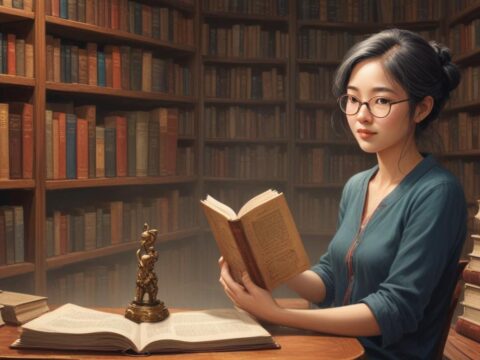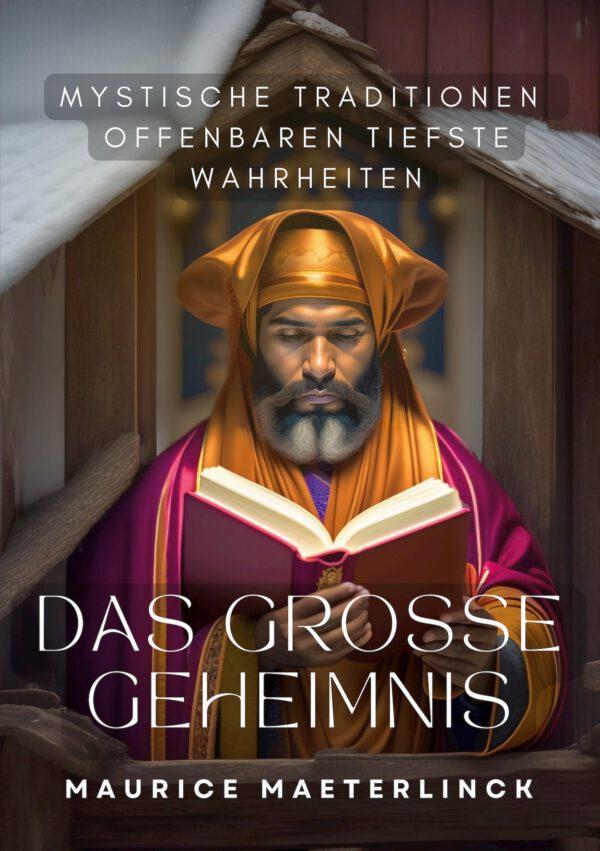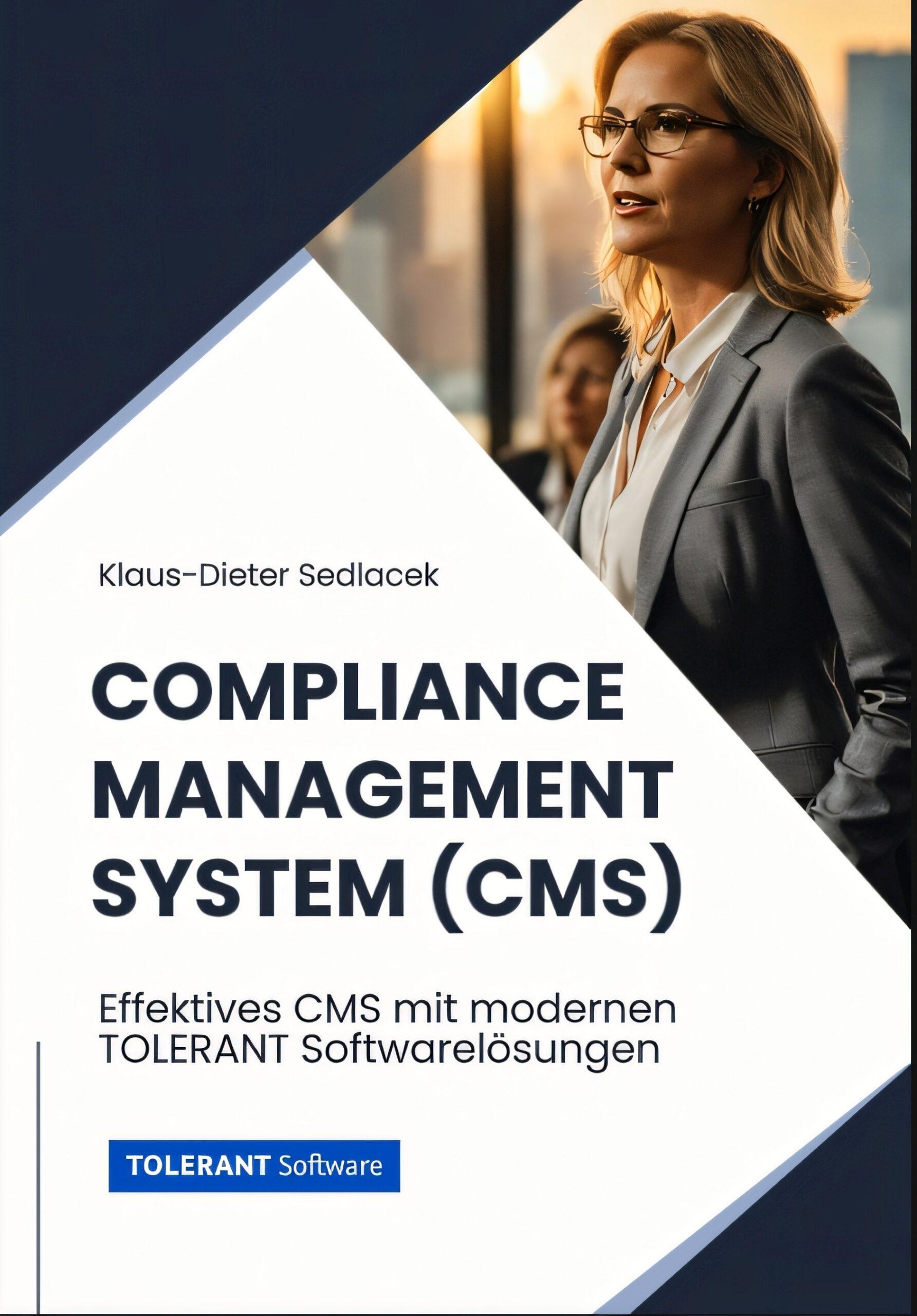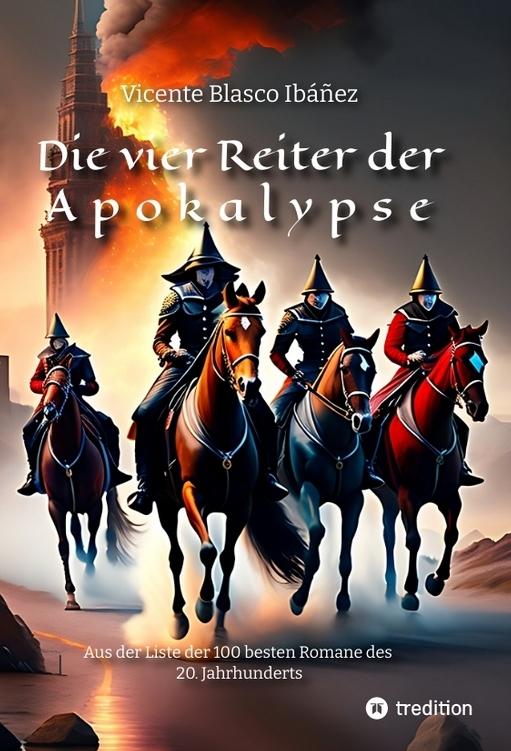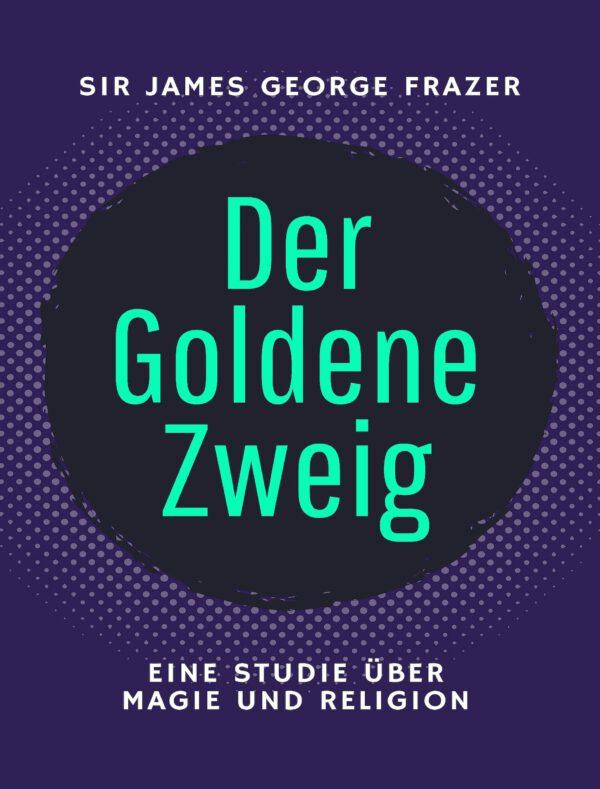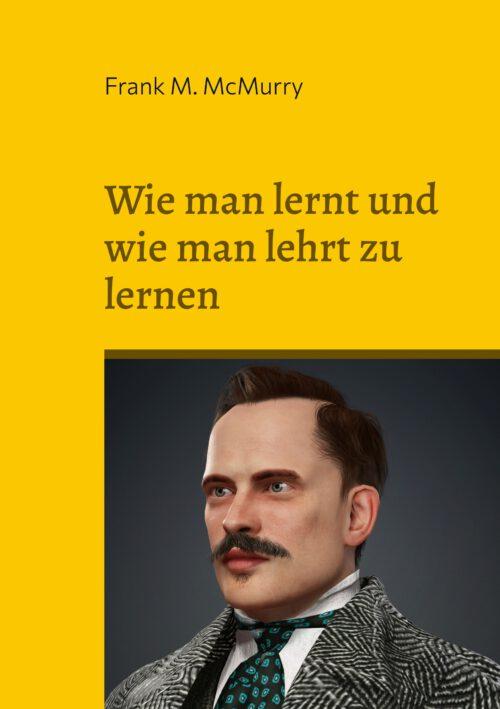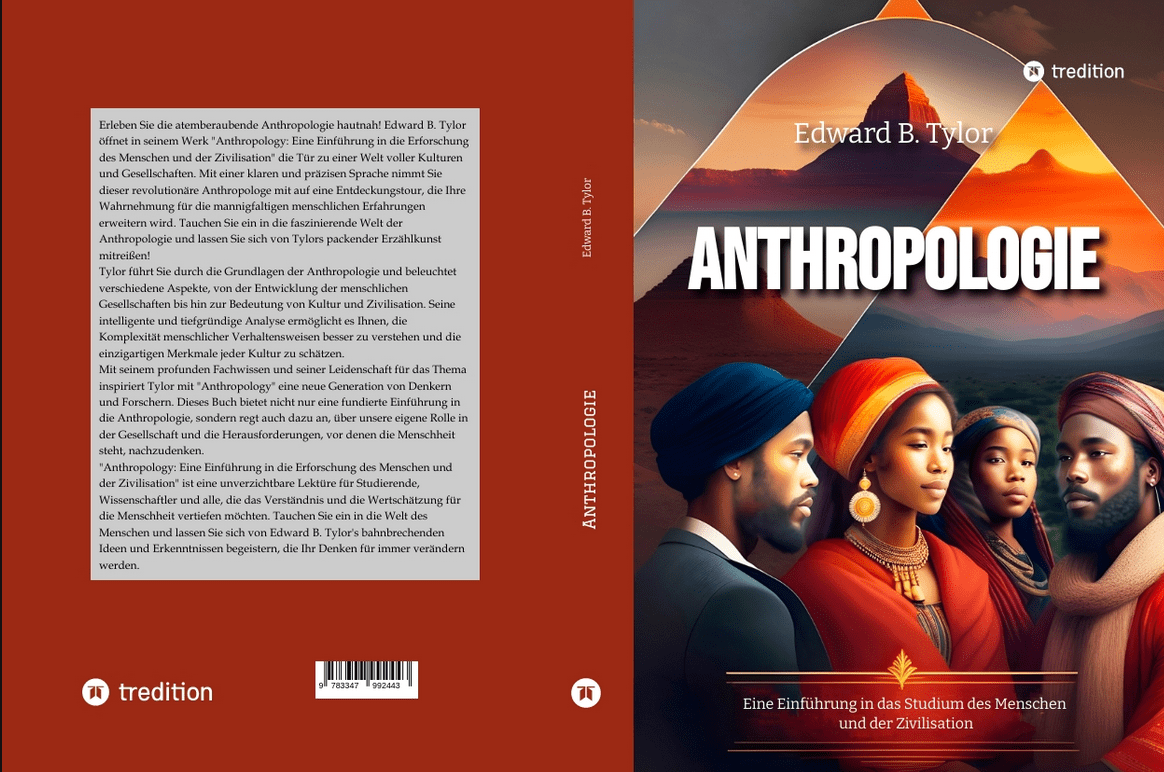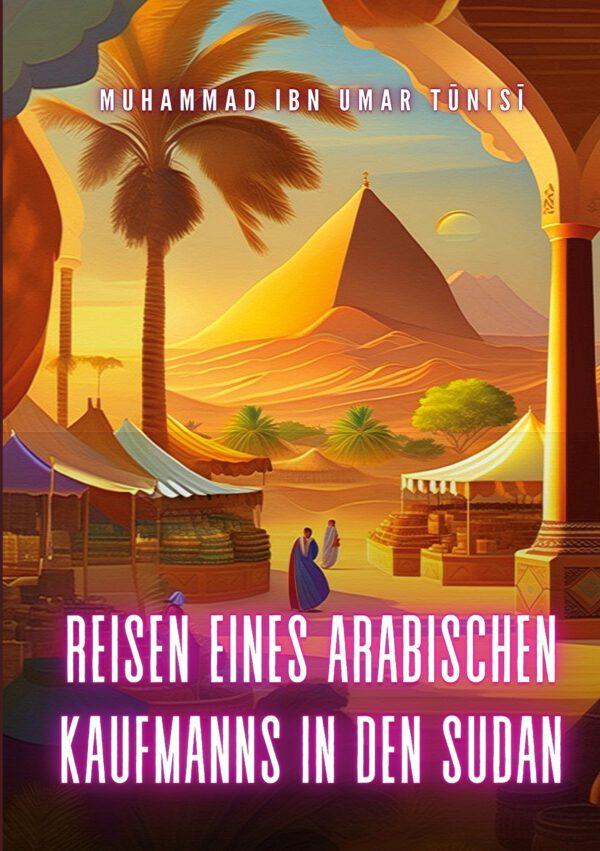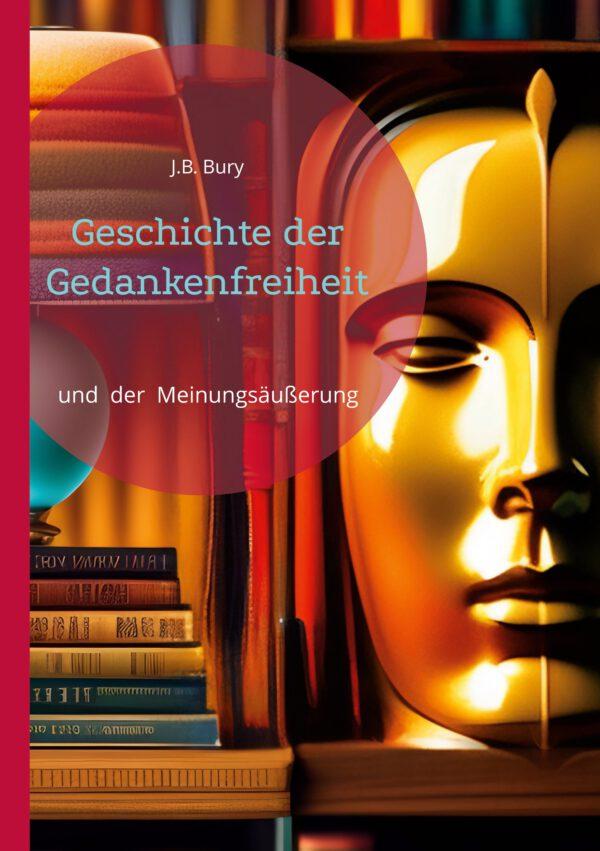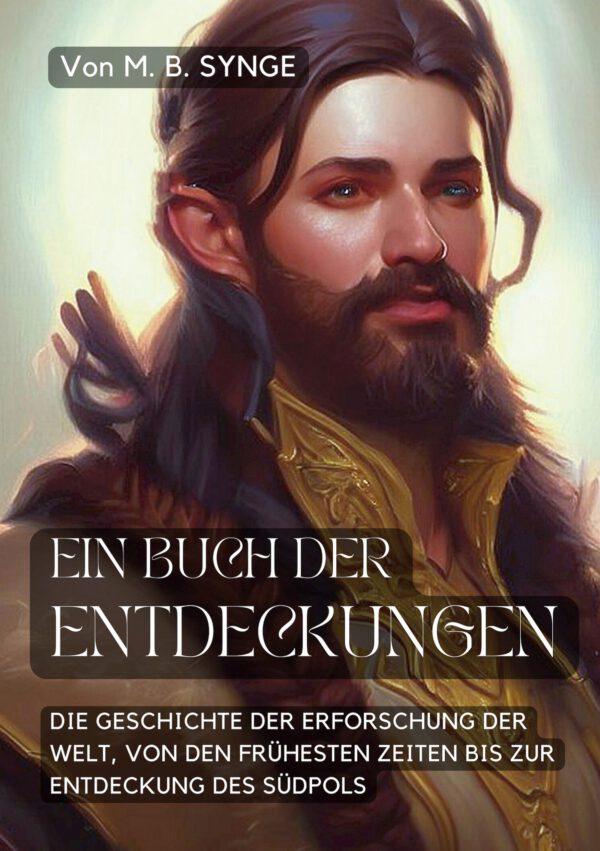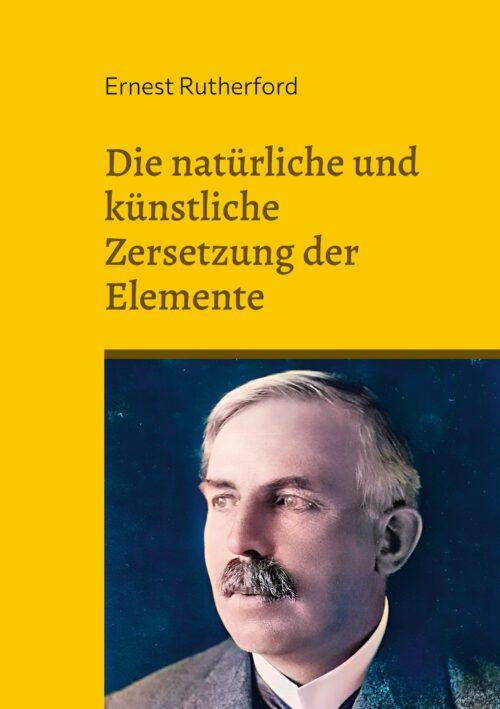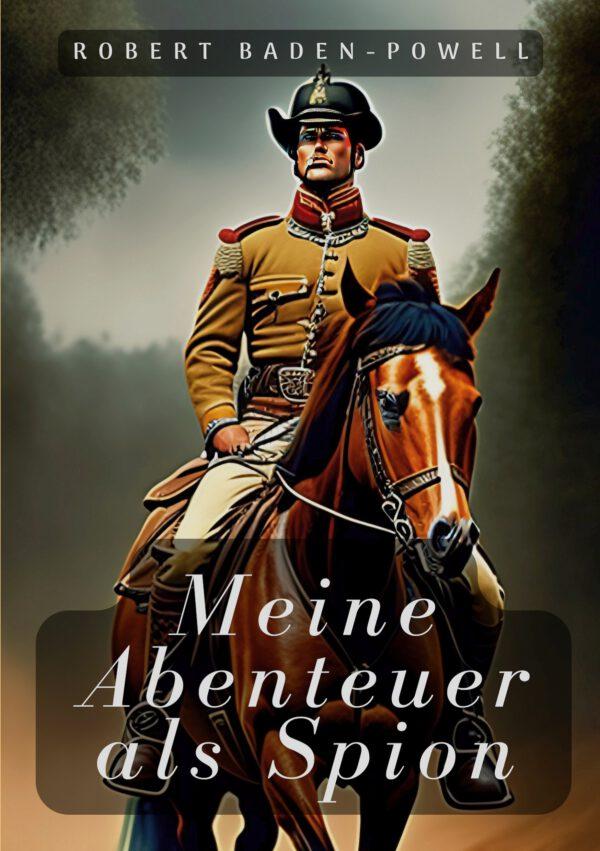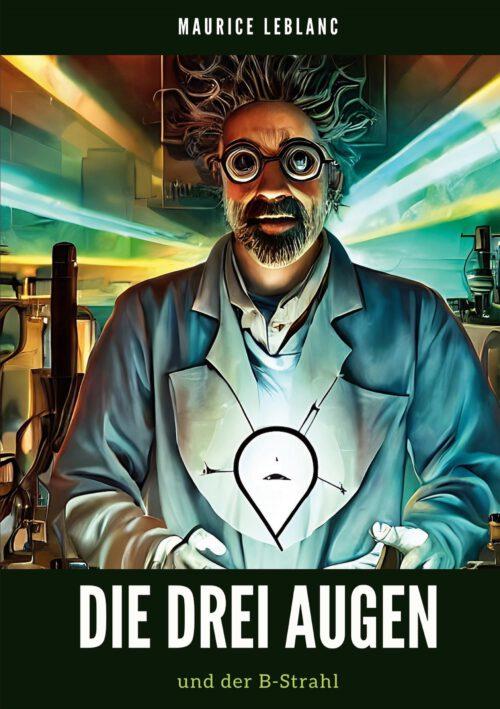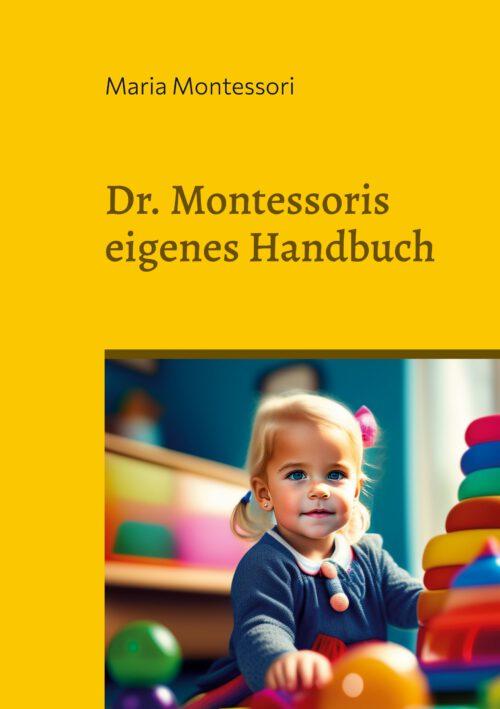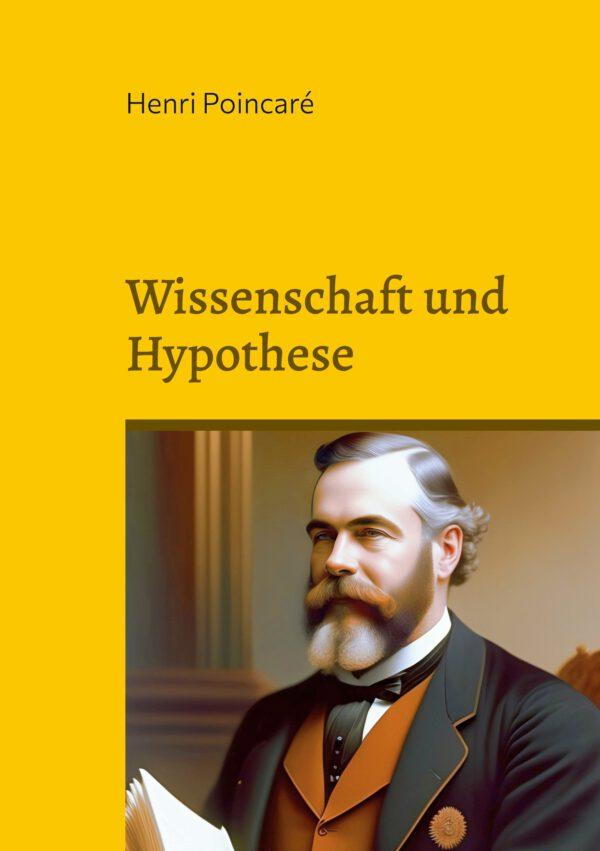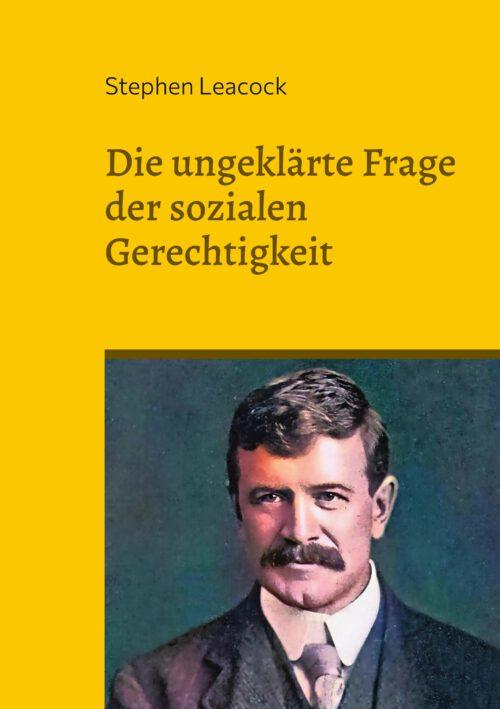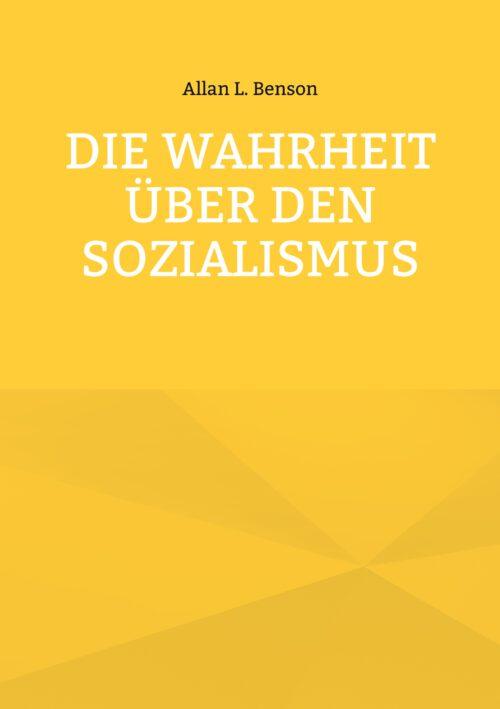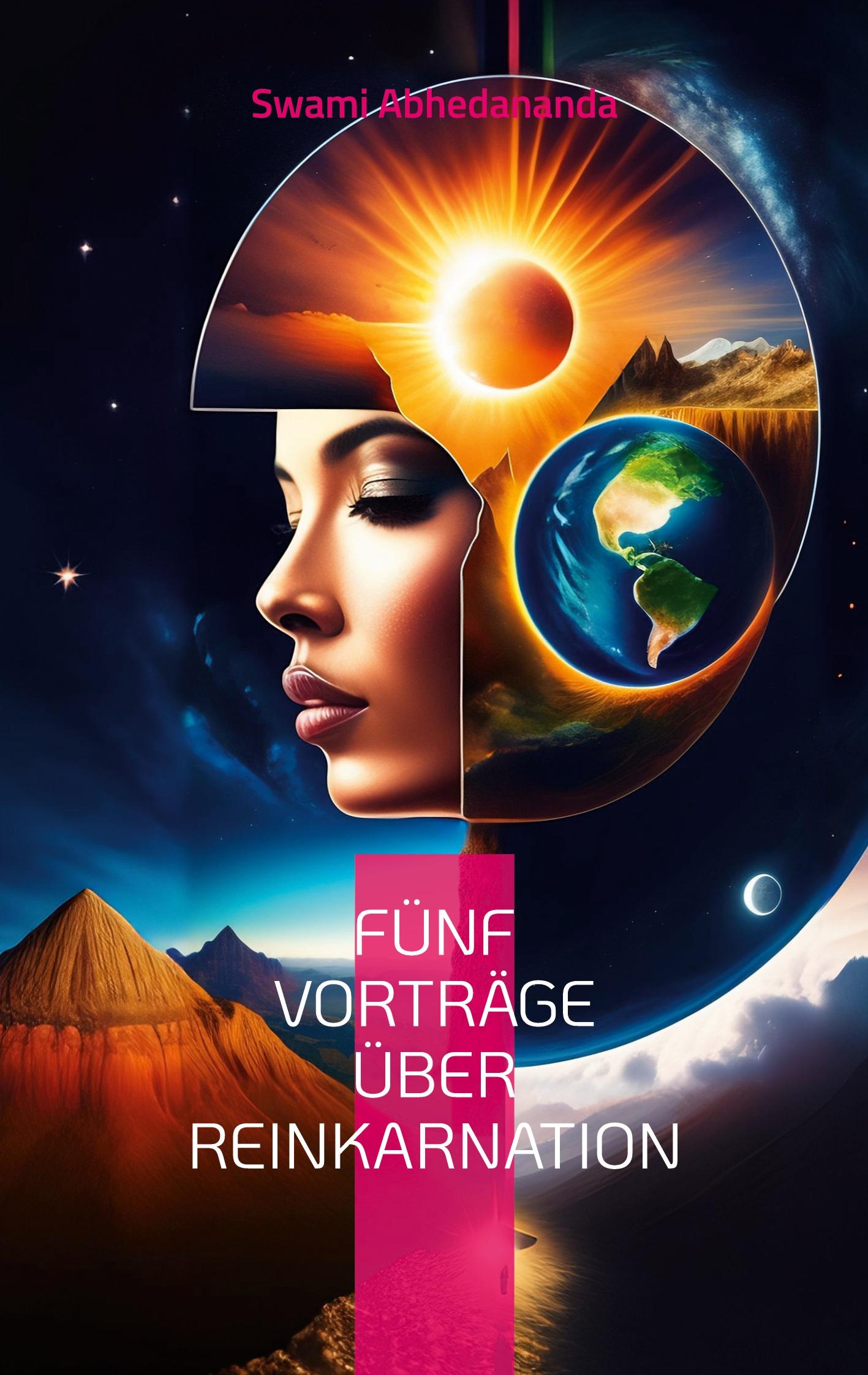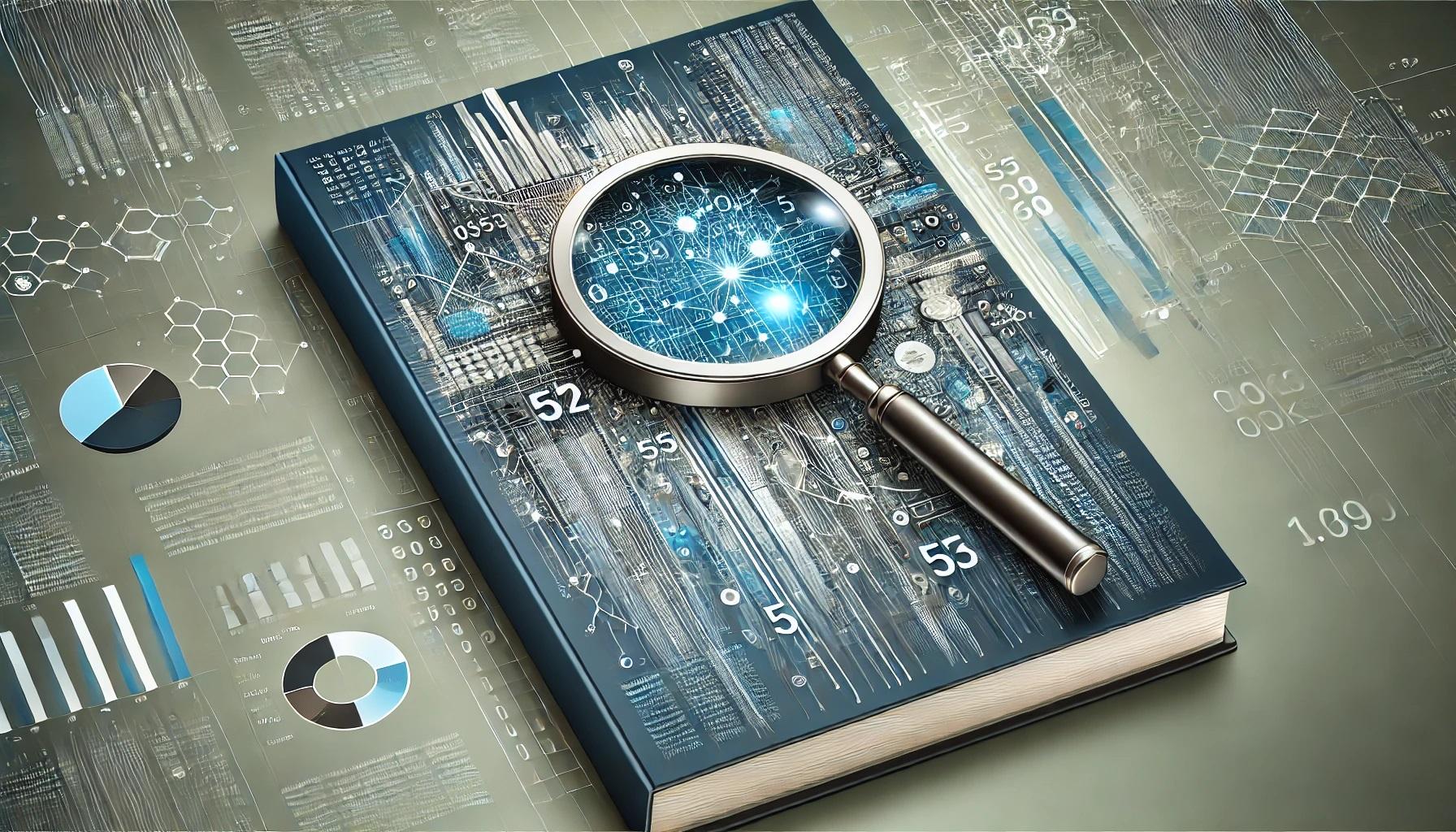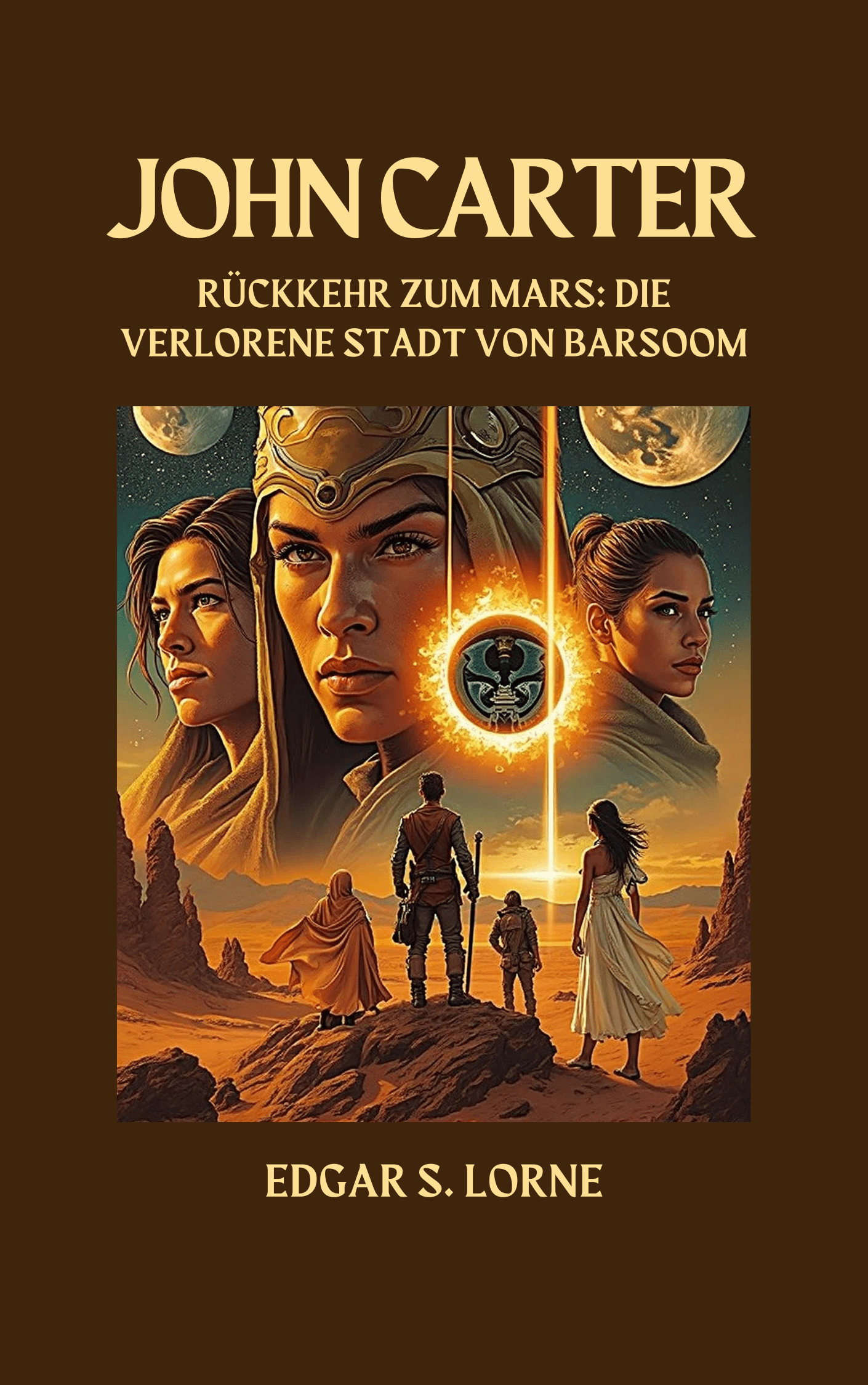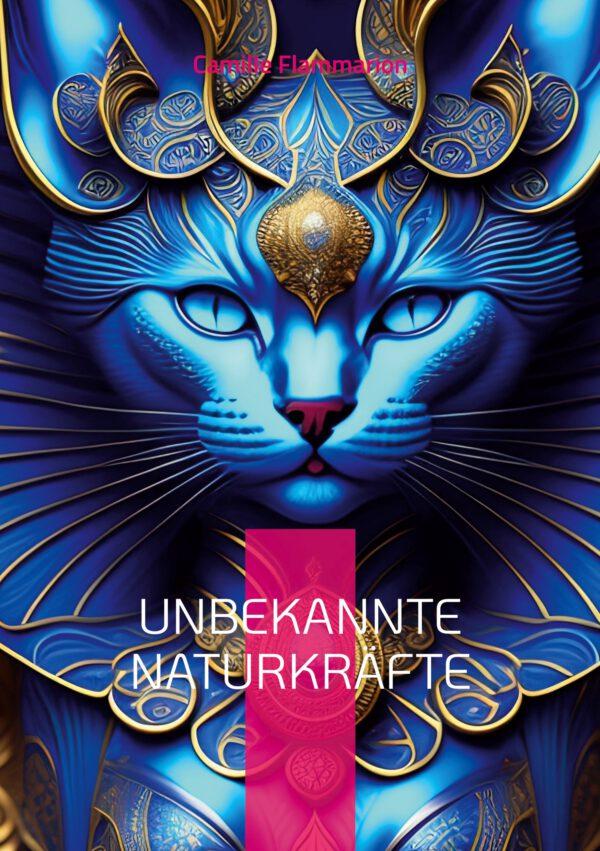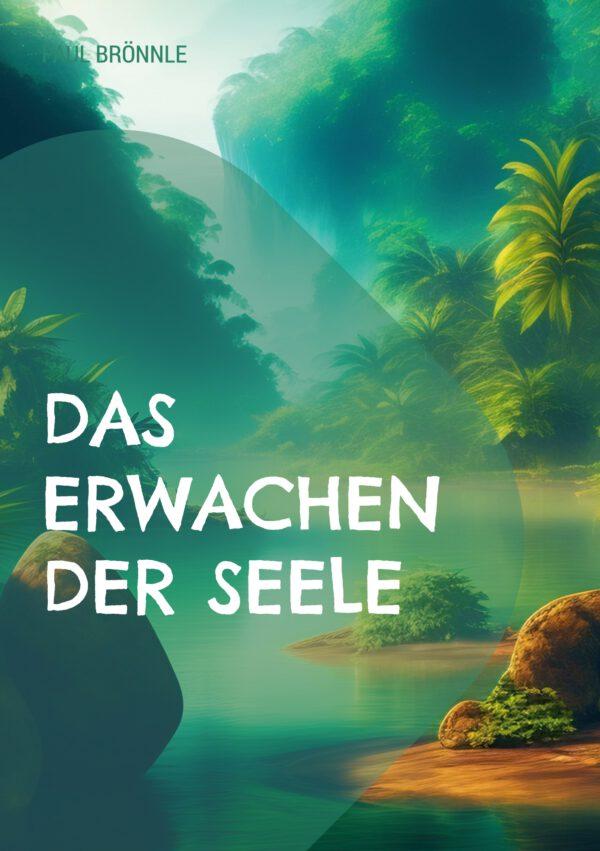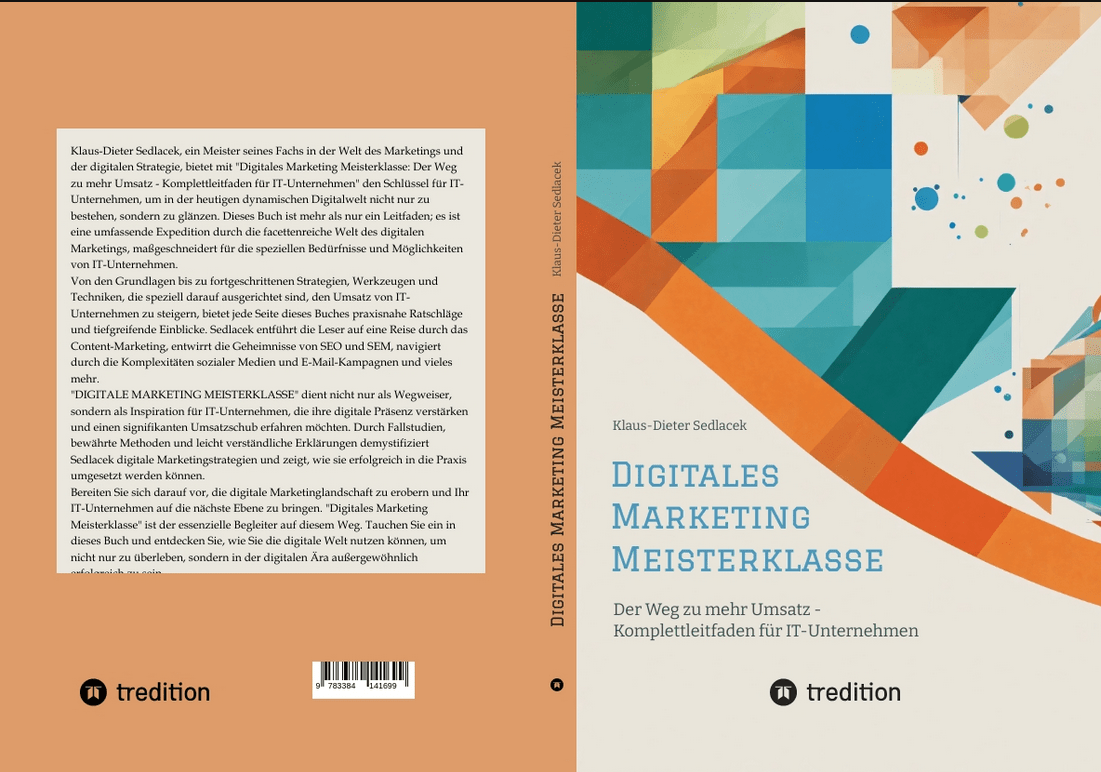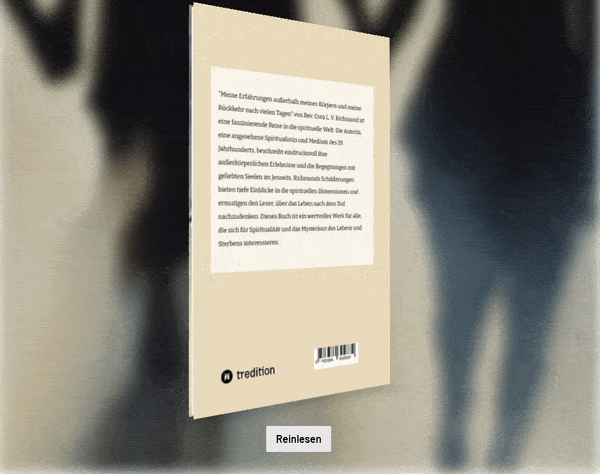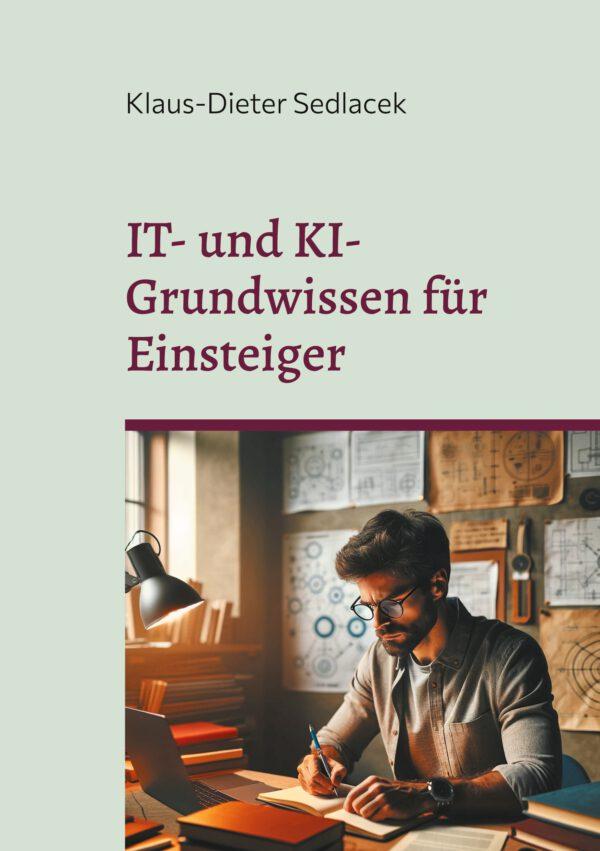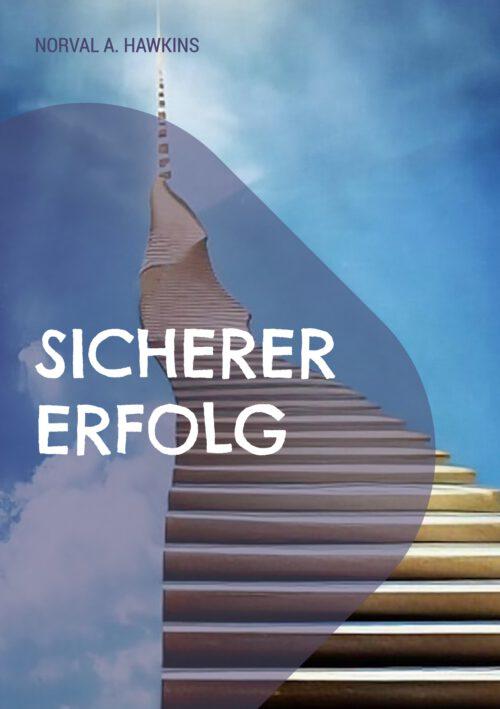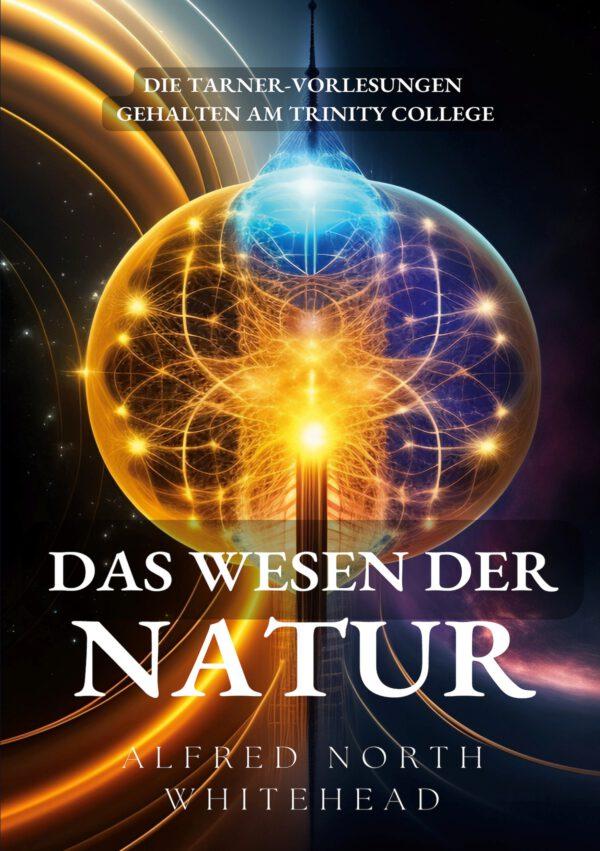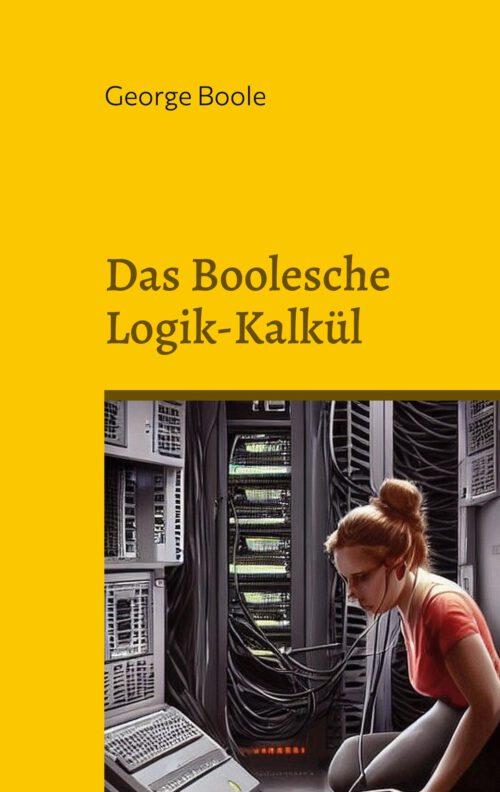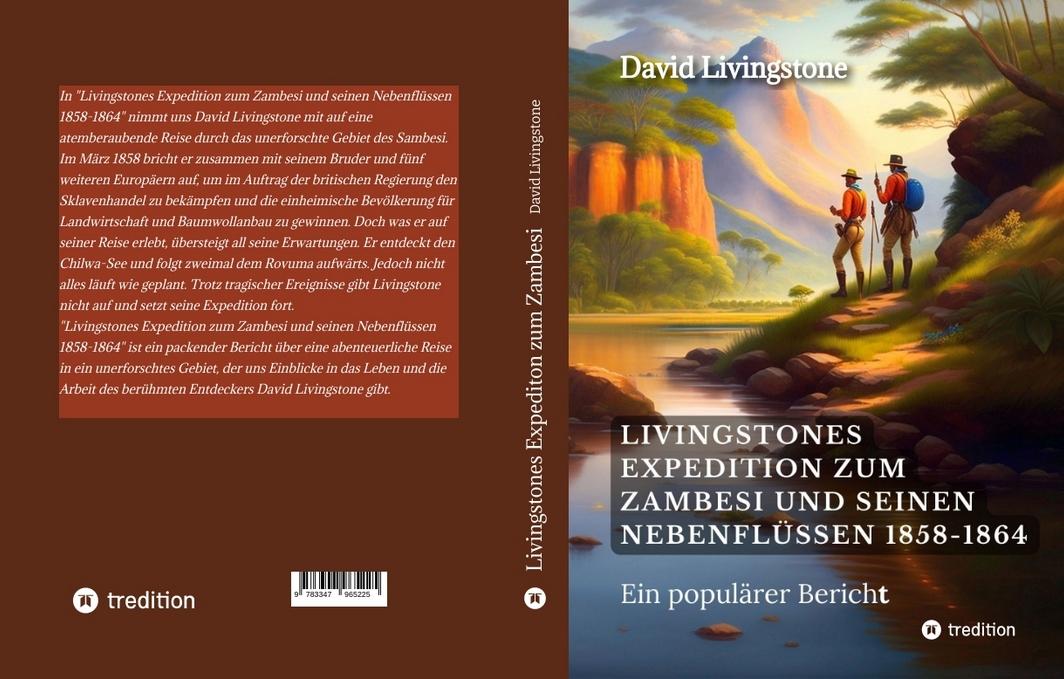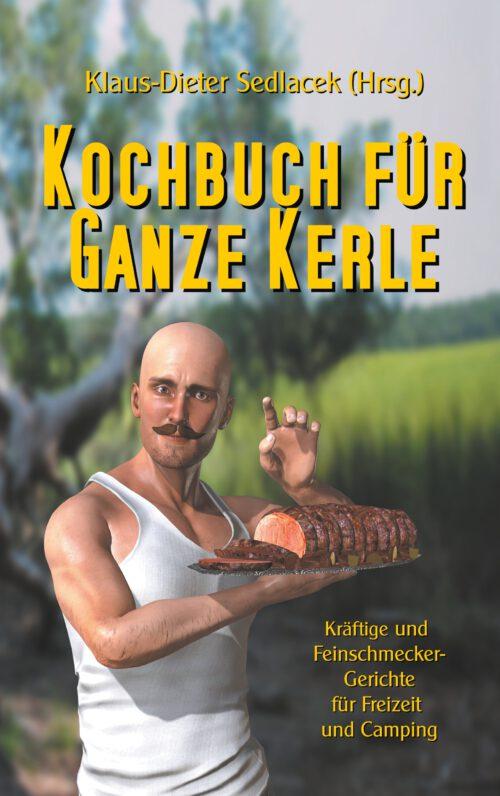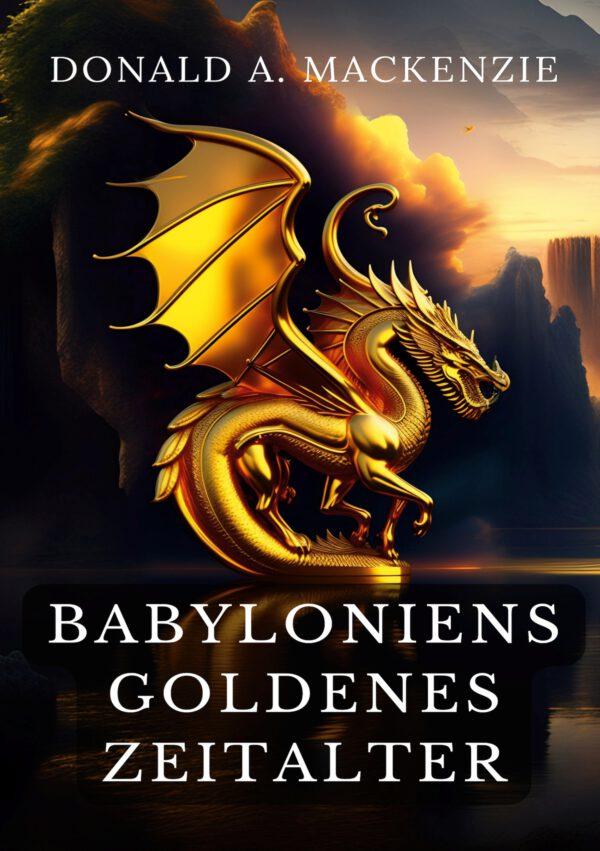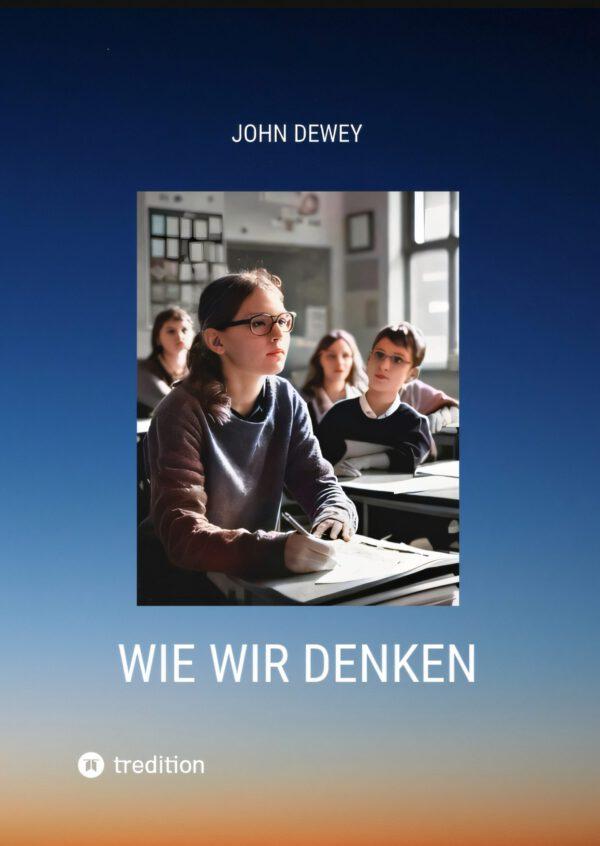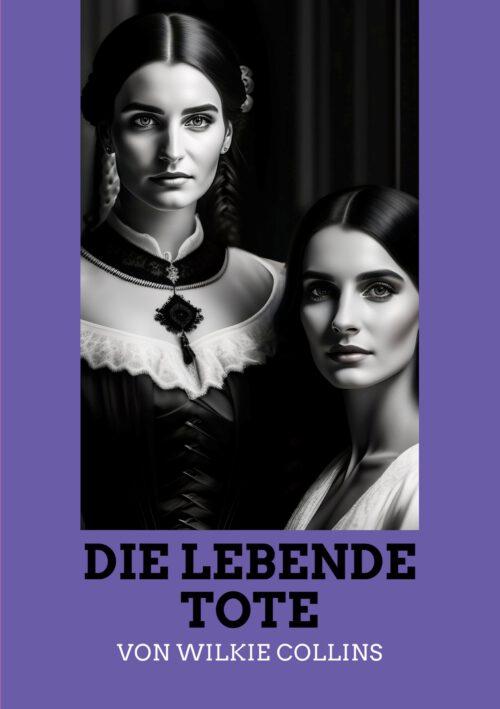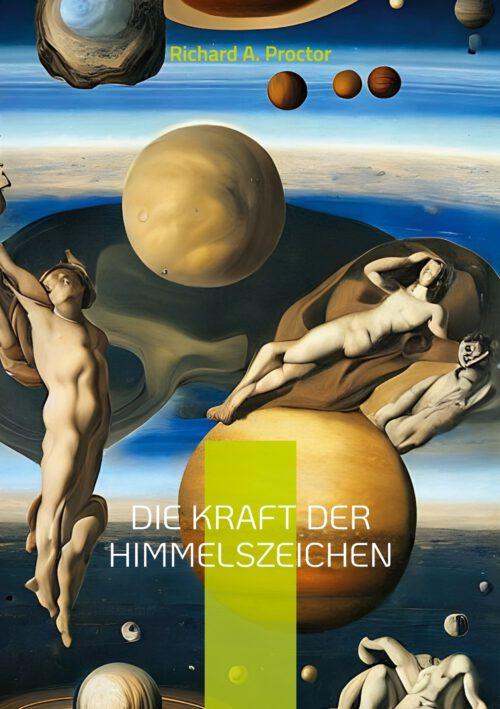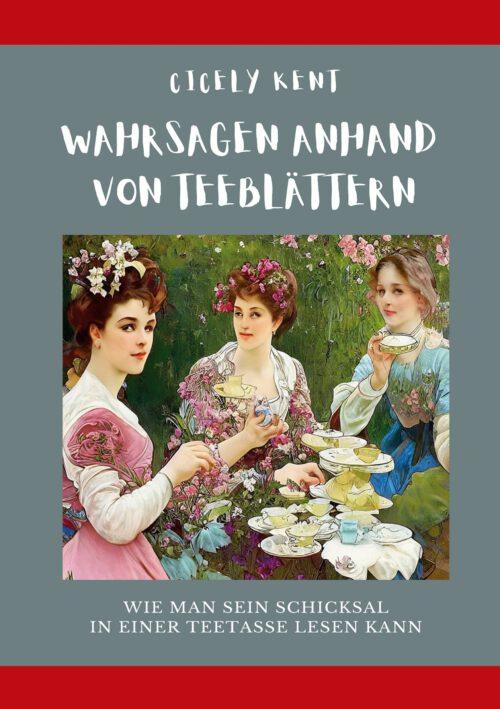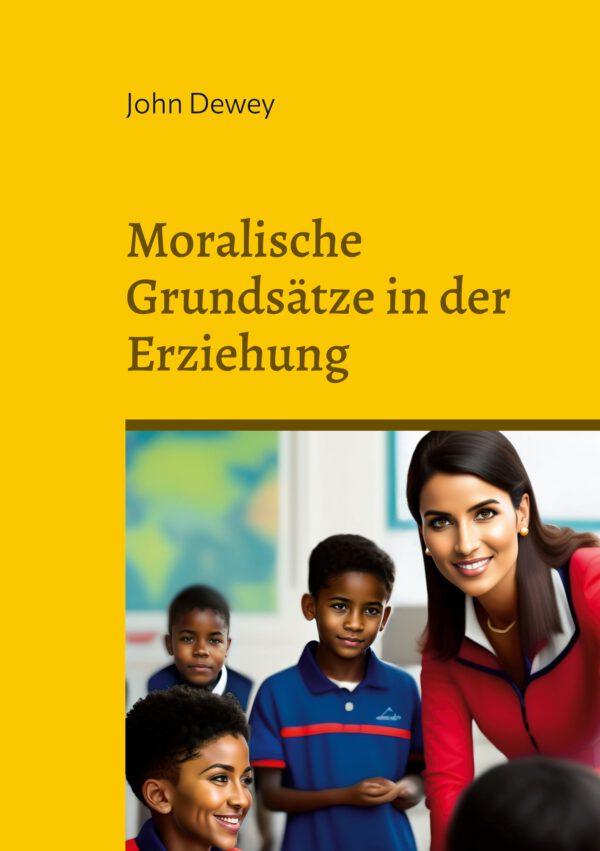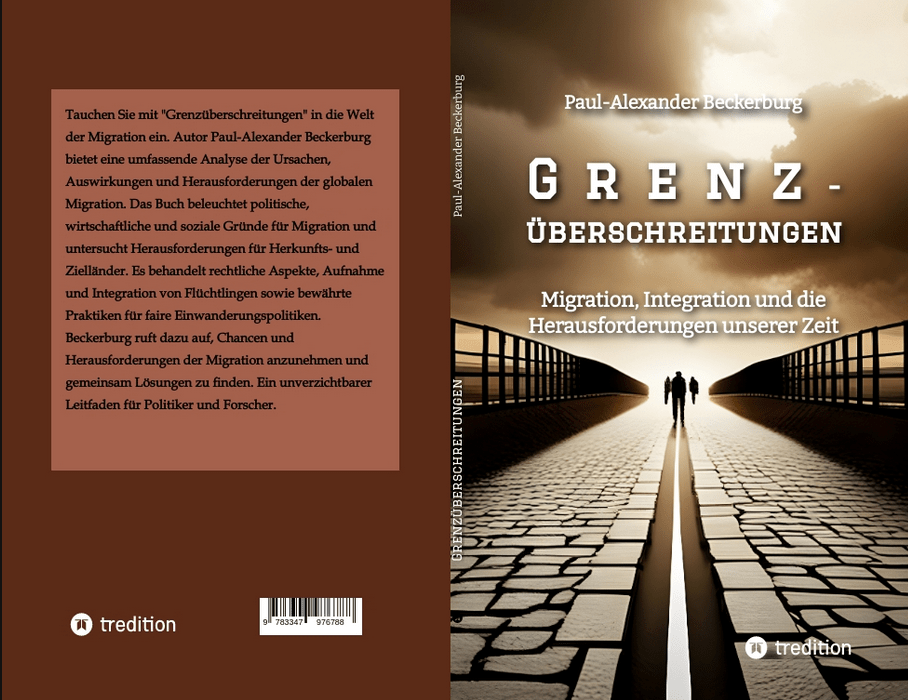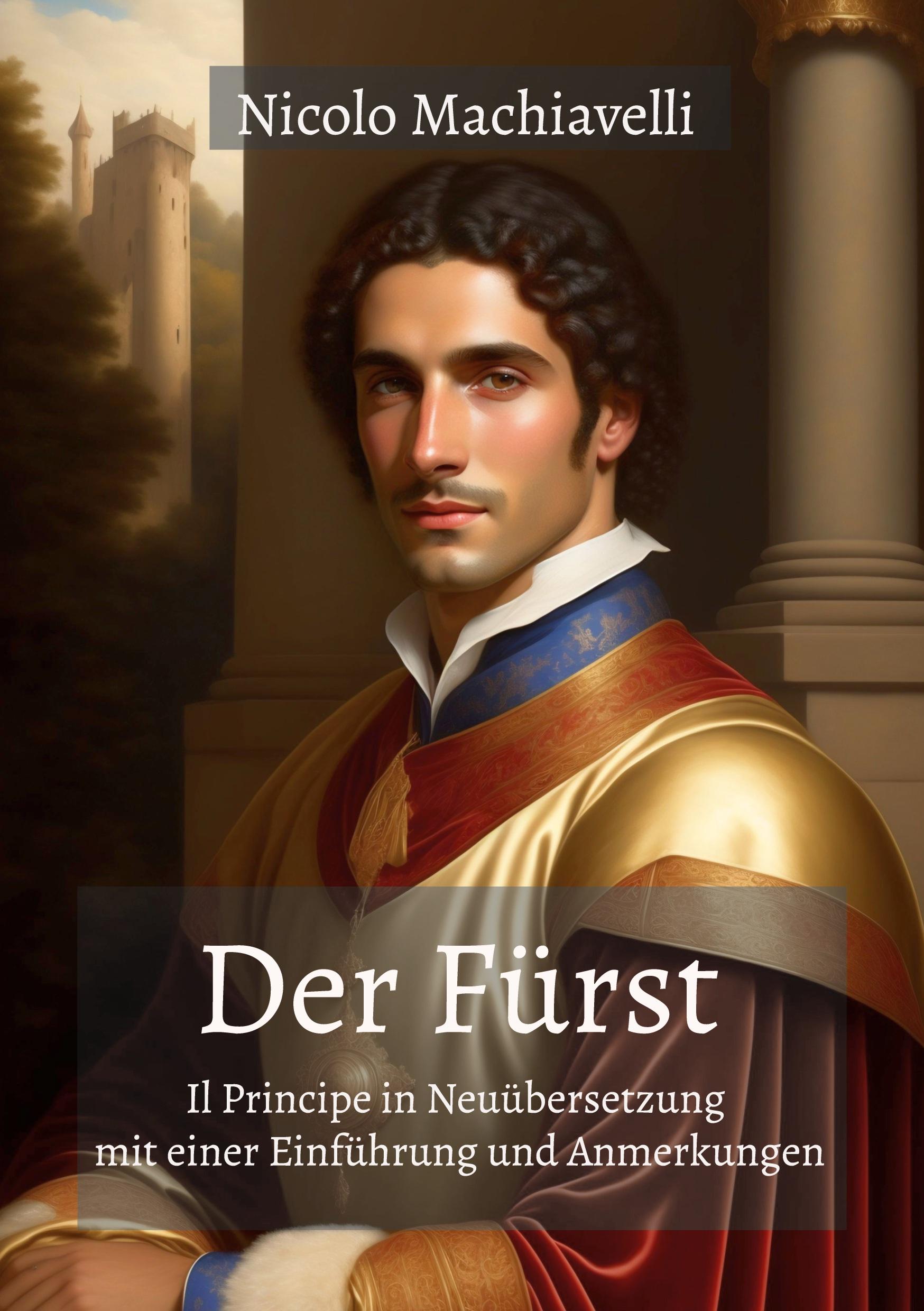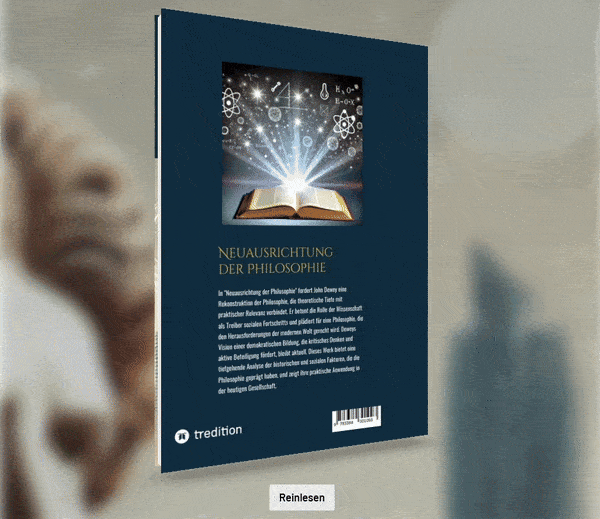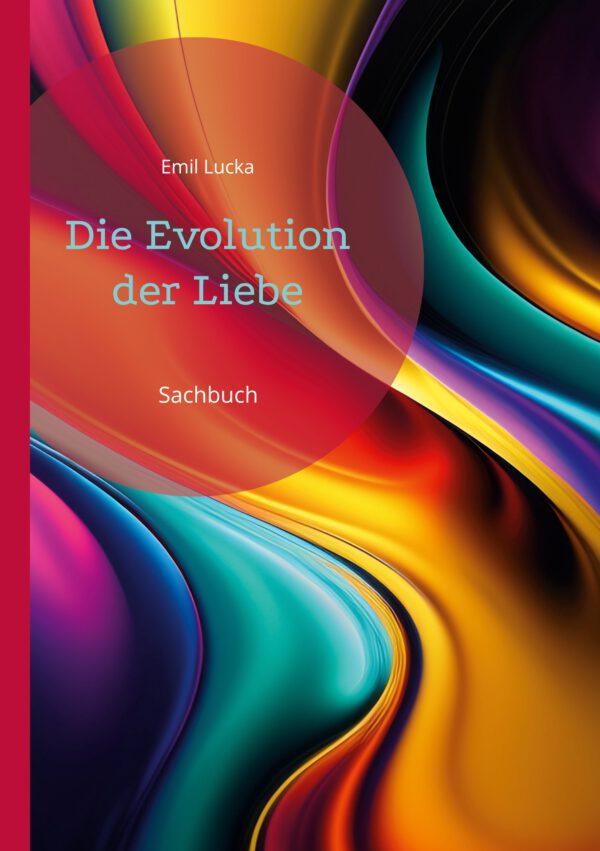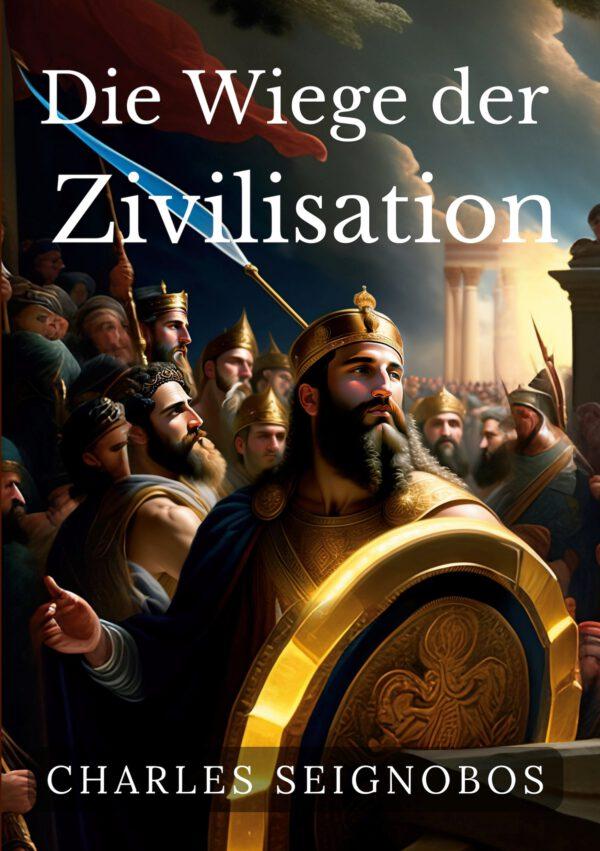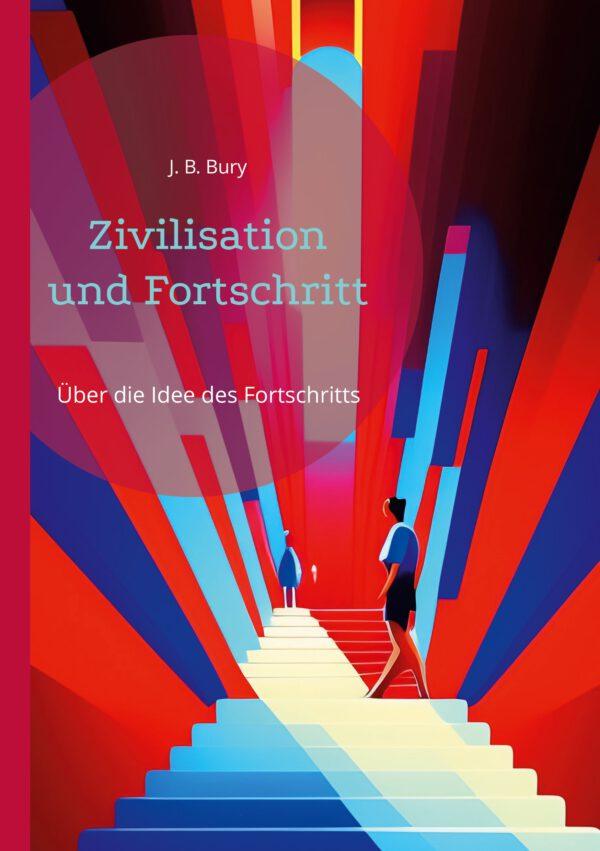Das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu dem Buchtitel „Nie wieder keine Ahnung“ bietet interessante und wichtige Erkenntnisse für die rechtlichen Fragestellungen rund um Titelrechte. Rechtsanwalt Konstantin Wegner hat den Fall detailliert analysiert und gibt Aufschluss über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die bei der Vergabe von Buchtiteln zu beachten sind.
In der Verlagsbranche ist der Titel eines Buches nicht nur ein einfaches Etikett, sondern spielt eine zentrale Rolle in der Vermarktung und Identifikation eines Werkes. Der Titel kann entscheidend dafür sein, wie ein Buch in den Händen von Lesern wahrgenommen wird und wirkt somit auch auf die Verkaufszahlen ein. Aus diesem Grund sind Titelrechte ein sensibles Thema, das häufig zu rechtlichen Auseinandersetzungen führt.
Im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob der Titel „Nie wieder keine Ahnung“ urheberrechtlich geschützt werden kann und ob er möglicherweise gegen bestehende Titelrechte verstößt. Der BGH stellte in seiner Entscheidung fest, dass Titel grundsätzlich einen gewissen Schutz genießen, solange sie ausreichend unterscheidungskräftig sind. Dies bedeutet, dass der Titel in der Lage sein muss, das betreffende Werk von anderen zu unterscheiden und eine klare Identifikation zu ermöglichen.
Ein weiterer Aspekt, den der BGH betonte, ist die Unterscheidung zwischen allgemeinen Begriffen und kreativen Titeln. Während allgemeine Begriffe oft nicht schutzfähig sind, können kreative und einzigartige Titel durchaus unter das Urheberrecht fallen. Der Titel „Nie wieder keine Ahnung“ wurde von den Richtern als ausreichend kreativ beurteilt, um eine gewisse Schutzfähigkeit zu besitzen. Dies ist ein wichtiger Punkt für Autoren und Verlage, die sich überlegen, welche Titel sie für ihre Werke wählen.
Rechtsanwalt Wegner hebt hervor, dass der BGH auch die Frage der Verwechslungsgefahr behandelt hat. Bei der Beurteilung, ob ein Titel geschützt ist, muss immer auch berücksichtigt werden, ob Verwechslungsgefahr mit bereits existierenden Titeln besteht. Hierbei sind verschiedene Faktoren zu beachten, darunter die Ähnlichkeit der Titel, die Art des Werkes und das Publikum, das angesprochen wird. Der BGH kam zu dem Schluss, dass in diesem speziellen Fall keine Verwechslungsgefahr mit anderen, bereits bestehenden Titeln gegeben war, was die Entscheidung zugunsten des Titels „Nie wieder keine Ahnung“ beeinflusste.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Urteils ist die Frage der Nachahmung. In der Verlagsbranche ist es nicht unüblich, dass Titel von anderen Autoren oder Verlagen als Inspiration verwendet werden. Dies kann jedoch schnell in rechtliche Grauzonen führen, wenn der neue Titel zu nah am Original ist. Der BGH hat in diesem Fall klargestellt, dass eine Nachahmung nicht automatisch zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führen muss, solange die Unterscheidungskraft des neuen Titels gewahrt bleibt.
Das Urteil hat weitreichende Implikationen für die Verlagslandschaft. Es zeigt, wie wichtig es ist, bei der Wahl von Buchtiteln sorgfältig vorzugehen und mögliche rechtliche Konsequenzen im Auge zu behalten. Autoren und Verlage sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass Titel eine Form von geistigem Eigentum darstellen, die rechtlich geschützt werden kann und sollte. Daher empfiehlt es sich, im Vorfeld rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das BGH-Urteil zu „Nie wieder keine Ahnung“ nicht nur ein präzedenzfall für den speziellen Titel darstellt, sondern auch wichtige rechtliche Grundsätze zu Titelrechten aufzeigt. Autoren und Verlage sind gut beraten, die gewonnenen Erkenntnisse zu beherzigen und sich entsprechend auf die rechtlichen Herausforderungen bei der Wahl ihrer Titel einzustellen.